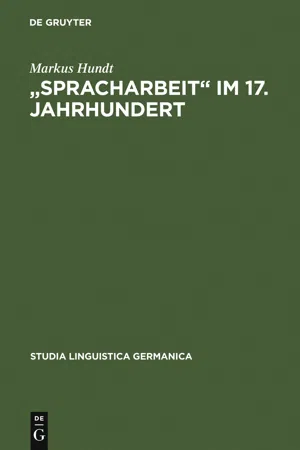
"Spracharbeit" im 17. Jahrhundert
Studien zu Georg Philipp Harsdörffer, Justus Georg Schottelius und Christian Gueintz
- 509 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
"Spracharbeit" im 17. Jahrhundert
Studien zu Georg Philipp Harsdörffer, Justus Georg Schottelius und Christian Gueintz
Über dieses Buch
Spracharbeit ist im 17. Jahrhundert ein Programm zur praktischen Umsetzung sprachtheoretischer Erkenntnisse. Der Autor erörtert die Stellung dieses Programms im Rahmen der zeitgenössischen Sprachauffassungen, die Hauptvertreter der Spracharbeit, die wichtigsten programmatischen und anwendungsbezogenen Texte sowie die Anwendungsfelder von der Phonologie/Graphematik bis hin zur kommunikativen Pragmatik. Es zeigt sich, daß insbesondere G. P. Harsdörffer in seinen Frauenzimmer Gesprächspielen Spracharbeit in Form von zahlreichen Sprachspielen demonstriert. Neben solchen Formen gehörte die Diskussions- und Übersetzungstätigkeit in der Fruchtbringenden Gesellschaft sowie die Kodifikation der deutschen Sprache in Grammatiken und Wörterbüchern (Schottelius, Gueintz) zu den Anwendungsgebieten. Ziel der Spracharbeit war es, die deutsche Sprache im europäischen Kontext aufzuwerten und ihre Verwendung in allen Kommunikationsbereichen zu ermöglichen.
Die konkreten Ausformungen des zeitgenössischen Sprachpatriotismus erweisen sich aus der Perspektive der Spracharbeit als Umsetzungsversuche von einer philosophisch motivierten Theorie in die kommunikative Praxis. Die Reduktion der zeitgenössischen Sprachreflexion auf sprachpuristische Ziele erweist sich im Licht der Spracharbeit als unhaltbar. Schließlich zeigt sich, dass Spracharbeit als sprachreflexive Praxis einen wichtigen Beitrag zur Etablierung und Normierung der neuhochdeutschen Standardsprache geleistet hat.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
- Abkürzungen
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 2. Das 17. Jahrhundert im Spiegel der Sprachgeschichtsschreibung
- 2.1 Forschungsschwerpunkte
- 2.2 Forschungsdesiderata
- 3. Spracharbeit und zeitgenössische Sprachauffassungen
- 4. Spracharbeit als Programm
- 4.1 „Schutzschrift für die Teutsche Spracharbeit“
- 4.2 „Specimen Philologiæ Germanicæ“
- 4.3 Zehn „Lobreden von der Uhralten Teutschen HaubtSprache“
- 4.4 „Sieben Traktate“ (5. Buch der AA)
- 4.5 Ebenen des Sprachsystems
- 5 Protagonisten der Spracharbeit
- 5.1 Institutionalisierung in der Fruchtbringenden Gesellschaft
- 5.2 Justus Georg Schottelius (1612–1676)
- 5.3 Christian Gueintz (1592–1650)
- 5.4 Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658)
- 6. Spracharbeit mit Lauten und Buchstaben
- 6.1 Beziehungen zwischen Phonemen und Graphemen
- 6.2 Lautmalerei und Lautsymbolik
- 6.3 Orthographie
- 6.4 Anwendungsfelder
- 7. Spracharbeit als Wortforschung
- 7.1 Gegenstand und Grundlagen der Wortforschung
- 7.2 Legitimationsstrategien
- 7.3 Anwendungsfelder
- 8. Exkurs: Sonderformen der Spracharbeit
- 8.1 Das Stammwort und seine Kodifikation
- 8.2 Fremdwortfrage und Purismus
- 8.3 Anwendungsfelder
- 9. Spracharbeit und Phraseologismen
- 9.1 Syntax und Syntagmen
- 9.2 Wissenskonstitution durch Analogien
- 9.3 Anwendungsfelder
- 10. Spracharbeit, Textsorten und kommunikative Pragmatik
- 10.1 Textsorten und Textstrukturierung
- 10.2 Kommunikationsmuster
- 10.3 Anwendungsfelder
- 11. Fazit
- Quellen
- Literatur