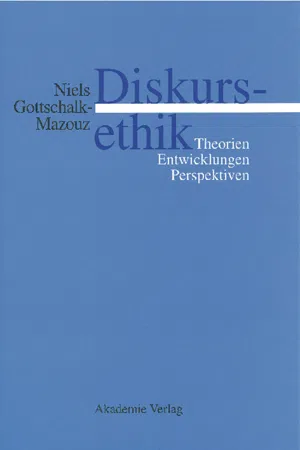
- 304 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Das durch die Arbeiten von Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas initiierte Forschungsprogramm der Diskursethik hat die Perspektive einer philosophischen Neubegründung der Moral eröffnet. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es hierzu eine breite Diskussion, in jüngster Zeit wurden schließlich verschiedene Ausarbeitungs- und Weiterentwicklungsversuche der ursprünglich vorgetragenen Ideen unternommen. Dabei wurden neben den Begründungsproblemen in der neueren Diskussion vor allem die Anwendungsprobleme als methodische Herausforderung empfunden.
In diesem Buch werden erstmals die verschiedenen Versionen und Varianten der Diskursethik, von den ersten Arbeiten der siebziger Jahre bis hin zur Gegenwart, systematisiert, verglichen und auf ihre spezifischen Leistungen hin untersucht: Vor welchen Begründungs- und Anwendungsproblemen steht die Diskursethik, auf welche von ihnen wollten die jeweiligen Autoren reagieren, und schließlich: Haben sie eine überzeugende Antwort gefunden? Aus der Vergewisserung über die (unverkürzten) Aufgaben einer Diskursethik und der Durchsicht der Begründungsprobleme der bisherigen Versionen heraus wird vorgeschlagen, die Diskursethik als ein "kognitivistisches Rahmenkonzept" zu verstehen, welches normativ unterschiedlich stark gefaßt werden kann und das den Rahmen für jedweden Versuch darstellt, praktische Fragen über Gründe zu entscheiden. Auch die meisten philosophischen Ethiken, die gewöhnlich der Diskursethik entgegengesetzt werden, setzen diese daher in einer mehr oder weniger starken Fassung voraus.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- 1. Aufbau
- 2. Diskursethik im Kontext - zwei Skizzen
- 2.1 Diskursethik und Moralphilosophie
- 2.2 Diskursethik und Habermassche Diskurstheorie
- I. BEGRÜNDUNGSFRAGEN
- 1. Das Begründungsprogramm der Diskursethik
- 1.1 Universalpragmatik
- 1.2 Transzendentalpragmatik
- 2. Durchführungsversuch per materialer Implikation - Rehg (1991)
- 2.2 Die erste Hauptprämisse
- 2.3 Die zweite Hauptprämisse
- 2.4 Die Ableitung von >U< in zehn Schritten
- 3. Durchführungsversuch per pragmatischer Implikation - Ott (1996)
- 3.1 Die Beziehung zwischen Prämissen und Konklusion (Moralprinzip): pragmatische Implikation
- 3.2 Die Geltung der Diskursregeln: unter einer egalitären Annahme
- 3.3 Zwei Vorschläge zur Begründung von >D<
- 3.4 Die anschließende Begründung von >U<
- 3.5 Die Architektur: >D< als Moralprinzip vor >U< als Argumentationsregel
- 3.6 Die Formulierung von >U<: Streichung der „Interessen“
- 4. Das fortwährende Moralgespräch - Benhabib (1990)
- 4.1 Begründungsschritte
- 4.2 Neufassung des Begründungsziels
- 5. Richtigkeit als Einwandfreiheit - Wellmer (1986)
- 5.1 Kritische Bedenken
- 5.2 Statt dessen: eine schwache Konsenstheorie
- 5.3 Verflechtung von Geltungsansprüchen
- 6. Die Moral des doppelten Respekts - Wingert (1993)
- 6.1 Dimensionen moralischer Verletzung
- 6.2 Kommunikative Lebensform und doppelter Respekt
- 6.3 Diskursethik als Operationalisierung
- 7. Versuch einer Neubegründung aus partikularen Geltungsansprüchen - Kettner (1998)
- 7.1 Moralurteile und rationale Bewerter
- 7.2 Gründe und gute Gründe
- 7.3 Adressaten-Partikularität guter Gründe durch Projektionseigenschaften
- 7.4 Noch einmal: Gründe und gute Gründe
- 7.5 Gewichtungen von Gründen und Universalisierung
- 7.6 Rechtfertigung der Exklusion und Universalisierung
- 7.7 Begründungen von Begründungen und Universalisierung
- II. ANWENDUNGSFRAGEN
- 1. Problemtaxonomie
- 1.1 Vier Hinsichten des Problems: A1-A4
- 1.2 Exemplarische Erläuterung dieser vier Hinsichten
- 1.3 Problemdifferenzierung: Intermediäre Regeln
- 1.4 Anwendungsfragen speziell in der Diskursethik
- 2. Anwendungsprobleme aus Sicht von Habermas
- 2.1 Siebziger Jahre: Keine explizite Diskursethik
- 2.2 Achtziger Jahre: Hegels Kantkritik
- 2.3 Neunziger Jahre: Auch kontextgebundene Diskurse
- 2.4 Diskussion der Habermasschen Sicht auf diskursethische Anwendungsprobleme
- 3. Probleme in der Transzendentalpragmatik
- 3.1 Anwendungsprobleme aus Sicht von Apel
- 3.2 Ausdifferenzierung des Anwendungsteils B durch Böhler
- 4. Ausarbeitung des Problems der Zumutbarkeit - Niquet (1992)
- 4.1 Der Weg zur Befolgungsgültigkeit
- 4.2 Betroffenheit und Beteiligung - ein Klärungsversuch
- 4.3 Kritik der Befolgungsgültigkeit
- 4.4 Warum überhaupt „allgemeine Befolgung“?
- 5. Ausarbeitung des Problems der Anwendungsdiskurse - Günther (1988)
- 5.1 Anwendungsprobleme von Normen überhaupt
- 5.2 Exkurs: Formale Rekonstruktion der Anwendbarkeit von Normen
- 5.3 Anwendungsprobleme des Moralprinzips
- 5.4 Primat der Anwendung vor der Begründung?
- 5.5 Fazit
- 6. Individuelle Normen und generelle Prinzipien - Alexy (1985/1995)
- 6.1 Individuelle Normen statt moralischer Faustregeln: Alexys Kritik an Günther
- 6.2 Anwendungsleitende Prinzipien
- 7. Diskursiv integre Texturübergänge - Kettner (1992/1998)
- 7.1 Metaethische Neupositionierung (1998)
- 7.2 Anwendungsprobleme
- 7.3 Kompromißbildung zwischen konfligierenden Moralen ohne Privilegierung der Moral-im-Diskurs?
- 8. Verschiedene Anwendungsebenen - Ulrich (1990/1997)
- 8.1 Diskursethik als Explikation des ‚moral point of view‘
- 8.2 Drei Stufen der Zumutbarkeit
- 8.3 Institutionalisierung von Diskursen?
- 9. Anwendung als Rationalisierung von Praxisfeldern - Ott (1996)
- 9.1 Kern und Schalen
- 9.2 Anwendungsdiskurse - reale Diskurse
- 9.3 Die Ableitung von grundlegenden Moral- und Rechtsnormen
- 9.4 Zumutbarkeit und Teleologie
- 9.5 Anwendungsprobleme zwischen Kern, Schalen und Fällen
- 9.6 Abwägung und Normenanwendung
- 9.7 Kriterien der Abwägung
- 9.8 Exkurs: Umgang mit Normkollisionen und Dissensen
- 9.9 Moralprinzipien-Kollision
- III. DISKURSETHIK ALS KOGNITIVISTISCHES RAHMENKONZEPT
- 1. Varianten der Diskursivität
- 2. Probleme der Standard-Diskursethik
- 2.1 Probleme von >U<
- 2.2 Probleme von >D<
- 2.3 Habermas’ Moralbegriff und die Berücksichtigung von nicht diskursfähigen Wesen
- 3. Diskurs, Gründe und Begründungen
- 3.1 Gründe geben und kommunikatives Handeln
- 3.2 Gründe, Sprecher und Sprecher-Interessen
- 3.3 Die Intersubjektivität von Gründen
- 3.4 Exkurs: Syllogismen als Modell gelungener Begründung
- 3.5 Primat der Aktion vor der Reflexion?
- 3.6 Umfassender Kognitivismus
- 4. Die strukturelle Normativität der Handlungsrechtfertigung
- 5. Schluß
- LITERATUR
- PERSONENREGISTER