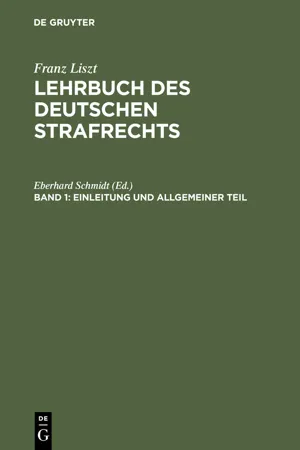
- 508 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Einleitung und Allgemeiner Teil
Über dieses Buch
Keine ausführliche Beschreibung für "Einleitung und Allgemeiner Teil" verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Einleitung und Allgemeiner Teil von Franz Liszt, Eberhard Schmidt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Rechtstheorie & -praxis. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- § 1. Der Begriff des Strafrechts und die Aufgabe des Lehrbuchs. I. Das Strafrecht als die rechtlich begrenzte Strafgewalt des Staates. II. Die Kriminalpolitik. III. Die Geschichte. IV. Die Quellen des Strafrechts
- I. Die antisoziale Bedeutung des Verbrechens und die soziale Funktion der Strafe
- § 2. Das Strafrecht als Rechtsgüterschutz. I. Die Rechtsordnung. II. Das Verbrechen. III. Die Strafe. IV. Sekundäre Natur des Strafrechts
- § 3. Die Ursachen und die Arten der Kriminalität. I. Der Begriff der Kriminologie. II. Akute und chronische Kriminalität. III. Der „Verbrechertypus“. IV. Die soziologische Auffassung des Verbrechens
- § 4. Die kriminalpolitischen Forderungen der Gegenwart und ihr Einfluß auf die jüngste Rechtsentwicklung. I. Der Grundgedanke. II. Der Ausgangspunkt. III. Einzelheiten. IV. Die Schranken des Zweckgedankens
- § 5. Der Streit der Strafrechtsschulen. I. Der Gegensatz der beiden Richtungen. II. Die Milderung des Gegensatzes. III. Die legislativen Ergebnisse
- II. Die Geschichte des Strafrechts
- § 6. Allgemein-geschichtliche Einleitung. I. Rechtsvergleichung und Kriminalpolitik. II. Der soziale Charakter der ursprünglichen Strafe. III. Die staatliche Strafe. IV. Der Zweckgedanke in der Strafe
- § 7. Das Strafrecht der Römer. I. Bis zum 7. Jahrhundert der Stadt. II. Die Zeit des Quästionenprozesses. III. Die Kaiserzeit
- § 8. Das mittelalterlich-deutsche Strafrecht. A. Das frühere Mittelalter: Bis zum 13. Jahrhundert. I. Ursprünglicher Charakter. II. Das Kompositionensystem. III. Die öffentliche Strafe. IV. Der Zerfall der fränkischen Monarchie. B. Das spätere Mittelalter: Vom 13. bis ins 16. Jahrhundert
- § 9. Die peinliche Gerichtsordnung Karls V. I. Die italienischen Juristen des Mittelalters. II. Die populär-juristische Literatur Deutschlands. III. Deutsche Gesetzgebungen; insbesondere die Schwarzenbergischen Arbeiten. IV. Die Entstehungsgeschichte der PGO. V. Ihre Bedeutung
- § 10. Das gemein-deutsche Strafrecht. I. Die Gesetzgebung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. II. Die gemeinrechtliche Wissenschaft. III. Die Rechtspflege. IV. Die Gesetzgebung seit 1750
- § 11. Das Zeitalter der Aufklärung. I. Die literarische Bewegung. II. Anerkennung der neuen Gedanken durch die Gesetzgebung
- § 12. Wissenschaft und Gesetzgebung bis zum Jahre 1870. I. Die Wissenschaft des Strafrechts. II. Die Geschichte der deutschen Strafgesetzgebung: Erster Abschnitt: Die deutschen Strafgesetzbücher vor 1851. Zweiter Abschnitt: Das preußische Strafgesetzbuch von 1851. Dritter Abschnitt: Die deutsche Landesstrafgesetzgebung nach 1851
- § 13. Die Entstehung und Weiterbildung des Reichsstrafgesetzbuchs. I. Fehlgeschlagene Versuche. II. Das StGB für den Norddeutschen Bund. III. Das RStGB. IV. u. V. Spätere Abänderungen. VI. Die Novelle vom 19. Juni 1912. VII. Die Veränderungen nach dem Weltkriege
- § 14. Die übrigen Reichsstrafgesetze
- § 15. Literatur des Reichsstrafrechts und seiner Hilfswissenschaften. I. Textausgaben. II. Systematische Darstellungen. III. Kommentare. IV. Abhandlungen allgemeineren Inhalts. V. Zeitschriften. VI. Spruchsammlungen. VII. Strafrechtsfälle. VIII. Hilfswissenschaften
- § 16. Die deutsche Strafrechtsreform. I. Die Vorarbeiten. II. Der Vorentwurf. III. Der Gegenentwurf. IV. Der Kommissionsentwurf von 1913 und der Entwurf 1919. V. Die Teilreformen in der Nachkriegszeit. VI. Der Entwurf Radbruch von 1922 und der amtliche Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuchs von 1925. VII. Die Entwürfe von 1927 und ihr Schicksal
- § 17. Die außerdeutsche Strafgesetzgebung. I. Danzig. II. Österreich. III. Tschechoslowakei. IV. Ungarn. V. Die Niederlande. VI. Der skandinavische Norden. VII. Der europäische Osten. VIII. Der europäische Südosten. IX. Die Schweiz. X. Das westliche Kontinentaleuropa. XI. Die iberische Halbinsel. XII. Die italienische Halbinsel. XIII. Großbritannien. XIV. Die Vereinigten Staaten von Amerika. XV. Die mittel- und südamerikanischen Staaten. XVI. Die Türkei. XVII. Ägypten. XVIII. Die hinterasiatischen Staaten
- III. Die Quellen des Reichsstrafrechts
- § 18. Das Strafgesetz. I. Norm und Strafgesetz. II. Das gesetzte Recht als einzige Quelle der Strafrechtssätze. III. Gesetz, Verordnung, Vertrag. IV. Begriff des Gesetzes. Druckfehler und Redaktionsversehen. V. Die gesetzlichen Quellen. VI. Blankettgesetze
- § 19. Das zeitliche Geltungsgebiet der Strafrechtssätze. I. Beginn und Ende ihrer Herrschaft. II. Die sog. rückwirkende Kraft der Strafrechtssätze. III. Anwendung des mildesten Gesetzes
- § 20. Das sachliche Geltungsgebiet der Strafrechtssätze. Reichsrecht und Landesrecht. I. Der Grundsatz. II. Die reichsrechtlich nicht geregelten „Materien“. III. Weitere Beschränkungen der Landesgesetzgebung. IV. Die Ausführungsgesetze der Einzelstaaten
- § 21. Das räumliche Geltungsgebiet der Strafrechtssätze. Grundsätzliche Erörterung. I. Begriff des internationalen Strafrechts. II. Die Prinzipien des internationalen Strafrechts. III. Die moderne Gesetzgebung
- § 22. Fortsetzung. Die deutsche Reichsgesetzgebung. I. Der Ausgangspunkt. II. Der strafrechtliche Begriff des Inlands. III. Im Auslande begangene Übertretungen. IV. Verbrechen und Vergehen im Auslande. V. Besondere Bestimmungen. VI. Die Entwürfe
- § 23. Fortsetzung. Internationale Rechtshilfe. I. Die Auslieferung als Akt der internationalen Rechtshilfe. II. Quellen des deutschen Auslieferungsrechts. III. Ausgestaltung der Auslieferungspflicht
- § 24. Das persönliche Geltungsgebiet der Strafrechtssätze. I. Staatsrechtliche und II. völkerrechtliche Befreiungen. III. Die Militärpersonen
- § 25. Ausnahmerecht. I. Bedeutung des Art. 48 RVerf. II. Aufhebung der entgegenstehenden früheren Bestimmungen des Reichs- und Landesrechts. III. Delegation der Befugnisse des Reichspräsidenten nach Art. 48 RVerf. IV. Das ReichsG vom 30. November 1919. V. Das Kriegs- und Nachkriegsstrafrecht
- Allgemeiner Teil
- Erstes Buch. Das Verbrechen
- § 26. Der Begriff des Verbrechens. I. Der formelle, II. Der materielle Verbrechensbegriff. III. Deliktsausschließungsgründe, persönliche Strafausschließungsgründe. IV. Erscheinungsformen. V. Verwaltungsstrafrecht
- § 27. Die Dreiteilung der Straftaten. I. Geschichtliches. II. Die Dreiteilung des geltenden Rechts. III. Die Bedeutung der Dreiteilung. IV. Anwendung der Dreiteilung
- I. Abschnitt. Die Verbrechensmerkmale
- I. Das Verbrechen als Handlung
- § 28. Der Allgemeinbegriff der Handlung. I. Die Willensbetätigung. II. Der Erfolg. III. Der Gefahrbegriff. IV. Beziehung des Erfolges auf die Willensbetätigung. V. Ort und Zeit der Handlung
- § 29. 1. Das Tun. I. Die Körperbewegung. II. Die Verursachung. III. Folgesätze. IV. Weitere Folgesätze. V. Die sog. Unterbrechung des Kausalzusammenhanges. VI. Geschichte der Frage. VII. Der Stand der Ansichten
- § 30. 2. Das Unterlassen. I. Begriff der Unterlassung. II. Das Problem von der Kausalität des Unterlassens. III. Echte und unechte Unterlassungsdelikte
- II. Das Verbrechen als rechtswidrige Handlung
- § 31. Die Rechtswidrigkeit als Begriffsmerkmal. I. „Objektive“ Rechtswidrigkeit. II. Formale und materielle Rechtswidrigkeit. III. Hervorhebung im Gesetz. IV. Keine Teilnahme an der rechtmäßigen Handlung. V. Geschichtliches
- § 32. Die Feststellung der Rechtswidrigkeit. Tatbestandsmäßigkeit und Rechtfertigungsgründe. A. Die Lehre vom Tatbestand. I. Bedeutung. Allgemeiner und besonderer Tatbestand. II. Aufbau und Funktion des besonderen Tatbestandes. Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit. B. Rechtfertigungsgründe. I. Positivrechtliche, II. übergesetzliche Rechtfertigungsgründe. C. Die Rechtswidrigkeit bei den unechten Unterlassungsdelikten. I. Versagen der Tatbestandsmäßigkeit als Indiz für die Rechtswidrigkeit. II. Die Rechtspflicht zur Erfolgsabwendung. III. Die Quellen dieser Rechtspflicht
- § 33. Die Notwehr. I. Geschichte. II. Die Merkmale des Begriffes. III. Überschreitung der Notwehr
- § 34. Der Notstand als Notrecht. A. Allgemeines. I. Geschichtliche Entwicklung des Problems. II. Die Differenzierungstheorie. III. Die Entwürfe. B. Einzelne Notrechte. I. BGB §§ 228. 904. II. Notrechte außerhalb des BGB. III. Der „übergesetzliche Notstand“
- § 35. Die übrigen Fälle ausgeschlossener Rechtswidrigkeit. I. Rechtspflicht. II. Besondere Berechtigung. III. Das richtige Mittel zum richtigen Zweck („Zwecktheorie“). IV. Wahrheitsgetreue Parlamentsberichte. V. Rechtlosigkeit
- III. Das Verbrechen als schuldhafte Handlung
- § 36. Der Schuldbegriff. I. Der Schuldvorwurf. II. Schuld, Schuldfrage, Schuldspruch. III. Entwicklung des Schuldbegriffs. IV. Erläuterung der einzelnen Elemente; insbesondere die Schuldarten. V. Schuld und Willensfreiheit. VI. Geschichtliche Entwicklung. VII. Ausnahmen vom Schuldprinzip
- § 37. Die Zurechnungsfähigkeit. I. Begriff und rechtliches Wesen. II. Stellung des Gesetzes. III. Zurechnungsfähigkeit und einzelne Deliktsgruppen. IV. Actiones liberae in causa
- § 38. Die Fälle der Zurechnungsunfähigkeit. A. Allgemeines. I. Begriff und rechtliches Wesen der Zurechnungsunfähigkeit. II. Stellung des Gesetzes. B. Die gesetzlich behandelten Fälle der Zurechnungsunfähigkeit. I. Fehlende geistige Reife. II. Fehlende geistige Gesundheit. III. Bewußtlosigkeit. C. Verminderte Zurechnungsfähigkeit
- § 39. Der Vorsatz. I. Begriff des Vorsatzes als Schuldart. II. Das psychologische Vorsatzelement. III. Das normative Vorsatzelement
- § 40. Fortsetzung. Der Irrtum. I. Der rechtserhebliche Irrtum. II. Der einflußlose Irrtum
- § 41. Die Fahrlässigkeit. I. Begriff der Fahrlässigkeit als Schuldart. II. Geschichtliches. III. Das psychologische Fahrlässigkeitselement. IV. Das zweifache normative Fahrlässigkeitselement. V. Bestrafung des fahrlässigen Handelns. VI. Fahrlässigkeit in bezug auf einzelne Verbrechensmerkmale. VII. Grade der Fahrlässigkeit. VIII. Die Fahrlässigkeitshaftung nach dem Preßgesetz
- § 42. Schuldausschließung infolge Nichtzumutbarkeit rechtmäßigen Verhaltens. I. Die Arten der Schuldausschließung. II. Die Zumutbarkeit rechtmäßigen Verhaltens. III. Vermutung der Nichtzumutbarkeit rechtmäßigen Verhaltens. IV. Einzelne Fälle solcher Vermutungen. V. Der unbedingt verbindliche Befehl. VI. Der Putativnotstand. VII. Schuldminderung und Irrtum über Strafmilderungsgründe. VIII. Vermutungen der Zumutbarkeit pflichtgemäßen Verhaltens
- IV. Die sog. objektiven Bedingungen der Strafbarkeit
- § 43. Wesen und Bedeutung. I. Bedingungen der Strafbarkeit. II. Prozeßvoraussetzungen
- II. Abschnitt. Die Verbrechensformen
- I. Vollendung und Versuch des Verbrechens
- § 44. Der Begriff des Versuches. I. Begriffsbestimmung. II. Geschichte. III. Vorbereitung und Versuch. IV. Arten des Versuchs. V. Zweifelhafte Fälle. VI. Bestrafung des Versuchs
- § 45. Der „untaugliche Versuch“. I. Geschichte der Frage. II. Begrenzung des Problems. III. Der Grundsatz. IV. Die Entwürfe
- § 46. Der Rücktritt vom Versuch. I. Seine Bedeutung. II. Rücktritt beim beendeten und beim nichtbeendeten Versuch. III. Freiwilligkeit des Rücktritts. IV. Der Rücktritt als Strafaufhebungsgrund
- II. Täterschaft und Teilnahme
- § 47. Überblick und Geschichte. I. Die Grundgedanken des geltenden Rechts. II. Die Geschichte der Frage. III. Die akzessorische Natur der Teilnahme. IV. Komplott und Bande; Begünstigung. V. Die notwendige Teilnahme. VI. Die Entwürfe
- § 48. 1. Die Täterschaft. I. Alleintäterschaft. II. Sog. mittelbare Täterschaft. III. Mittäterschaft. IV. Nebentäterschaft
- § 49. 2. Die Teilnahme. I. Anstiftung. II. Beihilfe
- § 50. Die Teilnahme. Folgesätze. I. Vorsätzliche Teilnahme an vorsätzlicher Handlung. II. Strafbarkeit der Haupthandlung. III. Unselbständigkeit der Teilnahmehandlung. IV. Mehrfache Beteiligung an demselben Vergehen. V. Einschränkungen des Grundsatzes. VI. § 4 JugGG
- § 51. Die Teilnahme. Einfluß persönlicher Verhältnisse. I. Mögliche Folgerungen aus der unselbständigen Natur der Teilnahme. II. StGB § 50. III. Andere Fälle
- III. Einheit und Mehrheit der Verbrechen
- § 52. Einheit und Mehrheit der Handlungen. I. Der Grundgedanke. II. und III. Die Fälle der Handlungseinheit
- § 53. Handlungsmehrheit und Verbrechenseinheit. I. Der Begriff. II. Die Anwendungsfälle. III. Das sog. Kollektivverbrechen
- § 54. Die Verbrechenseinheit. I. Die richtige Auffassung. II. Der 1. Fall. Scheinbare Gesetzeskonkurrenz. III. Der 2. Fall. Die scheinbare Verbrechenskonkurrenz (Idealkonkurrenz)
- § 55. Die Verbrechensmehrheit. I. Der Rückfall. II. Zusammentreffen mehrerer Verbrechen (Realkonkurrenz)
- Zweites Buch. Die Strafe mit Einschlufs der sichernden Massnahmen.
- I.
- § 56. Der Begriff der Strafe und der sichernden Maßnahme. A. Strafe und sichernde Maßnahmen: I. Begriffliches. II. Geschichtliches. B. Folgerungen aus dem Begriff der Strafe: I. Die Strafe als Übel, II. gerichtet gegen den Verbrecher, III. wegen der begangenen Rechtsverletzung, IV. verhängt durch die Organe der Strafrechtspflege. C. Verschieden von der peinlichen Strafe: I. Disziplinarstrafe, II. Ordnungsstrafe, III. nicht die polizeiliche Strafe
- II. Die Strafarten (Das Strafensystem)
- § 57. Das Strafensystem des geltenden Rechts und der Entwürfe. I. Haupt- und Nebenstrafen. Nachstrafen. II. Das System der Strafmittel im RStGB. III. Die Entwürfe
- § 58. DieTodesstrafe. I.Geschichte. II. Anwendungsgebiet. III. Vollzug der Todesstrafe
- § 59. Die Freiheitsstrafe. Allgemeines. Geschichte. I. Wesen und Ziel der Freiheitsstrafe. II. Geschichte
- § 60. Die Freiheitsstrafen der Reichsgesetzgebung. I. Die Arten. II. Ihre Unterschiede. III. Vollzug der Freiheitsstrafe
- § 61. Die Geldstrafe. I. Bedeutung innerhalb des Strafensystems. II. Folgerungen aus dem Wesen der Geldstrafe. III. Mindest- und Höchstbetrag. IV. Bemessung. V. Zahlung. VI. Beitreibung. Uneinbringlichkeit. VII. Tilgung durch freie Arbeit. VIII. Verwendung
- § 62. Nebenstrafen an der Freiheit. I. Polizeiaufsicht. II. Überweisung an die Landespolizeibehörde. III. Ausweisung
- § 63. Ehrenstrafen. I. Geschichte. II. Keine Ehrenhauptstrafe im geltenden Recht. III. Allgemeines über die Ehrennebenstrafen. IV. Aberkennung sämtlicher Ehrenrechte. V. Aberkennung einzelner Ehrenrechte. VI. Nachverfahren. VII. Weitere Ehrennebenstrafen
- III. Die Arten der sichernden Maßnahmen
- § 64. Die sichernden Maßnahmen des geltenden Rechts. I. Überblick. II. Die Erziehungsmaßregeln des JugGG. III. Die Unterbringung in einer Besserungs- oder Erziehungsanstalt oder in einem Asyl. IV. Unschädlichmachende Sicherungsmittel
- § 65. Die sichernden Maßnahmen im Entwurf von 1927. I. Besserungsmittel. II. Maßregeln der Unschädlichmachung
- Anhang
- § 65 a. Die Buße. I. Ihr Anwendungsgebiet. II. Ihr Wesen
- IV. Das Strafmaß in Gesetz und Urteil
- § 66. Die richterliche Strafzumessung. I. Absolute und relative Strafdrohungen. Geschichte. II. Die Strafrahmen des heutigen Rechts. III. Die Strafzumessung. IV. Strafänderung. V. Strafumwandlung. Strafanrechnung
- § 67. Strafänderung: 1. Strafschärfung. I. Die einzelnen besonderen Schärfungsgründe, insbesondere Rückfall. II. Die Gewinnsucht des § 27 a als allgemeiner Strafschärfungsgrund
- § 68. Strafänderung: 2. Strafmilderung. I. Allgemeine Milderungsgründe. Jugend, Versuch, Beihilfe. II. Besondere Milderungsgründe. Die „mildernden Umstände“
- § 69. Strafumwandlung. I. Umwandlung der Geldstrafe in Freiheitsstrafe. II. Umwandlung einer Freiheitsstrafe in eine andere. III. Umwandlung der Einziehung in Geldstrafe
- § 70. Anrechnung auf die verwirkte Strafe. I. Anrechnung der Untersuchungshaft. II. Anrechnung der im Auslande vollzogenen Strafe. III. Erwiderung oder Aufrechnung
- § 71. Zusammentreffen mehrerer Straftaten („reale Konkurrenz“). I. Notwendigkeit einer Milderung des Häufungsprinzips. II. Die Gesamtstrafe, III. und IV. Abweichungen. V. Besondere Bestimmungen der Nebengesetze
- V. Der Wegfall des staatlichen Strafanspruchs
- § 72. Die Strafaufhebungsgründe im allgemeinen. I. Der Begriff. II. Der Tod des Schuldigen. III. Die tätige Reue
- § 73. Die Begnadigung. I. Begriff, Geschichte und Aufgabe. II. Wirkung. Arten. III. Die Träger des Begnadigungsrechts. IV. Zusammentreffen landesrechtlicher Begnadigungsansprüche
- § 74. Die „bedingte Begnadigung“ („bedingte Strafaussetzung“, „bedingte Verurteilung“, „bedingter Straferlaß“). I. Wesen und Bezeichnung. II. Geschichtliche Entwicklung. III. Die bedingte Strafaussetzung in §§ 10 ff. JugGG 1923. IV. Rechtliche Natur
- § 75. Die Verjährung im allgemeinen. I. Rechtsgrund der Verjährung. II. Ihre Wirkung. III. Ihre Geschichte
- § 76. Die Verfolgungsverjährung. I. Die Verjährungsfristen. II. Beginn der Verjährung. III. Unterbrechung. IV. Ruhen und V. Wirkung der Verjährung
- § 77. Die Vollstreckungsverjährung. I. Die Verjährungsfristen. II. Beginn der Verjährung. III. Ruhen der Verjährung. IV. Unterbrechung der Verjährung. V. Verjährung der Nebenstrafen. VI. Verjährung in den Nebengesetzen
- VI. Die Rehabilitation
- § 78. Überblick und Geschichte. I. Der Grundgedanke. II. Die Geschichte
- § 78a. Das geltende deutsche Recht. I. Das Strafregisterwesen. II. Das StraftilgungsG vom 9. April 1920
- Register
- I. Verzeichnis der Gesetze des Reichs
- II. Verzeichnis der Staatsverträge
- III. Sachregister