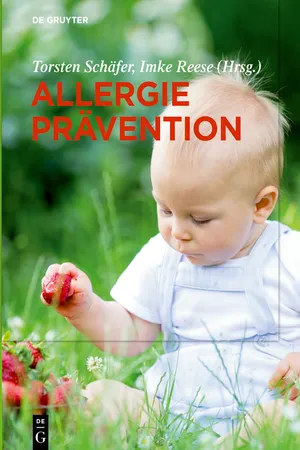
- 250 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Allergieprävention
Über dieses Buch
Welche Einflussfaktoren spielen eine Rolle bei der Entwicklung von Allegien? Wie entsteht Toleranz? Kann die richtige Ernährung Allergien verhindern? Allergien haben auch in den letzten Jahren weiter zugenommen. Um dem ansteigenden Trend begegnen zu können, kommt der Primärprävention besondere Bedeutung zu. Seit 2004 existiert in Deutschland eine S3 Leitlinie zu diesem Thema. In deren Umfeld stellen namhafte Experten die wichtigen und aktuellen Themenbereiche zur Prävention dar. Dabei gilt dem klinischen Blickwinkel und der praktischen Umsetzbarkeit ein besonderes Augenmerk.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
1 Allergieprävention
Imke Reese
Torsten Schäfer
Das Thema Allergieprävention betrifft ganz verschiedene Disziplinen, unter anderem Pädiatrie, Dermatologie, HNO-Heilkunde und Pneumologie. Im Folgenden werden Vertreter der vier genannten Fachgebiete ihre Sicht auf das Thema darstellen.
1.1 Allergieprävention aus der Sicht des Kinderarztes
Lars Lange
Die Sorge um ein heranwachsendes Kind ist an sehr vielen Punkten vor allem Vor-Sorge. Der lateinischen Wurzel nach steht Prävention für „zuvorkommen, verhüten“. Es liegt tief im elterlichen Gedankengut verwurzelt, dafür Sorge zu tragen, dass ein Kind nicht zu Schaden kommt, indem man mögliche Gefahren vorhersieht und verhütet. Den Kindern muss beigebracht werden, Situationen richtig einzuschätzen und nicht auf die Straße zu laufen oder bestimmte Dinge zu essen. Eltern sorgen dafür, dass sich ihre Kinder ausgewogen ernähren und passende Kleidung tragen um einem Schaden durch Hitze oder Kälte vorzubeugen. Später müssen soziale Regeln erlernt und eingehalten werden, um eine Integration in die Gemeinschaft zu ermöglichen. Vor diesen Präventionsaufgaben stehen Eltern jeden Tag mehrfach und erfüllen sie in aller Regel selbstverständlich.
Insofern ist Prävention für den Kinderarzt als Begleiter und Berater der Eltern ein zentrales Element der Arbeit. Die Felder, auf denen Prävention eine zentrale Rolle spielt, sind sehr variabel. Ein Großteil der Tätigkeiten liegt auf dem Gebiet der primären Prävention, also der Verhinderung von Gefährdungen aller Kinder, unabhängig von gesundheitlichen oder sozialen Risikofaktoren. Diese Präventionsarbeit beginnt bereits in den ersten Minuten des Lebens. Das Kind erhält zur Prävention von Blutungen durch Vitamin-K-Mangel orale Vitamin-K-Tropfen und seine erste U. Diese „U-Untersuchungen“ stellen ein zentrales Instrument sowohl im Sinne der Primär- als auch der Sekundärprävention, also der Früherkennung von Krankheiten dar. In zunehmenden Abständen werden die Kinder bis ins junge Erwachsenenalter nach einem festen Schema untersucht, es werden spezifische Risiken in den einzelnen Altersgruppen adressiert und Eltern über sinnvolle Verhaltensweisen, Gesundheitserziehung und Förderung der Kinder aufklärt.
Ebenfalls zum Vorsorgeprogramm gehört das wohl historisch erfolgreichste Verfahren im Rahmen der Prävention: die Durchführung von Impfungen. Kein anderes medizinisches Verfahren dürfte so viele Menschenleben gerettet und für eine so nachhaltige Veränderung der Lebensbedingungen der Menschheit gesorgt haben. Leider wird gerade diese so einfache und effektive Maßnahme immer wieder durch Impfgegner gestört. Die Ziele der WHO, gefährliche Infektionskrankheiten auszurotten, kann aber nur erreicht werden, wenn möglichst alle Kinder geimpft werden. Leider sind in unserem freiheitlichen Gesundheitssystem derartige sinnvolle Maßnahmen nicht verpflichtend, so dass das Gemeinwohl durch die Entscheidungen einzelner Gruppen von meist falsch informierten Eltern gestört wird.
Neben diesen konkreten medizinischen Maßnahmen gibt es zahlreiche Institutionen, die sich primär speziell um psychosoziale Prävention kümmern. So ist vielerorts das System der „Frühen Hilfen“ aufgebaut worden. Dort erhalten vor allem Eltern in schwierigen sozialen Verhältnissen vielfältige Hilfsangebote. Da es sich hier um Familien handelt, in denen oft bereits Drogen- oder soziale Probleme wie Armut oder fehlende Integration bestehen, kann diese Arbeit sowohl als primäre als auch als sekundäre Prävention betrachtet werden. Die Mitarbeiter der Frühen Hilfen bringen die betreuten Eltern auch mit dem Gesundheitssystem in Kontakt und helfen dabei, Empfehlungen der betreuenden Kinderärzte umzusetzen. Insofern sind sie Teil der Gesundheitsfürsorge.
Die zentrale Institution, die die primäre Prävention von Krankheiten zum Ziel hat, ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie hat in der Vergangenheit durch verschiedene Kampagnen viel erreichen können. So ist die Verhinderung von direkter oder indirekter Tabakrauchexposition, übermäßigem Alkoholkonsum oder sexuell übertragbaren Krankheiten durch deutschlandweite Kampagnen adressiert worden. Die Erfolge der Behörde, die sich oft mit den Kampagnen vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, sind bemerkenswert.
Angesichts der Vielfalt der Aufgaben und Ziele im Rahmen der Prävention macht die Allergieprävention nur einen kleinen Teil der Arbeit des Kinderarztes aus. Doch gerade auf diesem Gebiet hat sich gezeigt, dass auch die Wege zu einer erfolgreichen Prävention ständig überprüft werden müssen. Bei der Allergieprävention haben sich ganz zentrale Prinzipien in den letzten Jahren als falsch oder kontraproduktiv herausgestellt.
Neben dem Kinderarzt haben junge Eltern viele weitere Ratgeber. Hebammen und moderne Medien sind wichtige Informationsquellen. Leider sind moderne und individualisierte Konzepte hier bislang nicht immer angekommen. So ist die Empfehlung des möglichst langen und ausschließlichen Stillens gerade bei Kindern mit Atopierisiko überholt. Auch die Exposition gegenüber Allergenen, wie das Baden in möglichst natürlichen „Kleopatra-Bädern“, bestehend aus Öl und Kuhmilch, ist eine typische Empfehlungen, die kontraproduktiv ist und nicht selten Allergien auslöst statt sie zu verhindern. Andere Berufsgruppen wie Gynäkologen, die die Mutter während Schwangerschaft und Stillzeit beraten, sind häufig zum Thema Allergieprävention wenig informiert. Hier bestehen viele Chancen für sinnvolle Interventionen, die bislang ungenutzt sind.
1.1.1 Überholte Präventionsstrategien
Noch vor wenigen Jahren fußte die Grundidee der Allergieprävention auf dem Prinzip der Allergenmeidung. Es wurde empfohlen, dass Kinder mit einem Risiko für die Entwicklung von Nahrungsmittelallergien hochpotente Nahrungsmittelallergene in den ersten Lebensjahren meiden sollten. Hühnerei sollte erst nach dem ersten Lebensjahr, andere Allergene wie Nüsse und Erdnuss nach dem 3. Lebensjahr eingeführt werden. Diese Empfehlungen fußten auf einer Studie aus Neuseeland von 1981 [1], deren Ergebnisse nahelegten, dass Kinder, die vor dem 4. Lebensmonat Beikost erhielten, eine erhöhte Ekzemrate aufwiesen. Auch war die frühe Einführung von mehr als 5 Nahrungsmitteln mit mehr Ekzemen vergesellschaftet. Weltweit wurden daraufhin Präventionsempfehlungen ausgesprochen, die sich für die späte Einführung von potenten Allergenen in die Beikost aussprachen. Erst nach und nach änderte sich die Sicht auf diese Praxis. Immer mehr Hinweise aus Kohortenstudien zeigten, dass sich eine verspätete Beikosteinführung keineswegs protektiv auf die Entstehung von Allergien auswirkte, sondern im Gegenteil zu vermehrten Symptomen führen konnte. Schließlich konnte Hourihane zeigen, dass durch die Empfehlung, die Erdnussexposition bei Kleinkindern in Großbritannien zu meiden, nicht nur keine Reduktion der Rate an Erdnussallergien erreicht wurde, sondern vielmehr ein Anstieg zu verzeichnen war [2]. Das Konzept der Meidung wurde endgültig durch eine Meilensteinstudie erschüttert, in der ebenfalls eine englische Arbeitsgruppe zeigte, dass die Rate an Erdnussallergien in Israel trotz wesentlich früherer Exposition relevanter Erdnussmengen deutlich geringer war als in einer genetisch ähnlichen Gruppe in London, trotz der dort weitgehend konsequent betriebenen Erdnussmeidung [3].
Die Schwierigkeiten hinsichtlich einer wenig erfolgreichen Allergieprävention durch Meidung gelten nicht nur für Nahrungsmittelallergene. Auch die Reduktion der Hausstaubmilbenexposition als primäre Präventionsmaßnahme konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Verschiedene Studien zum Erfolg der Meidung von Milbenallergenen zur Verhinderung von Asthma und Allergien ergaben unterschiedliche Ergebnisse. Eine mögliche Ursache konnte eine britische Studie zeigen: der Erfolg der Meidung hängt ab von genetischen Varianten verschiedener Rezeptoren der Entzündungskaskade [4]. Einige Patienten profitieren von einer Umgebung, in der wenig Milbenallergen zu finden ist. Andere benötigen jedoch die Exposition mit Endotoxinen, die mit einer vermehrten Milbenexposition einhergeht, um eine Toleranz zu entwickeln. Da es nicht realistisch ist, eine Präventionsempfehlung erst nach vorheriger genetischer Testung auszusprechen, ist auch das Konzept der Milbenmeidung verlassen worden. Es zeigt sich also, dass eine Allergenmeidung kein sinnvolles Vorgehen für alle Kinder ist. Individuelle Risikofaktoren, die persönliche Umwelt und genetische Disposition entscheiden über Erfolg und Nutzen. Daher wendete sich der Blick hin zu neuen Konzepten.
1.1.2 Toleranzentwicklung als zentrales Element
Der derzeit zentrale Begriff in der Allergieprävention lautet „Toleranz“. Es ist als das grundlegende Prinzip erkannt worden, Toleranz zu erhalten oder, wenn sie nicht vorhanden ist, diese zu erreichen. Die Entwicklung von Toleranz ist wichtig, da der kindliche Organismus fast täglich mit neuen Stoffen aus der Umwelt konfrontiert wird. Das Immunsystem muss sich mit ihnen auseinandersetzen und dabei einerseits gefährliche Stoffe erkennen und diese abwehren sowie andererseits möglichst vieles als harmlos einstufen und eine stabile Toleranz etablieren. Nur unter besonderen Bedingungen reagiert der Körper mit Abwehr.
Darüber hinaus ist der Prozess der Toleranzentwicklung und -erhaltung kein Phänomen, das ausschließlich im frühen Kindesalter auftritt. Auch in höherem Alter lässt sich Toleranz induzieren, indem die betreffenden Allergene in einer individuell verträglichen Dosis regelmäßig aufgenommen werden. Dies ist ein immer mehr beachtetes Prinzip auch in der Therapie von Nahrungsmittelallergien. Zahlreiche Studien haben sich diesem Thema gewidmet und kommerzielle Anbieter stehen vor der Zulassung entsprechende Präparate.
Für die Entstehung von Nahrungsmittelallergien hat sich gezeigt, dass die Lokalisation des Erstkontakts entscheidend ist: Findet die erste Exposition und damit die erste Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem potenziell allergenen Protein im Darm statt, wird in aller Regel eine Toleranzentwicklung induziert. Findet dieser erste Kontakt aber in der Haut statt, gefördert durch eine gestörte Hautbarriere, kommt es zur Sensibilisierung.
Hier öffnet sich ein neuer Weg zu möglichen Präventionsmaßnahmen: die Behandlung der gestörten Hautbarriere. Wenn ein wichtiger Sensibilisierungsweg der Kontakt des Immunsystems mit allergenen Proteinen über die Hautbarriere ist, sollte es möglich sein, durch eine effektive Behandlung der Hautveränderungen diese Art der Sensibilisierung zu unterbinden. Leider liegen hierzu bislang nur kleinere Studien vor, die keine überzeugende Wirkung dieser Maßnahme zeigen. Mindestens eine große Studie, die eine Antwort bringen könnte, wird derzeit durchgeführt. Vor allem ist offen, welche Patienten von einer Stabilisierung der Hautbarriere profitieren. Ginge es nach großen Herstellern von Pflegemitteln für Säuglinge, sollten alle Kinder regelmäßig eingecremt werden. Dem pathophysiologischen Verständnis zufolge benötigen Kinder mit einer intakten Haut diese Pflege nicht, sondern nur solche mit gestörter Barriere aufgrund ihrer genetischen Disposition. Da die Messung der Stabilität der Hautbarriere mittels Bestimmung des transepithelialen Wasserverlusts keine Routineuntersuchung ist, muss der beratende Kinderarzt den klinischen Befund und die Anamnese der Eltern hinsichtlich Atopieneigung und Hautbeschaffenheit zugrunde legen. Somit ist es bislang nicht möglich, fragenden Eltern immer eine konkrete Empfehlung zu geben. Sind aber klare Risiken vorhanden, zum Beispiel wenn ein älteres Geschwisterkind bereits ein Ekzem und eine Nahrungsmittelallergie hat, kann mit gutem Gewissen eine Empfehlung zur regelmäßigen Hautpflege des Neugeborenen ausgesprochen werden.
1.1.3 Gezielte Allergen-Expostition?
Da die Exposition mit allergenen Proteinen über den Darm eher zu Toleranz führt, ist es entscheidend, dass dieser Kontakt vor oder zumindest zeitgleich mit dem Kontakt über die Haut stattfindet. Die LEAP-Studie von George Du Toit konnte als erste Interventionsstudie zeigen, dass eine frühe Einführung eines potenten Allergens wie Erdnuss mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Toleranz führt als die Meidung [5]. Diese Erkenntnis hat die Ansichten bezüglich Prävention von Nahrungsmittelallergien grundlegenden verändert. Schon bald wurden weltweit Empfehlungen vorgelegt, Erdnuss früh in die Nahrung von Hochrisikopatienten einzuführen. Nicht bedacht wurde dabei, dass die Ernährungsgewohnheiten in den einzelnen Ländern unterschiedlich und der Erdnusskonsum und damit die kindliche Exposition wichtige Einflussfaktoren sind. Bevor eine solche Maßnahme weltweit empfohlen wird, muss gesichert sein, ob die frühe Gabe in einer Familie, die keine Erdnüsse konsumiert, das Risiko einer Allergieentstehung erhöht.
Darüber hinaus ist vollkommen unklar, wie mit anderen Allergenen, zum Beispiel Schalenfrüchten, umzugehen ist. Hierzu liegen keine Daten vor. Bei der frühen Einführung von Hühnerei zur Prävention einer Eiallergie zeigt sich mittlerweile in manchen Studien ein gegenteiliger Effekt. Somit ist das, was für die Erdnuss als Allergen zu gelten scheint, für das Hühnerei nicht richtig.
Selbst wenn die frühe Gabe ein guter Weg ist, eine Allergie zu verhindern, ist sie kein einfacher Weg. Die Einführung der Beikost ist für viele Familien ein Kampf mit den Kindern. Es scheint aber, dass nicht nur die frühe, sondern auch die regelmäßige Gabe der allergenen Nahrungsmittel für den Erfolg der Intervention entscheidend ist. Das mag für ein Nahrungsmittel wie die Erdnuss möglich sein, wenn jedoch verschiedene Schalenfrüchte ebenso regelmäßig zusätzlich zu den weiteren für die kindliche Entwicklung wichtigen Nahrungsmitteln, zugefüttert werden sollen, ist die Umsetzung vielfach unmöglich. Dies zeigte die EAT-Studie, bei der Eltern früh sechs verschiedene allergene Nahrungsmittel regelmäßig ihren Kindern geben sollten [6]. Nur einem Teil der Eltern gelang dies unter den Studienbedingungen, die sicher eine besondere Motivation da...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Autorenverzeichnis
- Abkürzungen
- Was ist neu in der Allergieprävention?
- 1 Allergieprävention
- 2 Immunologische Toleranz auf Nahrungsmittel
- 3 Stillen und Allergieprävention
- 4 Ernährung der Mutter in Schwangerschaft und Stillzeit
- 5 Hydrolysatnahrung
- 6 Ernährung des Kindes
- 7 Hoch-ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung von Mutter und Kind
- 8 Probiotika und Präbiotika in der Allergieprävention
- 9 Vitamine
- 10 Art der Geburt und Risiko für Asthma, Heuschnupfen und atopisches Ekzem
- 11 Innenraumallergene: Haustierhaltung und Hausstaubmilbe
- 12 Luftschadstoffe und primäre Prävention von Allergien
- 13 Rauchen und Atopie
- 14 Weichmacher
- 15 Einnahme von Medikamenten und Risiko für Asthma, Heuschnupfen und atopisches Ekzem
- 16 Impfungen
- 17 Leitlinie Allergieprävention (2014)
- Stichwortverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Allergieprävention von Torsten Schäfer, Imke Reese, Torsten Schäfer,Imke Reese im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Klinische Medizin. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.