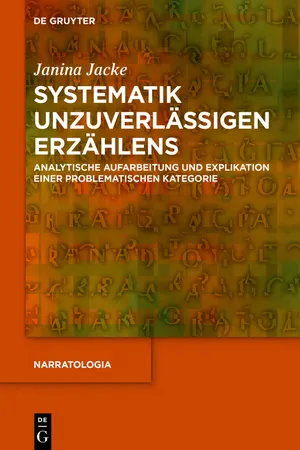
eBook - ePub
Systematik unzuverlässigen Erzählens
Analytische Aufarbeitung und Explikation einer problematischen Kategorie
- 342 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Systematik unzuverlässigen Erzählens
Analytische Aufarbeitung und Explikation einer problematischen Kategorie
Über dieses Buch
Unzuverlässiges Erzählen wird in der Narratologie hochfrequent diskutiert – dennoch besteht immer noch kein Konsens darüber, wie das Konzept definiert werden soll und welche Spezifika bei seiner Anwendung beachtet werden müssen. Durch die unübersichtliche Forschungssituation und die fehlenden Kriterien für einen Vergleich der Theorien verliert das Unzuverlässigkeitskonzept seine analytische Nützlichkeit.
Um diesen Problemen zu begegnen, liefert diese Arbeit erstmals einen ausführlichen, systematisch-vergleichenden Überblick über bisherige Unzuverlässigkeitstheorien. Dabei werden bestehende Definitionen unzuverlässigen Erzählens gegenübergestellt, definitorische Unklarheiten behoben, Typologien analysiert und die spezifischen Anwendungsbedingungen untersucht. Schließlich wird unter Rekurs auf existierende Unzuverlässigkeitstheorien, definitionstheoretische Kriterien und literaturwissenschaftliche Nützlichkeitserwägungen eine robuste Explikation unzuverlässigen Erzählens vorgeschlagen.
Der vorliegende Band dient so zum einen als Nachschlagewerk zur narratologischen Unzuverlässigkeitsdebatte, zum anderen liefert er ein gut handhabbares und heuristisch nützliches Analyseinstrumentarium für den Phänomenbereich unzuverlässigen Erzählens.
Um diesen Problemen zu begegnen, liefert diese Arbeit erstmals einen ausführlichen, systematisch-vergleichenden Überblick über bisherige Unzuverlässigkeitstheorien. Dabei werden bestehende Definitionen unzuverlässigen Erzählens gegenübergestellt, definitorische Unklarheiten behoben, Typologien analysiert und die spezifischen Anwendungsbedingungen untersucht. Schließlich wird unter Rekurs auf existierende Unzuverlässigkeitstheorien, definitionstheoretische Kriterien und literaturwissenschaftliche Nützlichkeitserwägungen eine robuste Explikation unzuverlässigen Erzählens vorgeschlagen.
Der vorliegende Band dient so zum einen als Nachschlagewerk zur narratologischen Unzuverlässigkeitsdebatte, zum anderen liefert er ein gut handhabbares und heuristisch nützliches Analyseinstrumentarium für den Phänomenbereich unzuverlässigen Erzählens.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Systematik unzuverlässigen Erzählens von Janina Jacke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literature & Literary Criticism Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
II Definitionen
Im Rahmen einer Definition wird festgelegt, was ein Ausdruck bedeuten soll. Damit liefern Definitionen Antworten auf Fragen des Typs „Was ist X?“. Eine Definition unzuverlässigen Erzählens gibt also Aufschluss darüber, was „unzuverlässiges Erzählen“ bedeuten soll, d. h. welche narrativen Phänomene der Ausdruck benennt – sie antwortet mithin auf die Frage „Was ist unzuverlässiges Erzählen?“ bzw. „Was wollen wir unter unzuverlässigem Erzählen verstehen?“. Kennen wir die Definition unzuverlässigen Erzählens, so verstehen wir, was ein Literaturwissenschaftler ausdrücken will, wenn er einen Erzähler als unzuverlässig bezeichnet.
Definitionen im engeren Sinne (auch: Äquivalenzdefinitionen) haben darüber hinaus eine ganz bestimmte Form: Sie bestehen aus dem zu definierenden Terminus (Definiendum, hier: „unzuverlässiges Erzählen“), dem definierenden Teil (Definiens) und dem Ausdruck einer Äquivalenzbeziehung zwischen diesen beiden Teilen (vgl. Pawłowski 1980: 9–17). Eine Äquivalenzdefinition gibt also die Bedingungen an, die notwendig und zusammen hinreichend sind, damit ein Begriff adäquat verwendet wird. In anderen Worten: Es gibt kein Phänomen, das die genannten Bedingungen erfüllt, aber nicht unter den fraglichen Begriff fällt, und es gibt kein Phänomen, das unter den Begriff fällt, die Bedingungen aber nicht erfüllt.
Die Definition unzuverlässigen Erzählens stellt meines Erachtens das wichtigste und grundlegendste Element einer Theorie unzuverlässigen Erzählens dar.20 Schließlich müssen wir, bevor wir uns weitere Gedanken über erzählerische Unzuverlässigkeit machen, erst einmal wissen, was Unzuverlässigkeit überhaupt ist. Wie bereits in der Einleitung angemerkt, finden sich in den meisten Unzuverlässigkeitstheorien aber keine expliziten Definitionen im oben genannten Sinne, sondern lediglich formlose Charakterisierungen des Phänomens, die oft mit der Angabe von Beispielen arbeiten. Wenn wir allerdings systematisch vergleichen wollen, was unterschiedliche Unzuverlässigkeitstheoretiker unter unzuverlässigem Erzählen verstehen, dann ist es sinnvoll, die Definitionen zu rekonstruieren, die sich aus ihren Ausführungen ergeben. Hierfür greife ich auf die Methode der rationalen Rekonstruktion zurück. Dabei handelt es sich um eine Methode der analytischen Philosophie, die im Grunde darin besteht, eine adäquate Zusammenfassung bestimmter Theorien zu liefern und diese Theorien zugleich so darzustellen (oder anzupassen), dass sie grundlegenden Rationalitätskriterien genügen, beispielsweise Widerspruchsfreiheit und Klarheit (vgl. Stegmüller 1979).21 Angewandt auf Unzuverlässigkeitstheorien hat diese Methode den Vorteil, die zentralen Intuitionen der fraglichen Unzuverlässigkeitstheoretiker in Bezug auf das Konzept unzuverlässiges Erzählen zu erhalten (d. h. an den praktischen Zielen, die mithilfe des Konzepts verfolgt werden, festzuhalten) und es zugleich zu einer klar umrissenen Analysekategorie zu machen. Letzteres ist zum einen eine wichtige Vorbedingung für eine regelgeleitete und transparente Verwendung des Ausdrucks „unzuverlässiges Erzählen“, zum anderen ermöglicht es, wie bereits deutlich gemacht, den systematischen Vergleich der unterschiedlichen Ansätze.
Bisherige Überblicksdarstellungen der existierenden Unzuverlässigkeitstheorien bzw. -definitionen (vgl. bspw. Nünning 1998; Nünning 1999; Kindt 2008; Shen 2013; Fonioková 2015; V. Nünning 2015a; Sternberg und Yacobi 2015) unterscheiden sich in mindestens einer von zwei Hinsichten von der Herangehensweise, der ich in den Kapiteln II.1 bis II.6 folge: Zum einen verfahren viele dieser Zusammenfassungen primär historisch, d. h. sie stellen die Entwicklung der Unzuverlässigkeitsforschung von Booths Einführung des Begriffs bis hin zu den aktuellsten Ansätzen dar. Zum anderen – und dies folgt unter anderem aus der historisch orientierten Darstellungsweise – sind die Überblicke meist unterkomplex. Meines Erachtens ist die historische Darstellungsweise in einigen der genannten Beispielüberblicke überhaupt nur deswegen möglich, weil die tatsächliche Komplexität der einzelnen Unzuverlässigkeitsdefinitionen nicht beachtet wird: Beim zusammenfassenden Vergleich wird meist nur ein Kriterium berücksichtigt, hinsichtlich dessen sich Definitionsvorschläge unterscheiden – nämlich die in der Einleitung bereits genannte Kopplung der Definitionen an bestimmte literatur- bzw. interpretationstheoretische Schulen. Hinsichtlich dieses Kriteriums lässt sich denn auch ein historischer Trend feststellen, der in Kapitel II.3 genauer thematisiert wird. Wie ich aber schon deutlich gemacht habe, stellt die Kopplung an literaturtheoretische Ansätze nur einen von sechs Parametern dar, in Bezug auf welche Unzuverlässigkeitsdefinitionen sich unterscheiden. Bezüglich der anderen Parameter lässt sich kein ähn-lich klarer historischer Entwicklungstrend feststellen – und außerdem würde ein historisch organisierter Überblick unter Berücksichtigung derart vieler Parameter heillos unübersichtlich werden.22
Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Faktor, der eine historisch geordnete und kompakte Darstellungsweise der Unzuverlässigkeitstheorien erschwert. Wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch deutlich werden wird, bestehen die Unzuverlässigkeitsdefinitionen, die sich aus den Theorien rekonstruieren lassen, oft aus mehreren Komponenten – und dies auch in Bezug auf einzelne Parameter. Wie können wir uns das vorstellen? Nehmen wir einmal den Parameter der von der Unzuverlässigkeit betroffenen Erzählertätigkeit (Kapitel II.1) als Beispiel. Viele Theoretiker geben auf die Frage, welche Erzählertätigkeit von Unzuverlässigkeit betroffen sein kann, mehrteilige (oder: disjunktive) Antworten.23 Sie würden also beispielsweise sagen: Unzuverlässiges Erzählen liegt genau dann vor, wenn etwas mit den Wertungen des Erzählers nicht in Ordnung ist oder wenn seine beschreibenden Darstellungen der fiktiven Ereignisse nicht adäquat sind. Hierdurch werden einzelne Definitionen so komplex, dass zum einen ein historisch geordneter Überblick nicht sinnvoll möglich ist – zum anderen sollte man sogar von der Priorisierung einer kompakten Darstellung der einzelnen Definitionsvorschläge absehen.
Mein Ansatz zur vergleichenden Darstellung der verschiedenen Definitionen unzuverlässigen Erzählens ist dementsprechend folgender: Die Unterkapitel II.1 bis II.6 widmen sich alle jeweils einem Parameter, in Bezug auf welchen die Definitionsvorschläge sich unterscheiden. In jedem Unterkapitel stelle ich nacheinander die unterschiedlichen Antwortoptionen dar, die sich in den Unzuverlässigkeitstheorien bezüglich der verschiedenen Parameter finden lassen. Nach der Vorstellung jeder Antwortoption lege ich kurz dar, in welchen Unzuverlässigkeitstheorien diese Antwortoptionen jeweils zu finden sind und in welcher Weise sie dort formuliert sind. Das bedeutet: Eine einzelne Theorie unzuverlässigen Erzählens wird potenziell in jedem der sechs Unterkapitel behandelt (nämlich immer dann, wenn sich der fragliche Theoretiker zu jedem der sechs Parameter positioniert) – und manchmal wird eine einzelne Theorie sogar an mehreren Stellen innerhalb eines Unterkapitels adressiert (nämlich immer dann, wenn der fragliche Theoretiker eine mehrteilige bzw. disjunktive Antwort bezüglich eines Parameters gibt). Diese Vorgehensweise ermöglicht eine detaillierte Analyse der Definitionsvorschläge.
Allerdings hätte auch ein historisches Vorgehen einige Vorzüge: Zum Beispiel werden so häufig die Gründe für bestimmte definitorische Entscheidungen einzelner Forscher eher deutlich, da die historische Darstellung besser zeigt, inwieweit ihre Definitionsvorschläge in (affirmativer oder kritischer) Auseinandersetzung mit vorherigen Theorien entstanden sind. Um die historische Dimension und die Einzeltheorien in ihrer Kompaktheit nicht aus dem Blick zu verlieren, findet sich deswegen am Ende jedes Unterkapitels eine Tabelle, in der die wichtigsten Theorien in historischer Reihenfolge gelistet sind und jeweils angezeigt wird, welche Antworten die einzelnen Theoretiker bezüglich der Parameter geben.24 Auf diese Weise wird nicht nur eine detaillierte Analyse der Definitionen ermöglicht, sondern auch ihr übersichtlicher und schneller Vergleich.
Damit die Systematik, der die Kapitel II.1 bis II.6 folgen, besser verständlich wird, möchte ich kurz noch einen stärker inhaltlich ausgerichteten Ausblick auf diese Kapitel liefern. Dafür stelle ich knapp vor, was sich jeweils hinter den sechs Parametern verbirgt, in Bezug auf welche sich die Definitionen unzuverlässigen Erzählens unterscheiden.
- Einen Parameter stellt die Tätigkeit des Erzählers (bzw. der Typ der Tätigkeit) dar, die von der Unzuverlässigkeit betroffen ist. Welches Verhalten bzw. welche Tätigkeit ist es, die einen Erzähler zu einem unzuverlässigen Erzähler macht? Welches Verhalten ist der Grund dafür, dass wir dem Erzähler nicht trauen können? Wie wir in der Einleitung bereits gesehen haben, sind hier unterschiedliche Antworten möglich. Beispielsweise können hier einerseits bestimmte faktenbezogene Tätigkeiten als relevant erachtet werden (z. B. die Assertionen eines Erzählers über die thematisierten Fakten bzw. Ereignisse), andererseits aber auch bestimmte wertebezogene Tätigkeiten (z. B. gewisse (außersprachliche) Verhaltensweisen, mittels derer der Erzähler bestimmte moralische Werte exemplifiziert). Die Erzählertätigkeit als relevanter Parameter ist schon in anderen theoretischen Arbeiten thematisiert worden – die Komplexität der Antworten, die sich in den verschiedenen Unzuverlässigkeitstheorien finden lassen, ist dabei allerdings nicht erkannt worden.
- Damit wir einen Erzähler als unzuverlässig bezeichnen können, muss er eine der relevanten Tätigkeiten inadäquat ausführen. Ein zweiter Parameter besteht dementsprechend in dem Kriterium, das diese Inadäquatheit bedingt. Was, zum Beispiel, macht die Assertionen eines Erzählers über die thematisierten Ereignisse inadäquat? Die Antworten, die sich hier oft finden lassen, sind: Inkorrektheit (d. h. die Vergabe falscher Informationen über die Ereignisse) und Unvollständigkeit (d. h. das Auslassen relevanter Informationen über die Ereignisse). Die Diskussion der Inadäquatheitskriterien wird dadurch verkompliziert, dass diese Kriterien sich teilweise für die verschiedenen Erzählertätigkeiten unterscheiden. Ein weiteres Problem besteht in der Unterbestimmtheit des Kriteriums der Unvollständigkeit.
- Einen dritten Parameter stellt die bereits thematisierte Wahl einer literatur- bzw. interpretationstheoretischen Schule dar, an die die Definition unzuverlässigen Erzählens gekoppelt ist. Um zu bestimmen, ob ein Erzähler eine der relevanten Tätigkeiten inadäquat ausführt, ist nicht selten eine umfassende Interpretation des fraglichen Textes notwendig. Damit so eine Interpretation regelgeleitet vorgenommen werden kann, muss ein theoretischer Rahmen gewählt werden, der die Regeln der Interpretation vorgibt. In diesem Zusammenhang wird meist zugleich eine bestimmte Instanz angegeben, die für Interpretationen als autoritativ betrachtet wird. Die Antworten verteilen sich hier auf den rhetorischen Ansatz (impliziter Autor), den intentionalistischen Ansatz (realer Autor) und den kognitivistischen Ansatz (Leser). Im Gegensatz zu den beiden vorher genannten Parametern kommt es im Zusammenhang mit der Interpretationstheorie bzw. der Bezugsinstanz kaum vor, dass innerhalb einer Unzuverlässigkeitstheorie in relevanter Hinsicht mehrere Antworten gegeben werden. Obwohl dieser Parameter zu den meistdiskutierten der Unzuverlässigkeitsdebatte gehört, ist er bisher nicht in seiner Komplexität erfasst worden: Wie ich deutlich machen werde, spielen Interpretationstheorien bzw. die dazugehörigen Bezugsinstanzen im Zusammenhang mit Unzuverlässigkeitstheorien in dreierlei Hinsicht eine Rolle. Diese drei Hinsichten sind aber bisher nicht auseinandergehalten (und folglich auch nicht gesondert diskutiert) worden.Sobald wir wissen, welche Antworten ein Unzuverlässigkeitstheoretiker auf die Fragen zu den ersten drei Parametern geben würde, kennen wir bereits die wichtigsten Facetten seiner Definition unzuverlässigen Erzählens. Diese ersten drei Parameter müssen in jeder Definition unzuverlässigen Erzählens bestimmt werden, damit die Definition vollständig und präzise ist. Darüber hinaus existieren allerdings noch drei weitere Parameter, die in einigen Unzuverlässigkeitsdefinitionen eine Rolle spielen. Werden diese Parameter bestimmt, so hat dies entweder eine Verkleinerung des Begriffsumfangs25 unzuverlässigen Erzählens zur Folge (wie im Falle des vierten und fünften Parameters) oder aber eine Vergrößerung desselben (wie im Fall von Parameter Nummer sechs).
- Einer der fakultativ best...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Vorwort
- I Einleitung
- II Definitionen
- III Typologie
- IV Prinzipien der Anwendung
- V Explikation unzuverlässigen Erzählens
- VI Schlussbetrachtungen und Ausblick
- Literatur
- Namensregister