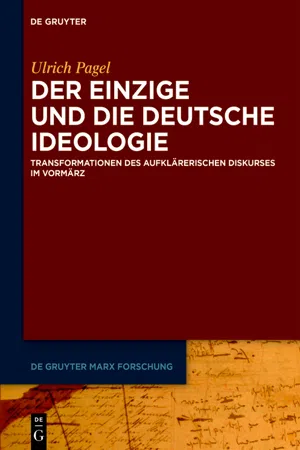
eBook - ePub
Der Einzige und die Deutsche Ideologie
Transformationen des aufklärerischen Diskurses im Vormärz
- 699 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der Einzige und die Deutsche Ideologie
Transformationen des aufklärerischen Diskurses im Vormärz
Über dieses Buch
Die große Aufmerksamkeit, die Karl Marx und Friedrich Engels bei der Konzipierung der materialistischen Geschichtsauffassung und der Ideologiekritik Max Stirners Der Einzige und sein Eigenthum gewidmet haben, gibt bis heute Anlass zu Verwunderung. Ausgehend von einer Einbettung dieser beiden zentralen Denkansätze der europäischen Geistesgeschichte in die deutsche Spätaufklärung des Vormärz und einer neuen Entzifferung der Manuskripte zur Deutschen Ideologie rekonstruiert die vorliegende Studie die Bedeutung einer der intensivsten Auseinandersetzungen, die Marx und Engels je mit einem Denker geführt haben.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Einzige und die Deutsche Ideologie von Ulrich Pagel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Moderne Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Die Wiederaufnahme des philosophisch-
aufklärerischen Diskurses im Vormärz
Stirner, Marx und Engels konzipieren ihre Ansätze zur Fortführung des emanzipativen Projekts der Aufklärung in Abgrenzung zu einem Diskurs, der, auch in der Perspektive der Zeitgenossen, die historische Geburtsstätte dieses Projekts bildet. Sie und die anderen Junghegelianer denken Aufklärung ursprünglich in einem philosophischen Rahmen, und die vormärzliche Gesellschaftskritik nimmt ihren Ausgang von dem Versuch der Wiederbelebung eines philosophisch-aufklärerischen Diskurses, von welchem allgemein angenommen wurde, er gestatte am ehesten, die theologische Hoheit in der Bestimmung des Bewusstseins zu brechen. In der christlichen Gestimmtheit der für die gesellschaftlichen Zustände verantwortlichen Bewusstseinsträger sehen sie, darin durchaus mit der sich in ständiger Bedrohung wähnenden Staatsgewalt übereinstimmend, den Garanten für die Erhaltung der monarchischständischen Gesellschaftsordnung. Im folgenden Kapitel wird dargelegt, wie die zu Beginn noch vereint streitenden Junghegelianer versuchten, die im Verlaufe des 19. Jahrhunderts verloren gegangene Frontstellung von Philosophie und Theologie zu restituieren.
Dabei wird zuerst gezeigt, in welcher Situation die sich konstituierenden Junghegelianer, einem ersten Impuls David Friedrich Strauß’ folgend, begannen, den philosophisch-aufklärerischen Diskurs aus der Hegel’schen Harmonisierung mit den Ergebnissen theologischer Evidenzproduktion zu befreien und inwiefern sie die Arena der Auseinandersetzung mit einem monarchischen Akteur zu teilen hatten, dessen diametral entgegengesetzter Versuch einer sakralen (Re-)Fundierung der preußischen Monarchie auf den nämlichen Voraussetzungen fußte, auf welchen sie selbst ihre Überzeugungsversuche gründeten (Abschnitt 1). Daran anschließend wird dieses, sowohl ihre eigenen diskursiven Einsätze, als auch die Maßnahmen ihrer Gegner strukturierende, bewusstseinszentrierte Modell gesellschaftlicher Veränderung, das überhaupt erst die politische Relevanz eines wiederbelebten philosophisch-aufklärerischen Diskurses begründete, in seinen drei verschiedenen Konfigurationen entwickelt (Abschnitt 2). Schließlich werden die beiden wirkmächtigsten Angriffe der junghegelianischen Phase der deutschen Spätaufklärung auf die Überzeugungskraft der theologischen Evidenzproduktion vorgestellt, nämlich die Feuerbach’sche anthropologische Reduktion der Religion, die eine philosophisch-sensualistische Produktion von Evidenz zu etablieren strebte (Abschnitt 3), und die Bauer’sche Rückführung des Christentums auf die Verwirklichung des Selbstbewusstseins, die auf eine philosophisch-naturalistische Produktion von Evidenz rekurriert (Abschnitt 4).
1.1Der Nährboden der Kritik – Kontexte der Restitution einer
Frontstellung von Philosophie und Theologie
Im Rahmen der Einleitung wurde eine Deutung der junghegelianischen Debatte skizziert, die diese im Kontext der Weiterentwicklung des um Emanzipation bemühten, aufklärerischen Diskurses im 19. Jahrhundert verortet. Das Ziel des aufklärerischen Diskurses in seiner klassischen Form wurde als die Erringung der Hoheit in der diskursiven Bestimmung der zustandsrelevanten Bewusstseinsträger charakterisiert und aus argumentationsstrategischer Perspektive als der Versuch bestimmt, die für die theologische Diskurskontrolle zentrale Form von Evidenzproduktion zu unterminieren. Letztere nimmt ihren Ausgang von einem Rekurs auf die theologische Evidenz heiliger Autoritäten (mit gelegentlichen Anleihen bei der philosophischen Evidenz gelingender Begriffsentwicklung). Im Folgenden wird zu untersuchen sein, in welchem Verhältnis die für die aufkommende junghegelianische Debatte grundlegende, auf der Spekulation Hegels gründende, philosophische Form der Produktion von Evidenz zur theologischen Evidenzproduktion steht, um ein Verständnis der Versuche zu ermöglichen, welche allen voran Ludwig Feuerbach und Bruno Bauer unternahmen, um sich sowohl von der theologischen, als auch von der philosophisch-spekulativen Form der Produktion von Evidenz abzusetzen.
Begonnen werden muss, dies liegt bei einer Untersuchung der junghegelianischen Aufklärung des Vormärz nahe, mit einer Entwicklung, die ein spezifisch preußisches Phänomen darstellt und die sich mit dem Namen Georg Wilhelm Friedrich Hegel verbindet. Die Philosophie Hegels war für die junghegelianischen Versuche der Wiederaufnahme und Weiterentwicklung des klassisch-aufklärerischen Diskurses natürlich von fundamentaler Bedeutung. Und dies nicht nur aus dem naheliegenden Grund ihrer prägenden Wirkung auf die Protagonisten der junghegelianischen Debatte, deren Absicht einer Überwindung der Hegel’schen Philosophie nicht darüber hinweg täuschen darf, dass sie dem Denkens Hegels malgré eux verhaftet bleiben – der „Verwesungsprozeß des Hegelschen Systems“, wie Marx und Engels den Zeitraum zwischen Strauß’ Leben Jesu und ihrer Arbeit an der „Deutschen Ideologie“ pointiert beschreiben werden,42 mag zwar eine „Verwesung“ sein, aber die Herausarbeitung aus dem gedanklichen Universum Hegels war für seine Schüler ein zäher und langwieriger Prozess. Von Interesse ist an dieser Stelle jedoch ein anderer Aspekt der Hegel’schen Philosophie. Wie im Folgenden zu sehen sein wird, bedingte die spezifisch Hegel’sche Form der Produktion von Evidenz, die nicht nur auf die philosophische Evidenz gelingender Begriffsentwicklung, sondern auch auf die theologische Evidenz heiliger Autoritäten rekurrierte, eine für die Wiederaufnahme des klassisch-aufklärerischen Diskurses im vormärzlichen Preußen folgenreiche Situation.
Auf die Evidenzen heiliger Autoritäten und gelingender Begriffsentwicklung wurde in der wissenschaftlichen Theologie wie auch in Hegels spekulativer Philosophie rekurriert. Der Unterschied lag in der Gewichtung der beiden Weisen der Evidenzproduktion: Griff die Theologie auf die Evidenz gelingender Begriffsentwicklung zurück, um die Ergebnisse des Rekurses auf die Evidenz heiliger Autoritäten zu stützen, lag das Gewicht im Falle gegenläufiger Evidenzerfahrungen also auf Seiten der theologischen Evidenz heiliger Autoritäten, so war das Verhältnis im Falle Hegels in gewissem Sinne umgekehrt. Der argumentative Hintergrund, vor welchem die Hegel’sche Philosophie ihre Geltung beweisen musste, war nicht die Evidenz heiliger Autoritäten (dann hätte er sich die Entwicklung der spekulativen Philosophie sparen können), sondern die Evidenz gelingender Begriffsentwicklung. Insofern ist die von Karl Löwith gebrauchte Metapher einer Hegel’schen „Versöhnung“ von Philosophie und Theologie irreführend,43 denn diese Versöhnung ist eine unter der Hoheit der Philosophie.44
Das von Hegel vollbrachte „Kunststück“ einer Harmonisierung der Ergebnisse von theologischer und philosophischer Evidenzproduktion ist in diesem Sinne eher darin zu sehen, dass Hegel eine vor dem Hintergrund philosophischer Evidenzerfahrungen sehr überzeugende Version einer letztlich widerspruchsfreien Vereinbarkeit der Ergebnisse der beiden Weisen der Produktion von Evidenz entwickelte. Für die Theologie stellte diese Leistung keinen besonderen Gewinn dar, denn aus theologischer Perspektive bedurfte die Wahrheit der heiligen Schrift nicht erst eines philosophischen Beweises.45 Die Hegel’sche Philosophie saß in der vormärzlichen Gemengelage insofern zwischen den Stühlen: für die wissenschaftliche Theologie war der philosophische Aspekt der Harmonisierung störend und schwächte eher die Überzeugungskraft der Evidenz heiliger Autoritäten, für die klassisch-aufklärerisch orientierten Philosophen stellte die Harmonisierung von theologischer und philosophischer Evidenzproduktion in erster Linie eine theologische Domestizierung der letzteren dar.
An dieser Stelle interessiert aber noch ein anderer Aspekt der Hegel’schen Harmonisierung. Die mit letzterer einhergehende Entschärfung des revolutionären Potenzials des philosophisch-aufklärerischen Diskurses, welcher in der Konsequenz der Hegel’schen Philosophie nur ein weiteres Moment der Verwirklichung der absoluten Idee darstellt, zeitigte verschiedene Konsequenzen, die sich vor allem in Preußen bemerkbar machten. So eröffneten sich den Anhängern der Hegel’schen Philosophie besonders günstige Karrieremöglichkeiten – eine Philosophie, die keine Gefahr mehr für das die bestehende Ordnung stützende christliche Bewusstsein war, die vielmehr zur weiteren Festigung des christlichen Bewusstseins beitrug und die darüber hinaus den philosophisch-aufklärerischen Angriffen unter Rekurs auf die gleichen Evidenzerfahrungen, also auf Augenhöhe begegnen konnte, konnte sich einer Unterstützung durch die sich gefährdet sehende Staatsmacht sicher sein. In Preußen verband sich die besondere Verankerung der Hegel’schen Philosophie im Bildungswesen mit der Person des von 1817 bis 1838 amtierenden Kultusministers Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein.46 Seiner wohlwollenden Haltung gegenüber der Hegel’schen Philosophie verdankten viele Schüler Hegels die Möglichkeit einer besoldeten akademischen Laufbahn. Zugespitzt formuliert, begründete die Hegel’sche Philosophie vor dem Hintergrund der in dieser Untersuchung verfolgten Fragestellung insofern eine Situation, in welcher der aufklärerische Diskurs nicht mehr in Frontstellung zur traditionellen Arbeitsteilung zwischen Theologie und Krone bei der Kontrolle der zustandsrelevanten Bewusstseinsträger stand, sondern in diese traditionelle Arbeitsteilung integriert wurde.
Diese Integration in die traditionelle Arbeitsteilung bei der Bestimmung des Bewusstseins konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die „Versöhnung“ von Theologie und Philosophie eine unter der Hoheit der letzteren war. Die Hegel’sche Philosophie war allenfalls eine theologisierte Philosophie, aber eben keine Theologie. Diese Spannung trat bereits offen zutage als David Friedrich Strauß 1835 mit seinem Leben Jesu für eine „mythische“ Erklärung der evangelischen Geschichte plädierte. So heißt es im Vorwort zur 1. Auflage: „Wenn die altkirchliche Exegese von der doppelten Voraussetzung ausgieng, daß in den Evangelien erstlich Geschichte, und zwar zweitens eine übernatürliche, enthalten sei; wenn hierauf der Rationalismus die zweite dieser Voraussetzungen wegwarf, doch nur um desto fester an der ersten zu halten, daß in jenen Büchern lautere, wenngleich natürliche Geschichte sich finde: so kann auf diesem halben Wege die Wissenschaft nicht stehen bleiben, sondern es muß auch die andere Voraussetzung fallen gelassen, und erst untersucht werden, ob und wie weit wir überhaupt in den Evangelien auf historischem Grund und Boden stehen.“47 Schon aus dieser Passage erhellt das Spannungsverhältnis, in welchem theologische Bibelexegese und kritische Wissenschaft, deren Gewissheit auf der Evidenz gelingender Begriffsentwicklung ruhte, standen.
Doch die Brüchigkeit der vermeintlichen „Versöhnung“ von Theologie und Philosophie und die von beiden Seiten zu eigenen Gunsten gelöste Frage nach der letztinstanzlichen Entscheidungskompetenz bezüglich der Gewichtung gegenläufiger Evidenzerfahrungen wurde von Strauß offensiv formuliert: „Den gelehrtesten und scharfsinnigsten Theologen fehlt in unsrer Zeit meistens noch das Grunderforderniß einer solchen Arbeit, ohne welches mit aller Gelehrsamkeit auf kritischem Gebiete nichts auszurichten ist: die innere Befreiung des Gemüths und Denkens von gewissen religiösen und dogmatischen Voraussetzungen, und diese ist dem Verfasser durch philosophische Studien frühe zu Theil geworden. Mögen die Theologen diese Voraussetzungslosigkeit seines Werkes unchristlich finden: er findet die gläubigen Voraussetzungen der ihrigen unwissenschaftlich.“48 Die im Zuge der Kritiken Feuerbachs und Bauers wieder aufbrechende Konkurrenz zwischen theologischer und philosophisch-aufklärerischer Bestimmung der politisch relevanten Bewusstseinsträger fand sich im Streit über die Interpretationshoheit der evangelischen Geschichte bereits antizipiert.
Im Gegensatz zu Feuerbach und Bauer zog Strauß jedoch nicht die Konsequenz einer vollständigen Disqualifikation der theologischen Evidenz heiliger Autoritäten, die schon bei der Hegel’schen Evidenzproduktion gegebene Ordnung von dominanter, philosophischer und unterstützender, theologischer Quelle von Evidenzerfahrungen blieb bei Strauß gewahrt: „Den inneren Kern des christlichen Glaubens weiß der Verfasser von seinen kritischen Untersuchungen völlig unabhängig. Christi übernatürliche Geburt, seine Wunder, seine Auferstehung und Himmelfahrt, bleiben ewige Wahrheiten, so sehr ihre Wirklichkeit als historischer Facta angezweifelt werden mag. Nur die Gewißheit davon kann unsrer Kritik Ruhe und Würde geben, und sie von der naturalistischen voriger Jahrhunderte unterscheiden, welche mit dem geschichtlichen Factum auch die religiöse Wahrheit umzustürzen meinte, und daher nothwendig frivol sich verhalten mußte.“49
Mochte die Verneigung vor den christlichen „ewigen Wahrheiten“ in der soeben zitierten Passage auch zum Teil der Rücksichtnahme auf die Anforderungen zensorischer Zustimmung geschuldet sein, so bleibt dennoch festzuhalten, dass die von Strauß betriebene Kritik der geläufigen biblischen Narration des Leben Jesu eine deutliche Distanznahme gegenüber den theologischen Selbstverständlichkeiten des Vormärz beinhaltete. Im Unterschied zu den in der Folge zu thematisierenden Kritiken Bauers und Feuerbachs zeigt sich jedoch auch, dass der Strauß’schen Kritik jede politische Motivation fehlte. Strauß kam zu seiner Erklärung des Leben Jesu allein durch ein kritisch-wissenschaftliches Erkenntnisinteresse. Insofern implizierte die Strauß’sche Kritik zwar eine Ablehnung der theologischen Bestimmung der zustandsrelevanten Bewusstseinsträger, sie erlaubte jedoch gleichzeitig die Wahrung eines Zustandes gegenseitiger Duldung zwischen philosophisch-kritischer Diskurskontrolle und monarchischer Verfasstheit des im Rahmen der Bewusstseinsbestimmung legitimierten Gesellschaftszustands. Es ist diese Situation, welche im Folgenden als die „staatstragende“ Variante junghegelianischer Aufklärung bezeichnet wird – Frontstellung zur Theologie aber Vertrauen auf die Zugänglichkeit monarchischer Entscheidungsträger für die Maximen vernünftigen Regierungshandelns. Hegel’sche Philosophie und Strauß’sche Kritik des Leben Jesu können folglich als noch nicht politisierte Vorläufer des von den Junghegelianern wiederaufgenommenen philosophisch-aufklärerischen Diskurses im Vormärz gelten.
Für den Beginn der Politisierung einer ursprünglich innerhalb der Hegel’schen Schule geführten Debatte über den richtigen Anschluss an die Philosophie Hegels zwischen den sich konstituierenden Lagern der Alt- und Junghegelianer, bzw. der Rechts- und Linkshegelianer,50 war der dynastische Wechsel an der Spitze des preußischen Staates im Jahre 1840 von grundlegender Bedeutung. Nach der 43 Jahre währenden Herrschaft des von den Zeitgenossen als stark reaktionär empfundenen Friedrich Wilhelm III., dessen Regentschaft nach dem Wiener Kongress 1815 und dem Ende der preußischen Reform-Ära vor allem darauf ausgerichtet war, den nicht zuletzt im Zuge der Juli-Revolution von 1830 erstarkten, liberalen Bestrebungen des aufkommenden deutschen Bürgertums die Entfaltung zu verwehren und die standesrechtliche Ordnung Preußens vor dem Korsett einer versprochenen, schriftlich zu fixierenden Konstitution zu bewahren, verbanden sich mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. am 7. Juni 1840 in den fortschrittlich gesinnten Kreisen große Hoffnungen.
Diese Hoffnungen nahmen ihren Ausgang nicht nur von der Person des neuen Königs, dessen zwar stark pietistisch geprägte, aber eben vorhandene Bildung ihn von dem Großteil seiner Vorgänger unterschied – so hatte Friedrich Wilhelm etwa Strauß’ Das Leben Jesu rezipiert –, sondern vor allem von der besonderen Bedeutung des Jahres 40 in der preußischen Geschichte. Seit den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Thronjubiläums Friedrich des Großen, des Sinnbildes einer von vielen ersehnten, aufgeklärten preußischen Monarchie schlechthin, waren zum Zeitpunkt der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. gerade ein paar Wochen vergangen, und dieser Vergegenwärtigung der Regierungszeit des „Philosophenkönigs“ kam sicher der größte Einfluss auf die geradezu eschatologische Aufladung der zeitgenössischen Erwartungen bezüglichen der neuen Regentschaft zu. Darüber hinaus markiert das Jahr 40 in der preußischen Geschichte nicht nur den Beginn der Herrschaft Friedrich des Großen – 1440 ist das Todesjahr des ersten Kurfürsten von Preußen, 1540 kennzeichnet den B...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- Einleitung
- 1 Die Wiederaufnahme des philosophisch-aufklärerischen Diskurses im Vormärz
- 2 Fraktionierung und Scheitern der junghegelianischen Aufklärung 1842/43
- 3 Die philosophische Aufklärung nach der Enttäuschung
- 4 Max Stirner als Vertreter der philosophischen Aufklärung
- 5 Die Konturierung einer nichtphilosophischen Aufklärung – Max Stirners Schriften nach der Enttäuschung von 1842/43
- 6 Die Kritik des philosophisch-aufklärerischen Diskurses in Der Einzige und sein Eigenthum
- 7 Max Stirners Entwurf eines individualistisch-aufklärerischen Diskurses
- 8 Eine kritische Neuausrichtung – Karl Marx und Friedrich Engels nach der Enttäuschung von 1842/43
- 9 Die Materialität der Kritik – Zum Abfassungskontext der philosophie-kritischen Manuskripte zur „Deutschen Ideologie“
- 10 Die Kritik von Stirners individualistisch-aufklärerischem Diskurs in den Manuskripten zur „Deutschen Ideologie“
- 11 Karl Marx’ und Friedrich Engels’ Entwurf eines erfahrungswissenschaftlich-aufklärerischen Diskurses
- 12 „Ideologie“ und „Kleinbürger“ als Komplemente
- 13 Der Einzige und die Deutsche Ideologie – Transformationen des aufklärerischen Diskurses im Vormärz
- Bibliografie
- Namenregister
- Sachregister