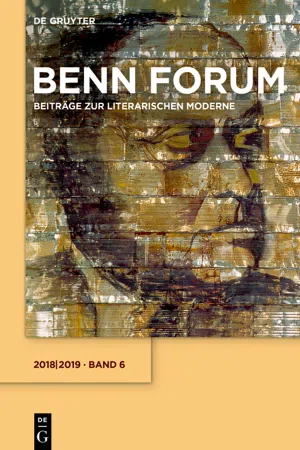
- 258 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Das "Benn Forum" erscheint alle zwei Jahre in Verbindung mit der Gottfried Benn-Gesellschaft. Es bietet wissenschaftliche Beiträge zu Leben und Werk Benns und zum literarischen Kontext seiner Zeit. Jeder Band präsentiert Aufsätze und Miszellen zu einem Themenschwerpunkt, einen umfassenden Rezensionsteil zu Neuerscheinungen und eine fortlaufende Benn-Bibliographie. Das Benn Forum stellt das zentrale Periodikum der internationalen Benn-Forschung dar
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
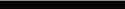
Beiträge des Gottfried-Benn-Symposiums 2018 zum Briefwechsel mit F.W. Oelze
Helmut Lethen (Wien)
„Häresie der Formlosigkeit“. Das Rätsel der Formvollendung im Briefwechsel von Oelze und Benn
Abstract: Mit Oelze schneit Benn eine Experimentalfigur ins Haus, mit dessen Erscheinung er Exzess und Normalität der Form von der Kleiderordnung bis zur klassischen Dichtung, von der Treue in der Form der Ehe bis zum Wunsch nach einem starken Staat in vielen Varianten durchspielen kann. Während Benn sich den Wechsel von Formverhärtung und Stürzen in die Formlosigkeit erlaubt, soll Oelze Garant der klassischen Form bleiben. Dieses Spiel will Oelze auf Dauer nicht mitspielen. Nicht immer will er auf Formvollendung verpflichtet werden. Er legt Wert auf eigene Abgründe des formlos Inkorrekten. Darüber entbrennt ein regelrechter Wettbewerb der Herren.
Der Titel meines Beitrags ist dem Buch entwendet, in dem Martin Mosebach 2002 seine Trauer und seinen Zorn darüber zum Ausdruck bringt, dass der Vatikan 1965 die römische Liturgie abschaffte.1 Die Messe in lateinischem Ritus, in dem die unermessliche Ferne Gottes noch präsent war, sei dem Konformitätsdruck des Familiären gewichen. Neue volkstümliche Sitten hätten die klassische Form der Messe durchdrungen. Die trockene Prosa des Gregorianischen Chorals, in dem jeder Satz eine Saite zum Klingen bringe, weil er an tief im Physischen wurzelnde Grundstimmungen rühre, hätte nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) in der offiziellen Kirche keine Chance mehr gehabt. Die Bindung der Christen an die römische Form sei verworfen worden. Schon mit Luther – dem „dreckige[n] Niedersachse[n]“, der, wie Gottfried Benn seinem Freund Oelze einmal schrieb, „Gewissensbisse an Stelle von Formproblemen“ einführte – seien unabsehbare Formlosigkeiten eingeläutet worden.2
Umso erstaunlicher ist die Anwesenheit beider Elemente, der Kälte der liturgischen Form und das Wuchern der Häresie in der Kunst des Protestanten Benn, die Latinität der Formhärte ebenso wie ihre Entzauberung durch naturalistische Einschüsse oder den Willen zur ‚Entformung‘ in Landschaften der Regression:
O Mittag, der mit heißem Heu mein Hirn
zu Wiese, flachem Land und Hirten schwächt,
daß ich hinrinne und, den Arm im Bach,
den Mohn an meine Schläfe ziehe –3
Das Rauschmittel Mohn soll logisches Denken außer Kraft setzen. Es begünstigt die Häresie der Formlosigkeit: Das Ich entgliedert sich in den Flächen eines Bachs, der Wiese, des Meers oder der Wüste, das Amorphe wird Erlösungsort. Aber Benn weiß, dass auch die Halluzinationen der Regression im Grund aus Vokabelmischungen verfertigt sind. Sobald Benns Rhythmusmaschine sie erfasst, das Raster des Metrums und die Echowirkungen der Reime die Sehnsucht in volksliedhafte Form bringt, nehmen sie eine abgründige Komik an:
O daß wir unsre Ururahnen wären.
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.
[...]
Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel:
vom Wind Geformtes und nach unten schwer. (SW I, 23)
Der Wunsch nach Auflösung des Personenpanzers in organisch verschwimmende Sphären hat hier, paradox genug, die Form einer kleinen mechanischen Spieluhr angenommen, die im Ton von Rilkes „Karussell“ („Und dann und wann ein weißer Elephant“) eine Regressionsmelodie abspielt.4
Regressionsmelodien sind dem Hanseaten Oelze ziemlich fremd und zu den frühen Gedichten Benns braucht er in der Korrespondenz der 30er Jahre ja auch nicht Stellung zu nehmen. Form hat für ihn immer auch mit einem Personenpanzer zu tun oder mit Vorstellungen von der reinen Form der Klassik, die nicht naturalistisch verschmutzt werden darf.
Benn achtet dabei darauf, dass die Halluzinationen der Auflösung des Subjektpanzers nicht auf die Form des Gedichts übergreifen. So sind manche seiner Drogengedichte singende Bauhauskuben. In einem späten Brief an Ernst Robert Curtius wendet er sich explizit gegen die Formexperimente von T. S. Eliot. Er werde nicht aufhören zu fragen, ob dessen
Dunkelheit und Mystik ein Mangel an Clarté ist, an Formverpflichtung, an Herausarbeiten der inneren Dinge zu der gläsernen durchsichtigen Welt, die nun einmal die Kunst ist. Wenn Kunst ein Ausgleich zwischen Tradition und Originalität ist, scheint mir ein Beharren in einer so abstrusen Originalität der Form bei Konformismus des Inhalts eher ein Manko zu sein und eine Verdeckung von Mängeln.5
Der Briefwechsel von Oelze und Benn kreist um einen Begriff der Form, der auch im Brennpunkt der Philosophischen Anthropologie der Zwischenkriegszeit stand. Der Vergleich soll die Konturen der unterschiedlichen Formbegriffe bei Benn und Oelze schärfen.
1„Sich in Form bringen!“ Eine Parole der Philosophischen Anthropologie
Berühmte Denker der Zwischenkriegszeit wie Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen, Walter Benjamin, Ernst Cassirer, Norbert Elias, Carl Schmitt, Hans Freyer, Elias Canetti, Jakob Johann von Uexküll, Max Horkheimer oder Martin Heidegger – dachten nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs über eine Neujustierung von sozialer Nähe und Ferne nach. Vertrautheitszonen mussten nach 1919 neu erfunden werden. Die Denker entwarfen Bilder von der Natur des Menschen in einem sozialen und politischen Raum, der durch Bürgerkrieg, instabilen Parlamentarismus und gegen Ende der Republik durch totale Mobilmachung gekennzeichnet war. Als größtes Desaster galt ihnen der Sturz in die Formlosigkeit der amorphen Massengesellschaft. Dagegen mussten die Bürger sich wappnen. Sich in Form bringen, lautete demnach die Parole der politischen Anthropologen der Zwischenkriegszeit.
An den Schriften Helmuth Plessners vor 1933 lässt sich die Idee der Form in groben Strichen erläutern.6
Der Reiz von Plessners Schrift „Grenzen der Gemeinschaft“ aus dem Jahr 1924 liegt in der harten Fügung, mit der der Autor die noble Figur aristokratischen Verhaltens der Höflichkeit in die Landschaft des Bürgerkriegs versetzt, um dem Bürgertum einen letzten Richtwert guten, das heißt ehrenwerten Lebens zu zeigen. Plessner geht davon aus, dass souveräne Lebensführung in einer von Krieg und Bürgerkrieg gezeichneten Gesellschaft bei aller Höflichkeit die Bereitschaft zu Gewaltanwendung einschließt. So steht in seiner Verhaltenslehre die Tugend der Grazie, des Taktes und der Diplomatie unvermittelt neben dem Willen zur Härte scharfer Grenzziehung zu Misstrauens- und Feindeszonen, mit der der Einzelne sich seiner Identität versichert.7
Der Mensch tritt in der Gesellschaft, die Plessner vor Augen steht, hier niemals in ‚Rohform‘ auf, sondern immer schon in einer sozialen Rolle, mit der er sich gegen die toxische Wärme der Zwischenmenschlichkeit in der Gemeinschaft, die ihn aufzusaugen droht, wappnet: „Das Individuum muß zuerst sich eine Form geben, in der es unangreifbar wird, eine Rüstung gleichsam, mit der es den Kampfplatz der Öffentlichkeit betritt.“8
Das entspricht, so der studierte Zoologe Plessner, auch der biologischen Konstitution des Menschen, der von Natur aus künstlich, ein Kulturwesen ist. Souverän kann er sein Leben nur führen, wenn er selbstbewusst die künstlichen Umwelten der Gesellschaft für sich nutzt. Um Situationen des Beschämtwerdens zu vermeiden, darf er dabei freilich nie aus der Rüstung fallen, muss darauf achten, dass seine Leidenschaften niemals ‚nackt‘ nach außen dringen.
Das Menschenbild, das Plessner vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten entwirft, ist kühn. Zur stoischen Einsicht in die geistige Obdachlosigkeit des Menschen – „Von Überwölbungen ist nichts zu erwarten, außer, dass sie einstürzen“, sagt er 19319 – gesellt sich die Gewissheit, dass selbst der Körper des Menschen im Laufe der Evolution nicht festgelegt wurde. Plessner entzieht der Vorstellung, der Mensch sei sich selbst als Naturwesen vorgegeben, die Basis, und entwirft das Bild eines Menschen zwischen metaphysischer Leere und biologischem Abgrund, entfernt den Menschen aus Ursprungsmythen jeder Art, verneint die Gemeinschaft als Möglichkeit einer stabilen Verankerung. Er ist in die anonyme Öffentlichkeit der Gesellschaft geworfen. Sie bildet den ‚einzigen Möglichkeitshorizont‘ seiner Existenz. Das von Gott, Biologie und Gemeinschaft verlassene, rastlose Wesen kommt selbst in Institutionen nicht zur Ruhe. Es gibt keine Entlastungsräume – denkt er 1924.
1931 ist in Plessners Schrift „Macht und menschliche Natur“ Schluss mit der Vorstellung von der Souveränität eines aristokratischen Duellsubjekts, mit der er sich 1924 aus der Situation des Bürgerkriegs herausgewunden hatte. Jetzt sucht er auf der Flucht vor der „Bodenlosigkeit des Seienden“10 nach Rettungsankern. Es gilt, einen Halt zu finden, und Plessner findet ihn in der Haltung – ein Schlüsselwort der Konservativen Revolution. Eine Haltung ‚politischer Entschlossenheit‘, abhängig von der ‚ganzen Lage des Volkes‘, dem der Mensch, wie er sagt, in ‚bluthafter Affinität‘ verbunden ist. Das ‚Dasein dieser Nation‘ muss verteidigt werden.
Geschichte bestand für Plessner immer in einer stetigen Verlagerung des „Unheimlichkeitshorizontes“11 der Existenz. Gegen Ende der Republik hat die Krise diesen auf die „Freund-Feindrelation“12 Carl Schmitts verengt. Plötzlich schien ihm die „Volkhaftigkeit“13 des Lebens ein solider Boden der Existenz zu sein.
Das hatte man während der stabilen Phase der Republik von Plessner nicht erwarten können; auch von Benn hatte kaum einer die Wende zu Volk, Rasse und starkem Staat erwartet.
Für Plessner war die ‚Ungesichertheit‘ des Menschen kein Grund zur Panik. Rettung winkt den Menschen, wie bereits berichtet, in der Befolgung einer Parole, deren Echo in den zwanziger Jahren durch die Verhaltenslehren der unterschiedlichsten politischen Lager hallt: Man muss sich in Form bringen, wenn man auf dem Kampfplatz der Gesellschaft bestehen will. Selbst der Kampf um Leben und Tod muss „in Formen verlaufen“.14
War dieser Wunsch nach Haltung der Härte in jenem Jahrzehnt typisch deutsch? 1934 erläuterte, aus seinen Kriegserfahrungen schöpfend, der französische Kulturanthropologe Marcel Mauss, in seiner berühmten Rede über ‚Körpertechniken‘, den Wert der Erziehung zur ‚Kaltblütigkeit‘. Mauss hatte seinen Körper im Extrem-Sport bis zur Kaltblütigkeit trainiert: „Der hauptsächliche Nutzen, den ich heute in meiner früheren Bergsteigerei sehen kann, war die Erziehung zur Kaltblütigkeit, die es mir erlaubte, stehend auf einem winzigen Vorsprung am Rande des Abgrunds zu schlafen.“15
Doch Plessner wagt auch einen Blick auf die Kehrseite der Selbstermächtigung, die das Sich-in-Form-Bringen bedeutet. Zwar scheint der Mensch über höfliche oder kriegerische Spielformen relativ souverän zu verfügen, er unterliegt in seiner Geschichte jedoch immer auch Schwerkraft-, Fall- und Vererbungsgesetzen, ist ihnen
wie ein Stück Vieh unterworfen, mit Maß und Gewicht zu messen, bluthaft bedingt, dem Elend und der Herrlichkeit einer blinden Unermeßlichkeit ausgeliefert. Blind wie sie steigen aus ihr in seinem Bezirk die Gewalten der Triebe und stoßen ihn, letzten Endes berechenbar, in die Bahn der lebendigen, sterblichen Dinge.16
Unversehens kippt die Selbstgewissheit des formvollendeten Akteurs in die Ahnung um, mit seinem Körper der Gleichgültigkeit der Naturgeschichte ausgeliefert zu sein.
In Plessners früher Anthropologie geht es zu wie in einem Drama Shakespeares. Zwischen der Souveränität zu freien, nicht von Moral gelenkten Entscheidungen einerseits und dem dunklen Triebschicksal des ‚Naturdings‘ Mensch, das Aggressionsschüben ausgesetzt ist, andererseits – klafft Leere. Plessner füllt sie nicht mit dialektischen Denkfiguren oder raffinierten Vermittlungen, während Benn während seiner NS-Episode auf die Idee kommt, mithilfe der Züchtung das Naturding Mensch zur gepanzerten Person zu verwandeln, wie schon Sparta es vorgeführt habe. In seinem surrealistischen Bild von der „Dorischen Welt“ führt er den Typ des idealen Spartaners vor Augen: Sein Rumpf ist entschieden größer als sein Kopf, über den Benn weiter nichts berichtet. In diese Halluzinationen des Kälte-Typs in der NS-Zeit verlor sich der Philosoph Plessner nicht. Zur Zeit der „Dorischen Welt“ war Plessner bereits in die Emigration gezwungen worden. Einen Punkt der Übereinstimmung gab es allerdings.
1931 hatte Plessner erklärt, dass jede Anthropologie, die von einer ‚riskanten‘ Natur des Menschen ausgehe, einen starken Staat fordere. Anders gesagt: Jede Politische Philosophie, die für einen starken Staat plädiere, gehe vom ‚gefährlichen‘ Wesen des Menschen aus, das diszipliniert werden müsse. Während aber nach Plessners Einschätzung die ‚Linksparteien‘ die Einsicht in die aggressive Natur des Menschen als Desillusionierungsmittel nutzen, um die Sitten des Kampfes in der Gesellschaft zu zivilisieren, dient sie den ‚Rechtsparteien‘ zur Demaskierung, „welche das wahre Antlitz des Menschen in seiner nackten Brutalität enthüllt“.17 Carl Schmitt begrüßte in seiner Schrift „Der Begriff des Politischen“ die Einsicht von Plessner, denkt aber eher an Demaskierung. Beide erinnern sich zwangsläufig an den „Leviathan“ von Thomas Hobbes, der den vollständigen Titel: „Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens“ hat.
2Formen des starken Staates und andere formfordernde Kulturtechniken
Die Konstruktion ‚des Menschen‘ in den zitierten Schriften von Plessner weist einige Berührungspunkte mit Benns Anthropologie auf. In der Annahme, die ‚gefährliche Natur‘ des Menschen bedürfe eines starken Staats, kann man, wie gesagt, sogar eine Übereinstimmung feststellen. Andererseits steht Benns Denken in krassem Gegensatz zu Plessners Behauptung, der Mensch sei sich als Naturwesen nicht vorgegeben; denn er sei von Natur aus künstlich. Den Hochmut des Kulturalismus teilt Benn nicht.
Gottfried Benn hatte sich 1933 von der Diktatur eine „anthropologische Wende“18 versprochen, weil sie „gegen dies naturalistische Chao...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Editorial
- Inhalt
- Beiträge des Gottfried-Benn-Symposiums zum Briefwechsel mit F.W. Oelze
- Rezensionen
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu 2018/2019 von Holger Hof, Stephan Kraft, Holger Hof,Stephan Kraft, Gottfried-Benn-Gesellschaft im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Deutsche Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.