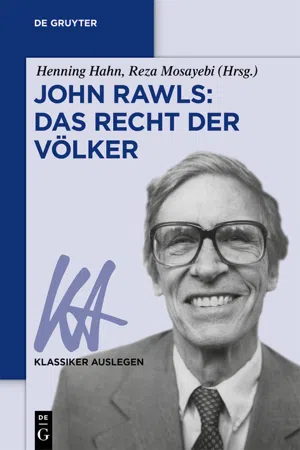1 Einführung
Der Philosoph, der vor allem an der Harvard University gelehrt hat, John Rawls, vertritt in seinem umfangreichen Gesamtwerk einen einzigen Gedanken: Die erste Tugend sozialer Institutionen, die politischer Gerechtigkeit, ist als Fairness zu verstehen. Ihr zufolge besitzt, hier im scharfen Gegensatz zum Utilitarismus, jeder Mensch, heißt es gleich zu Beginn der Hauptschrift A Theory of Justice (1971; auf Deutsch Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1975), „eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohls der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann“. Dieser Grundgedanke beherrscht auch Rawls’ Monographie zum Völkerrecht: The Law of Peoples (1999; auf Deutsch: Das Recht der Völker, 2002).
Wie von beiden zu erwarten, vom längst berühmten Autor, John Rawls, und dem hochaktuellen Thema, einem Völkerrecht, das hier nicht juristisch oder politikwissenschaftlich, sondern philosophisch betrachtet wird, hat sich binnen kurzem eine intensive weitläufige Debatte zwischen Kritikern und Verteidigern von Rawls entfaltet. (Vgl. schon Brock (2010), die zwar wie dort üblich nur anglophone Texte berücksichtigt, dabei aber auch zwei deutsche Autoren, Wilfried Hinsch und Rainer Forst, bespricht.)
1.1 Politische Gerechtigkeit ohne Völkerrecht?
In seiner fraglos überragenden Gerechtigkeitstheorie Eine Theorie der Gerechtigkeit befasst sich John Rawls vor allem mit der Gerechtigkeit eines Gemeinwesens. Von diesem Blickwinkel aus könnte man das Völkerrecht für so gut wie bedeutungslos halten, weshalb es keiner Überlegungen wert sei.
Für Rawls’ philosophisches Vorbild, Immanuel Kant, hatte sich eine derartige Erörterung noch von selbst verstanden. Seine Gerechtigkeitstheorie, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (kürzer: Rechtslehre) genannt, entfaltet nämlich das öffentliche Recht in allen hier denkbaren Dimensionen: als Staatsrecht, als Völkerrecht und – Kants Innovation – als Weltbürgerrecht.
Eine derartige Systematik von drei Dimensionen des öffentlichen Rechts fehlt in Rawls’ Eine Theorie der Gerechtigkeit. Trotzdem spielt das Völkerrecht schon dort eine Rolle, allerdings nicht mehr als eine Nebenrolle, zudem eine so kleine, dass die meisten Leser es übersehen. Bei keinem der 87 Paragraphen taucht es im Titel auf, so dass, wer das Thema sucht, sehr gründlich lesen muss.
Man darf sich erinnern: Im Rahmen von Teil II von Eine Theorie der Gerechtigkeit, ihrer Theorie der „Institutionen“, dort im „Kapitel 6. Pflicht und Verpflichtung“, erörtert Rawls sehr ausführlich die etwaige Berechtigung eines staatsbürgerlichen Ungehorsams (civil disobedience) und vertritt dabei vier seines Erachtens „durchaus bekannte Grundsätze“ des Völkerrechts, dort noch als „law of nation“ bezeichnet. Rawls beginnt mit dem Gleichheitsgrundsatz: „Unabhängige Völker [peoples], die in Staaten organisiert sind, haben bestimmte gleiche Grundrechte.“ (TG, 416) Als Folgerung, zweiter Grundsatz, leitet er das Recht auf Selbstbestimmung ab, als weitere Folgerung, dritter Grundsatz, das Recht auf Selbstverteidigung und auf die Bildung von Verteidigungsbündnissen. Und zum vierten Grundsatz erklärt er die Pflicht Verträge einzuhalten, „sofern sie mit den übrigen Grundsätzen für die zwischenstaatlichen Beziehungen verträglich sind“ (ebenda).
Im Rahmen dieser prägnanten Kurzfassung des Völkerrechts geht Rawls auf die zwei klassischen Fragen einer „Kriegsethik“ ein, auf das ius ad bellum, also das Recht im Sinne einer Befugnis zum Krieg, und auf das ius in bello, auf die bei einer Kriegsführung moralisch erlaubte Verhaltensweise. Wer mit Rawls Kants Schrift Zum ewigen Frieden (1795) heranzieht, findet in Rawls’ Hinweis in zurückhaltender Weise einen Kantischen Gedanken wieder: dass die im Krieg „verwendeten Mittel nicht die Möglichkeit des Friedens zerstören“ dürfen (TG, 417). Überraschenderweise spricht der Autor beim ius in bello sogar von einem nationalen Interesse. Er begründet es aber, für einen Gerechtigkeitstheoretiker nicht mehr überraschend, für den Bürger einer Weltmacht vielleicht doch, mit folgendem Argument: In Übereinstimmung mit Gerechtigkeitsüberlegungen strebt die entsprechende Nation nicht nach der Beherrschung der Welt oder nach nationalem Ruhm, ebenso wenig nach wirtschaftlichen Vorteilen oder Gebietsgewinnen.
1.2 Ein Blick in die Geschichte
Der heute längst geläufige Ausdruck „Völkerrecht“ wird erstaunlicherweise erst im 16. Jahrhundert geprägt, damals zur Übersetzung des römischen Rechtsbegriffs ius gentium. Dieses besteht ursprünglich im alten Rom in einem allgemeinen, bei allen Völkern als gültig angesehenen Recht. Dabei steht thematisch das internationale, von nationalen und religiösen Elementen freie Handelsrecht im Vordergrund. Dieses ist rechtssystematisch gesehen kein inter-nationales Recht, sondern ein römisches, insofern „nationales“ Recht, aber zuständig für den Rechtsverkehr zwischen römischen und fremden Bürgern.
Für die weitere Geschichte des Völkerrechts empfiehlt sich ein Blick in die politische Geschichte Europas. Seit dem Spätmittelalter setzt sich hier mehr und mehr der Gedanke von Territorialstaaten durch, deren Fürsten, die Landesherren, für sich die höchste Macht, die Souveränität, beanspruchen. Deshalb werden die Rechtsbeziehungen zwischen souveränen Staaten virulent, folglich ein Völkerrecht jetzt im Sinne eines internationalen öffentlichen Rechts aktuell.
In der frühen Neuzeit erhält der Ausdruck rasch die seit dem entscheidende Bedeutung eines ius inter gentes, eines zwischen den Völkern bzw. Staaten und deren Herrschern, den Fürsten, geltenden Rechts. Um dies zu betonen, wird im Englischen seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr von „law of nation“, sondern von „international public law“ gesprochen. Ähnlich und etwa zur selben Zeit weicht im Französischen die vorher herrschende Bezeichnung „droit des gens“ dem neuen Ausdruck „droit international public“.
Obwohl also die Ausdrücke spät auftauchen, ist die Sache selbst weit älter. Ansätze oder Vorformen eines Völkerrechts gibt es, wie zu erwarten, in der Antike. Schon für das Jahr 3100 v. Chr., also für eine Zeit vor mehr als 5000 Jahren, haben Archäologen Verträge zwischen verschiedenen mesopotamischen Stadtstaaten entdeckt. Völkerrechtlichen Charakter im modernen Verständnis haben auch Verträge, die im 13. Jahrhundert v. Chr. die ägyptischen Pharaonen mit Königen der Hethiter abschlossen. Ähnliches findet sich bei den griechischen Poleis/Stadtstaaten, obwohl sie, für heute überraschend, keine für das gesamte Griechenland gemeinsame zwischen- oder überstaatlich geltende Rechtsordnung kannten. Rom wiederum schloss im Verlauf der Entwicklung seines „universalen“ Reiches, das nämlich alle damals in Rom bekannten Länder umfasste, mit den Nachbarn Verträge, die aber de facto weniger (Völker‐)Rechtscharakter hatten, denn sie waren Mittel einer gegebenenfalls vor Gewalt nicht zurückschreckenden Politik.
Da ein echtes Völkerrecht Rechtscharakter hat, legt sich nun als zuständige Disziplin die Jurisprudenz nahe. In der Tat ist das Völkerrecht seit langem eine Domäne der Juristen. Seine moderne Form wird aber zunächst von philosophisch hochgebildeten spanischen Moraltheologen wie Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria und Francisco Suárez entwickelt. Obwohl es dann mit Hugo Grotius in die Kompetenz der Juristen wandert, bleibt es wegen natur- und vernunftrechtlicher Komponenten noch lange im Einflussbereich von Philosophen, im deutschen Sprachraum beispielsweise von Christian Wolff und Immanuel Kant. In dieser Tradition eines philosophischen Völkerrechts steht Rawls’ Oxforder Amnesty-Vorlesung, die zunächst für einen Sammelband, On Human Rights (1993), überarbeitet, für die spätere Veröffentlichung aber noch einmal gründlich verändert wurde.
Im Vorwort von Eine Theorie der Gerechtigkeit berief sich Rawls auf drei Autoren, Locke, Rousseau und Kant, und gibt freilich dem dritten Autor das größte Gewicht. In seinem Völkerrecht scheint Locke gar nicht, Rousseau eher nebensächlich auf, während Kant zum alles entscheidenden Vorbild aufsteigt. Des Näheren beruft sich Rawls auf Kants bahnbrechende und bis heute systematisch aktuelle Schrift Zum ewigen Frieden (1795). Rawls erwähnt hier Kants Vorstellung eines foedus pacificum und unterstellt dabei, dass auch seine US-Leser wissen, was mit einem „Friedensvertrag“ gemeint ist. Dass Kant das Völkerrecht auch in der Rechtslehre (1796/97) erörtert, lässt Rawls außer Acht. Das schmälert nicht seine Wertschätzung des Weltbürgers aus Königsberg. Die in diesem Band kooperativ kommentierte Völkerrechtstheorie endet sogar mit einer Berufung auf Kant.
1.3 Ein Recht von Völkern, nicht von Staaten?
Ursprünglich, nicht nur in Eine Theorie der Gerechtigkeit, sondern auch in der in Oxford gehaltenen Vorlesung, nennt Rawls die für sein Thema entscheidende Bezugsgruppe „Nationen“, jetzt spricht er aber von „Völkern“ (peoples). Als Grund für den Wechsel der Bezeichnung gibt der Autor zunächst an, nur Völker, aber nicht Staaten seien Akteure, denen man eine moralische Motivation, nämlich „eine innere Bindung an die Grundsätze des Rechts der Völker“, zuschreiben könne (§ 1.3, 19 f.) An diesen Argumenten ist bemerkenswert, dass Rawls sich nicht gegen den von ihm zuvor verwendeten Ausdruck „Nation“, sondern „Staat“ absetzt, so dass der Wechsel des Leitausdrucks nicht ganz verständlich wird. Auch Nationen darf man wohl moralische Motivationen in Rawls’ Verständnis zusprechen.
Überzeugender ist erst Rawls’ zweites Argument, das später hinzukommt: Völker sind – erneut im Unterschied zu Staaten – nicht im herkömmlichen Sinn souverän (§ 2.2, 28), was für Rawls’ Völkerrechtstheorie wichtig sein wird.
Der Autor gliedert seine knappe Schrift in vier ungleich umfangreiche Teile bzw. Kapitel. I: Der erste Teil der Idealtheorie (schöner wäre freilich: der idealen Theorie), II: Der zweite Teil der idealen Theorie, III: Nichtideale Theorie, IV: Abschluss.
Diesen Kapiteln geht eine informative „Einleitung“ voran. Am Ende steht ein wieder umfangreiches „Nochmals“-Kapitel. Dieses behandelt einen Begriff, die Idee der öffentlichen Vernunft (The Idea of Public Reason), der in Eine Theorie der Gerechtigkeit fehlt, denn dort ist nur, allerdings häufiger, von Öffentlichkeit (publicity) die Rede. Für Rawls’ Überarbeitung seiner ursprünglichen Gerechtigkeitstheorie zu einer Theorie eines politischen Liberalismus (Politischer Liberalismus 1998, englisches Original 1993), einer „modernen konstitutionellen Demokratie“, wie er selbst sagt, ist nämlich die genannte Idee wesentlich. Da der Autor sein Völkerrecht auf der Grundlage dieser überarbeiteten Gerechtigkeitstheorie entwickelt, ist es gut vertretbar, sein damals neuestes Verständnis einer Idee der öffentlichen Vernunft hier vorzulegen.
1.4 Eine realistische Utopie
Rawls’ Grundfrage lautet: Unter welchen Bedingungen kann das Zusammenleben von Völkern friedlich bleiben und als gerecht gelten? Das schließt die immer wieder aktuelle Frage ein, unter welchen Umständen Kriege gerechtfertigt sein können. Die Antwort bezeichnet Rawls als eine „realistische Utopie“. Mit ihr will er nach eigener Erläuterung im Unterschied zu einer Abhandlung über das internationale Recht oder einem Lehrbuch zu diesem Thema „die Grenzen dessen, was wir gewöhnlich für praktisch-politisch halten“, ausdehnen. Dieser von Rawls als „utopisch“ qualifizierte Gesichtspunkt wird jedoch „realistisch“ ausgearbeitet, weil er kein politisches Schlaraffenland entwirft, vielmehr „eine realisierbare soziale Welt beschreibt“. Nun bedeutet „Utopia“ wörtlich ein „Nirgendland“, weshalb man, um entsprechende Vorbehalte erst gar nicht aufkommen zu lassen, den Ausdruck „Vision“ vorziehen und dann von einer „realistischen Vision“ sprechen könnte. Die Wortwahl ist aber nicht entscheidend, sondern die gemeinte Sache.
Laut Rawls zeichnet sich der utopische Charakter in einem Gemeinwesen durch drei Grundsätze vernünftiger liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen, aus. Erstens gibt es die aus konstitutionellen Gemeinwesen, also Rechts- und Verfassungsstaaten, bekannten Grundrechte und Freiheiten. Zweitens haben diese, ergänzt um Lebenschancen, einen Vorrang gegenüber dem Gemeinwohl und gegenüber perfektionistischen Werten. Schließlich sind allen Bürgern die für den Gebrauch ihrer Freiheit notwendigen Grundgüter zu garantieren.
Für die Beziehung zwischen Völkern stellt Rawls acht zu beachtende Grundsätze auf und beginnt – er bleibt in seinen Originalitätsansprüchen wie immer bescheiden – mit (1) der Freiheit und Unabhängigkeit der Völker, schließt (2) die Pflicht, Verträge einzuhalten und (3) die Gleichheit und das Partizipationsrecht der Völker an. Es folgen die politisch hochbrisante (4) Pflicht der Nichteinmischung, das selten strittige (5) Recht auf Selbstverteidigung und die wieder nicht allseits anerkannte (6) Pflicht, die Menschenrechte anzuerkennen. Die Liste schließt mit der (7) Pflicht, im Falle einer Kriegsführung bestimmte Einschränkungen zu beachten, und einer von Rawls selber als umstritten eingeschätzten (8) Pflicht, Völkern, die unter gewissen ungünstigen Bedingungen leben zu helfen.
1.5 Völkerrechtliche Toleranz
Weil das Recht der Völker von deren politischer Grundstruktur abhängen könnte, führt Rawls eine Unterscheidung verschiedener Arten von Gesellschaften ein. An deren gerechtigkeitstheoretischen Spitze stehen die liberalen Gesellschaften, für die folgende Merkmale charakteristisch sind: (1) Institutionell kommt es auf eine konstitutionelle Demokratie, (2) in aktueller Hinsicht, damit gegen die Reduktion der staatlichen Gemeinsamkeiten auf einen Verfassungspatriotismus, auf „geteilte Zuneigungen“ und (3) moralisch, genauer, rechtsmoralisch betrachtet auf die feste Bindung an Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellungen an.
An normativ zweiter Stelle stehen die zwar nichtliberalen, aber achtbaren Völker, da „sie gewisse Bedingungen des politisch Rechten und Gerechten erfüllen und für das Zusammenleben der Völker ein gerechtes Recht achten“ (§ 7.1, 71 f.). Zusammen bilden die liberalen und nichtliberalen Völker die wohlgeordneten Völker. Ihnen stehen all die Staaten gegenüber, die sich einem vernünftigen Recht der Völker verweigern, also „Schurkenstaaten“, die im englischen Original aber nicht „rogue states“, sondern „outlaw regimes“, zu ächtende Regime, heißen. Auf der Grundlage dieser Unterscheidung führt Rawls zwei „Urzustände“ (original positions) ein, zusätzlich zu dem aus Eine Theorie der Gerechtigkeit bekannten Urzustand, in dem unter einem Schleier des Nichtwissens die Gerechtigkeitsprinzipien für ein einzelnes Gemeinwesen gewählt werden, einen zweiten Urzustand, in dem über die Prinzipien der internationalen Beziehungen entschieden wird.
Vor diesem Hintergrund weitet Rawls in drei Argumentationsschritten seine Vertragstheorie auf das Zusammenleben von Völkern aus. Im „Ersten Teil der idealen Theorie“ geht er von liberalen demokratischen Völkern aus und nimmt plausiblerweise als deren Grundinteressen an: die politische Unabhängigkeit, den Schutz der eigenen politischen Kultur, die territoriale Integrität, den Wohlstand der Bürger und die angemessene Selbstachtung. Der „zweite Teil der idealen Theorie“ weitet die Vertragstheorie auf achtbare Völker aus. Er schreibt diesen aber nicht liberale Gerechtigkeitsgrundsätze vor, sondern erkennt in einer neuen Art einer „völkerrechtlichen“ Toleranz auch nichtliberale Völker als gleichberechtigte Mitglieder einer internationalen Gemeinschaft an.
1.6 Gerechte Kriege?
Als wahrhaft politischer Denker scheut sich Rawls nicht vor politisch relevanten Erörterungen, die er als Philosoph zwar ziemlich grundsätzlich vornimmt, die aber in aktuelle, sogar tagespolitisch relevante Fragen hineinragen. Rawls wendet sich ihnen im dritten Teil, der „nichtidealen Theorie“, zu, bei der es auf den gerechten Krieg, auf „belastete“ Gesellschaften und auf die Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Völkern ankommt.
Gegen einen sich selbst vergessenen Pazifismus betont Rawls ein Recht auf Krieg, dies allerdings nur zur Selbstverteidigung. Im Fall liberaler Gesellschaften zählt hierzu die Verteidigung liberaler demokratischer Institutionen und der vielen religiösen und nichtreligiösen Traditionen und Lebensformen der bürgerlichen Gesellschaft. Wer sich noch an die heftigen Debatten der 1960er und 1970er Jahre erinnert, findet hier Argumente gegen die damals prominent vertretene These, die sich gegen eine verteidigungspolitisch erlaubte, vielleicht sogar gebotene Zusatzrüstung wandte, stattdessen unter dem Motto „lieber rot als tot“ eine eventuelle Unterwerfung Deutschlands durch die Sowjetunion hinzunehmen bereit war.
Dass Rawls unter seine These, das Recht auf Selbstverteidigung, eine Vorwärts-Verteidigung subsumieren, al...