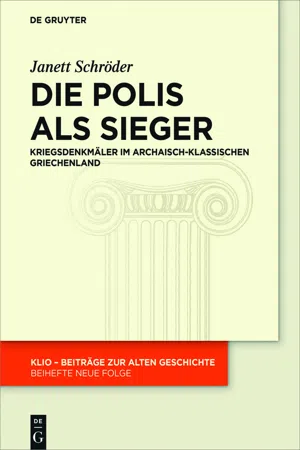
eBook - ePub
Die Polis als Sieger
Kriegsdenkmäler im archaisch-klassischen Griechenland
- 352 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Der Band bietet die erste systematische und im Ansatz interdisziplinäre Analyse zu Phänomenen der Kriegserinnerung in archaisch-klassischer Zeit. Anhand der Entwicklung von Denkmälertraditionen werden die Wechselbeziehungen zwischen Kriegskommemoration, kollektiven Identitäten und der Geschichte der Stadtstaaten aufgezeigt. Damit leistet die Untersuchung unter anderem einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der griechischen Polisgemeinschaften.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Polis als Sieger von Janett Schröder im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Altertum. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Einführung
οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς ἐν Πλαταιῇσι τὴν ληίην διείλοντο, ἔϑαπτον τοὺς ἑωυτῶν χωρὶς ἕϰαστοι. [. . .] τούτων μὲν δὴ πάντων πλήρεες ἐγένοντο οἱ τάφοι· τῶν δὲ ἄλλων ὅσοισι ϰαὶ φαίνονται ἐν Πλαταιῇσι ἐόντες τάφοι, τούτους δὲ, ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι, ἐπαισχυνομένους τῇ ἀπεστοῖ τῆς μάχης ἐκάστους χώματα χῶσαι ϰεινὰ τῶν ἐπιγινομένων εἵνεκεν ἀνϑρώπων, ἐπεὶ ϰαὶ Αἰγινητέων ἐστὶ αὐτόϑι ϰαλεόμενος τάφος, τὸν ἐγὼ ἀϰούω ϰαὶ δέκα ἔτεσι ὕστερον μετὰ ταῦτα δεηϑέντων τῶν Αἰγινητέων χῶσαι Kλεάδην τὸν Αὐτοδίϰου ἄνδρα Πλαταιέα, πρόξεινον ἐόντα αὐτῶν.
Nach der Teilung der Beute bei Plataiai bestatteten auch die Griechen ihre Toten, jede Stadt für sich. [. . .] Dieser aller Gräber wurden voll. Wie ich erfahren habe, haben die andern, soweit ihre Gräber in Plataiai zu sehen sind, der Nachwelt wegen aus Scham über ihre Abwesenheit in der Schlacht leere Grabhügel aufschütten lassen; denn es gibt dort auch ein sogenanntes Grab der Aigineten, das – wie man mir erzählt hat – Kleades aus Plataiai, der Sohn des Autodikos, erst zehn Jahre nach diesen Ereignissen auf Bitten der Aigineten aufgeschüttet hat, weil er ihr Gastfreund war.
(Hdt. 9, 85, 1–3; Übers. Feix 1963.)
Das Bedürfnis zur Errichtung von Kriegsdenkmälern ist mit Blick auf moderne ebenso wie auf antike Kulturen zunächst kaum erklärungsbedürftig. Militärisch errungene Siege sind – wie auch die damit verknüpften territorialen, politischen oder wirtschaftlichen Auswirkungen – vergänglich. Jedem Sieger muss es daher ein Anliegen sein, den Ausgang des Krieges zu dokumentieren und möglichst dauerhafte Erinnerungen an dieses Ereignis zu schaffen. Genauso wie in der Moderne konnte man in der Antike deswegen kaum eine Stadt, einen Kultort oder ein ehemaliges Schlachtfeld durchqueren ohne mit Kriegserinnerungen in Form vom Denkmälern konfrontiert zu werden. Doch damals wie heute ging das Interesse der Denkmalstifter weit über die bloße Aufzeichnung des Schlachtausgangs hinaus. Besonders gut veranschaulicht wird dieser Umstand durch die – zunächst kurios anmutende – Episode aus der Zeit der Perserkriege. Demnach haben die Bewohner der Insel Aigina auf dem Schlachtfeld von Plataiai ein Monument errichten lassen, obwohl sie an der hier ausgetragenen Schlacht gegen die Perser nicht einmal beteiligt waren – ein Umstand, der bereits im 5. Jh.1 bei dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot für Erstaunen sorgte.
Was hat die Bewohner des Inselstaates Aigina dazu bewogen, mit zehn Jahren Abstand die Errichtung eines Grabdenkmals zu initiieren, für das es keine Toten gab? Herodot selbst sagt, es sei die Scham (ἐπαισχυνομένοι) über die Nichtteilnahme an der Schlacht. Und tatsächlich hat der vereinte Kampf der griechischen Städte gegen das Invasionsheer des persischen Großkönigs Xerxes in Hellas ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufkommen lassen – so stark, dass Stadtstaaten, welche sich im Krieg perserfreundlich oder neutral verhalten hatten, nun innerhalb der griechischen Welt ausgegrenzt und bestraft wurden.2 Die Tatsache, dass offenbar auch Aigina dieses Los getroffen hat, beweist, wie selektiv die Erinnerungsmechanismen nach dem Krieg wirkten und wie wenig innerhalb der vermeintlichen „Perserfreunde“ differenziert wurde.3 Die Bewohner der kleinen, mittelgriechischen Insel hatten sich bereits einige Monate zuvor mit dem immerhin drittgrößten griechischen Flottenkontingent von 30 Schiffen in Salamis am Krieg gegen die Perser beteiligt. Ihre Truppen hatten sich in dieser Seeschlacht derart verdienstvoll geschlagen, dass sie als die Tapfersten aller Griechen ausgezeichnet wurden und das Recht erhielten, in Delphi ein wertvolles Denkmal aus Gold und Bronze zu stiften.4 In Plataiai jedoch litt das Heer der Hellenen tagelang unter Angriffen der persischen Reiterei sowie unter sich zuspitzenden Versorgungsengpässen. Die 500 aiginetischen Hopliten zogen sich daher – zusammen mit den Kontingenten vieler anderer griechischer Städte – bereits vor dem Beginn der entscheidenden Kampfhandlungen vom Schlachtfeld zurück.5 Den verbleibenden Verbänden gelang es, unter der Führung Spartas die Perser zu schlagen und deren westliche Expansionsbestrebungen vorerst abzuwehren. Die in der Schlacht gefallenen Hopliten wurden feierlich auf dem Schlachtfeld beigesetzt und die Grabdenkmäler manifestierten in der Folgezeit die Beteiligung der entsprechenden Stadtstaaten an der Rettung Griechenlands. Die Aigineten büßten mit der Entscheidung, nicht an der Schlacht teilzunehmen, möglicherweise ihren zuvor erworbenen Ruhm zusammen mit der Akzeptanz innerhalb der griechischen Staatenwelt ein. Ob und inwiefern ihnen daraus konkrete Nachteile erwuchsen, können wir heute nicht mehr ermessen. Aber der Aufwand, nachträglich ein Monument auf dem Schlachtfeld zu errichten, muss in ihren Augen gerechtfertigt gewesen sein. Sie versuchten auf diese Weise, die Geschichte neu zu schreiben und sich einen besseren Platz in der Erinnerung der griechischen Staatenwelt zu verschaffen.
Die Kriegsdenkmäler der klassischen Epoche sind also keine bloße Geschichtsdokumentation, sondern die Manifestation eines kollektiven Gedächtnisses und vermögen als solche Zugehörigkeit, Identität und Legitimation zu verschaffen. Die in Kriegsgräbern, Siegesmalen, Kulten und Beutedenkmälern manifestierte Erinnerung an vergangene Kriege nimmt eine zentrale Rolle im Geschichts- und Gegenwartsverständnis der griechischen Stadtstaaten ein. Das Ziel der folgenden Arbeit ist es, zu klären, wie Kriegserinnerung mithilfe von Denkmälern in kollektive Identität transformiert werden kann. Außerdem ist zu fragen, welches Selbstbild die klassischen Stadtstaaten von sich und von ihrer Stellung innerhalb der griechischen Staatenwelt in den Monumenten evozieren und welche Rolle dabei der Kommemoration von Kriegsereignissen zukommt. Auf diese Weise soll aufgezeigt werden, welche Abhängigkeiten zwischen der Geschichte der Poleis und ihren Kriegsdenkmälern bzw. zwischen den Denkmälern und der Ausbildung gemeinschaftlicher Identitäten bestehen. Um die Fragestellung präzisieren zu können, wird im folgenden Abschnitt zunächst der aktuelle Kenntnisstand zur Funktion und Funktionsweise des kollektiven Gedächtnisses skizziert.
Vorüberlegungen
Den engen Zusammenhang von Gruppenidentitäten und kollektiven Erinnerungen hat zuerst der französische Soziologe Maurice Halbwachs in den 1920er Jahren beschrieben.6 Weder Erinnerungen noch Gedächtnisse existieren – so seine zentrale These – ohne sozial bedingte Vorgaben der Gegenwart. Da Menschen nicht in der Lage sind, historisches Wissen bzw. historische Ereignisse in ihrem persönlichen Gedächtnis auf authentische Weise zu archivieren, muss Geschichte bei der Vergegenwärtigung – unter Hinzuziehung gesellschaftlich vorgegebener Prämissen – immer wieder neu rekonstruiert werden.7 Die von Halbwachs postulierten cadres sociaux für das Erinnern sind Sprache, Zeit, Raum und Erfahrung.8 Diese Bedingungen bilden ein dynamisches System, welches durch die Verarbeitung neuer Eindrücke ständigen Modifikationen, Aktualisierungen und Selektionen unterworfen ist.9 Menschen mit vergleichbaren Bezugssystemen teilen ihre Geschichtsbilder demnach in Form eines kollektiven Gedächtnisses, welches die Summe der gemeinsamen Erinnerungen beinhaltet. Die wichtigste Funktion dieser gemeinsamen Erinnerungen ist die Imagination einer Kontinuität, welche das Bedürfnis der Gruppe nach sozialer Stabilität und Zugehörigkeit erfüllen kann.10 Halbwachs’ Konzept des kollektiven Gedächtnisses hat der Heidelberger Ägyptologe Jan Assmann in den 1980er Jahren übernommen und weiterentwickelt.11 Er betrachtet das Phänomen zunächst in Abgrenzung von einem kommunikativen Gedächtnis, welches Erinnerungen an diejenigen Ereignisse umfasst, welche der Träger entweder selbst erlebt oder im Austausch mit Zeitgenossen erfahren hat. Die entsprechenden Informationen können einen Zeitraum von 3–4 Generationen (80–100 Jahren) umfassen und vergehen mit dem Tod ihres Trägers.12 Der zweite „Modus“ des Erinnerns dagegen – das kulturelle Gedächtnis – kann Informationen über einen wesentlich längeren Zeitraum bewahren, ist dafür aber auf künstliche Hilfsmittel, wie Denkmäler, angewiesen.13 Um die Überlieferung der Erinnerungen über den Tod ihres Trägers hinaus zu gewährleisten, bedarf es nicht nur der externen Zwischenspeicherung, sondern auch eines komplexen Systems von „Auslagerung, Speicherung und Wiedereinschaltung“.14
Wie funktioniert das kulturelle Gedächtnis? Wenn Erinnerungen vom biologischen Gedächtnis des Einzelnen in externe Medien ausgelagert werden, müssen sie notwendigerweise verkürzt und abstrahiert werden. Darüber hinaus werden die konkreten historischen Fakten in das Ideensystem der Gesellschaft eingebunden und dadurch mit kulturellem Sinn versehen. Diese Form des symbolisch angereicherten Vergangenheitswissens bezeichnet Assmann als Erinnerungsfigur. Der Begriff findet Parallelen im Konzept der lieux de mémoire des französischen Historikers Pierre Nora, welcher damit bestimmten Erinnerungen eine symbolische und identitätsstiftende Bedeutung für die Gesellschaft zuschreibt.15 Als Grundelemente des kollektiven Gedächtnisses haben Erinnerungsfiguren spezifische Eigenschaften, die weitgehend mit den Bezugsrahmen von Halbwachs übereinstimmen: sie sind rekonstruktiv, sie lagern sich an konkrete zeitliche (Jahrestage) oder räumliche Fixpunkte (Schauplätze, Monumente) an und sie sind auf Träger angewiesen, die ihren symbolischen Gehalt lesen und sich damit identifizieren können.16 Begründet eine soziale Gruppe ihr Selbstverständnis auf den gleichen Erinnerungsfiguren, spricht man von einer Gedächtnis- oder Erinnerungsgemeinschaft.17 Bei der Definition einer kollektiven Identität über gemeinsame Erinnerungen – in der Regel an den (mythischen) Ursprung der Gruppe – stehen immer zwei Aspekte im Vordergrund: die Abgrenzung der Gemeinschaft nach außen und die innere Absicherung durch vermeintliche Kontinuitäten aus der Vergangenheit.18
Das so gewonnene Bewusstsein der Eigenart ist eine fundierende und normative Kraft, die der Gruppe neben der Selbstvergewisserung in der Gegenwart auch das Planen und Hoffen für die Zukunft ermöglicht.19 Reinhard Koselleck beschreibt diesen Zusammenhang mit den treffenden Begriffen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont.20 So werden bei der Vergegenwärtigung von kollektiven Erinnerungen in der Regel Kontinuitäten konstruiert, mit deren Hilfe aus vergangenen Erfahrungen handlungsleitende Prinzipien für die Zukunft abgleitet werden. Gefallenendenkmäler zielen etwa auf die politische Meinungsbildung ab, indem sie den Betrachter dazu aufrufen, sich mit dem von ihnen vorgegebenen Sinn des gewaltsamen Todes zu identifizieren.21 Im Namen der Toten wird dem Rezipienten des Denkmals dabei die Verpflichtung auferlegt, im gleichen Sinne zu handeln und in der Zukunft zur Erfüllung der daraus abgeleiteten Erwartungen beizutragen. Politische Akteure können auf diese Weise wirkungsvoll zum Einsatz für die innere und äußere Behauptung derjenigen Gedächtnisgemeinschaft vereinnahmt werden, die sich in die Tradition der Kriegstoten stellt und die Errichtung der Denkmäler unternimmt.
In größeren ethnopolitischen Gebilden dient die kollektive Erinnerung darüber hinaus auch der Stabilisierung politischer Strukturen und der Integration heterogener Träger. Je umfangreicher die zu beherrschende Gruppe, so Assmann, desto monumentaler fällt die Formensprache des kulturellen Gedächtnisses aus.22 In diesem Sinn sind kollektive Erinnerungen natürlich offen für die Eingriffe politischer Akteure, insofern sie neue Erinnerungsfiguren implementieren und deren Kontinuität in die Vergangenheit konstruieren können. Hobsbawm bezeichnet diese Praktiken als invented traditions.23
Wie werden Informationen im kollektiven Gedächtnis aufbewahrt und reaktiviert? Zur Speicherung der Erinnerungsfiguren dienen feste Objektivationen, wie Rituale, Tänze, Mythen, Kleidung und andere Zeichensysteme, die artifiziell geschaffen werden müssen. Darüber hinaus bedürfen die Medien der kollektiven Erinnerung der Einrichtung und Pflege durch Spezialisten, die laut Assmann dem Alltag der sozialen Gruppe enthoben sind. Ihnen obliegt auch die Kontrolle über die Partizipation am Gedächtnis, insofern sie die Teilhabe (durch Institutionalisierung) erzwingen oder aber Außenstehenden verwehren können.24 Als Mittel zur Vergegenwärtigung (Abrufung) kollektiver Erinnerungen betrachtet Assmann in erster Linie Riten und Feste. Bei rituellen Inszenierungen kann das identitätssichernde Wissen beliebig oft vor einem großen Publikum reproduziert und weiter vermittelt werden. Die einzigen Voraussetzungen dafür sind die persönliche Anwesenheit der Träger und die regelmäßige Wiederholung.25 Dieser rituellen Kohärenz entgegen setzt Assmann die textuelle Kohärenz. Der kulturelle Sinn wird hier nicht durch Objektivationen tradiert, sondern in Texten, die aufgrund ihrer Bedeutung kanonischen Rang erreichen und durch institutionalisierte Rezeption die formativen und normativen Werte der Erinnerungsgemeinschaft reproduzieren können.26
Denkmäler wie der Grabhügel der Aigineten in Plataiai entsprechen nicht den von Assmann beschriebenen Kategorien ritueller und textueller Kohärenz. Sie bilden vielmehr eine dritte Gruppe von Speichern, welche kollektive Erinnerungen in erster Linie durch ihre Materialität und Präsenz verbürgen. Im Gegensatz zu den anderen Medien der Erinnerung sind sie im öffentlichen Raum uneingeschränkt verfügbar, omnipräsent und werden aufgrund ihrer physischen Eigenschaften von allen Passanten bewusst oder unbewusst wahrgenommen. Ihre Eigenschaften ließen sich daher am ehesten mit einer zusätzlichen Kategorie der materiellen Kohärenz beschreiben. Als Ausformung des kulturellen Gedächtnisses haben Denkmäler eine weitere Besonderheit: sie bieten die Möglichkeit, Erinnerungen an historische Ereignisse mit deren Schauplätzen zu verbinden und dadurch weiter zu beglaubigen. Denn Orte können Geschichtsbilder nicht nur lokal fixieren, sondern sie sind darüber hinaus auch dauerhafter als alle anderen artifiziell geschaffenen Speicher kultureller Erinnerung.27 Da die Vergangenheit für den Menschen in dieser Form nicht nur nachhaltig beglaubigt, sondern auch erlebbar ist, neigt das kollektive Gedächtnis zur Verräumlichung und Materialisierung.28 Diese Form der Archivierung kultureller Erinnerungen mag, insbesondere in agrarischen Gesellschaften wie dem antiken Griechenland, besonders einflussreich sein.29 Die Betrachtung von Monumenten un...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Widmung
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Politisierung der Erinnerung
- 3 Die Selbstvergewisserung der Bürgerschaft
- 4 Die Monumentalisierung des Sieges
- 5 Zusammenfassung
- 6 Exkurs: Klassische Kriegsdenkmäler bei Pausanias
- Abkürzungsverzeichnis
- Bibliographie
- Sach-, Orts- und Personenregister