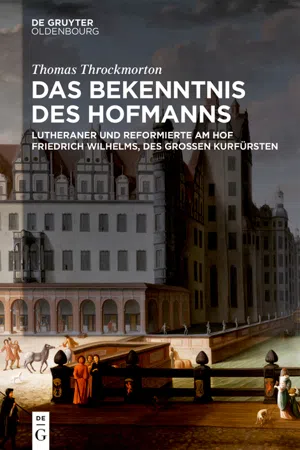1.1 Auftakt: Andreas Fromm
Im Frühjahr 1668 befand sich ein lutherischer Geistlicher namens Andreas Fromm mit seiner Familie auf der Flucht.1 Sein Ziel war Prag und seine Kontaktperson vor Ort ein Jesuitenpater namens Matthäus Zeidler. Noch während der Reise schrieb Fromm ihm einen Brief über seine künftigen Pläne und gab ihm obendrein Einblicke in sein Eheleben: „Gerne wollte Ich beym Predigampt [!] bleiben […] Meine Ehe-Frau […] wird zur stätigen Enthaltung des Ehelichen Werckes gar leicht zu bereden seyn/ sintemalen wir schon etliche Jahr her nicht in einem Bette zusammen gelegen/ sondern haben uns die Keuschheit zu lernen geübet.“2 Seine eheliche „Keuschheit“ betonte Fromm gegenüber dem Pater nicht ohne Grund: Er bereitete seine Konversion zum Katholizismus und seine Priesterweihe vor. Es war nicht der erste religiöse Sinneswandel des angehenden Priesters.
Der 1621 in Plänitz in der Grafschaft Ruppin geborene Predigersohn war ursprünglich lutherisch getauft. Nach einer Zwischenstation in Stettin, wo er eines der frühesten deutschen Oratorien geschrieben hatte,3 erwarb er 1651 den Grad eines Licentiatus Theologicae und wurde im selben Jahr Probst in der Kirche St. Petri zu Cölln an der Spree. Ende 1656 wurde er als geistlicher lutherischer Konsistorialrat bestallt. Damit gelangte er an den mehrheitlich reformiert geprägten Hof Friedrich Wilhelms, des Großen Kurfürsten – und schon bald machten sich erste religiöse Auffälligkeiten bemerkbar. 1658 wurde Fromm vom Präsidenten des Konsistoriums Joachim Kemnitz vorgeworfen, ein Kryptocalvinist zu sein. Ein Jahr später wurde Kemnitz entlassen. 1662 gestand Fromm dem reformierten Hofprediger Bartholomäus Stosch, dass er längst im Inneren „Reformatae Religionis sey“4 und sich nur nach außen als Lutheraner ausgebe. 1666 sagte er dann zu demselben Stosch in einem Gefühlsausbruch, „er könne nicht länger stille darzu schweigen […] Lutherani leiden hostilitäten von Reformirten.“5 Nun bekannte er sich klar zum lutherischen Glauben und floh nach Wittenberg, dem Bollwerk des traditionellen Luthertums.6 1669 dann hielt er schließlich seine erste heilige Messe als Priester in Prag.7 In den 13 Jahren von seinem Stellenantritt bei Hofe als Konsistorialrat bis zu seiner ersten Messe hatte Fromm es also geschafft, vom Luthertum zum Kryptocalvinismus, von dort zurück zum Luthertum und schließlich in den Schoß der katholischen Kirche zu flüchten.8
Wie konnte es zu diesem wendungsvollen Werdegang kommen? Ohne die Besonderheiten in Fromms Biographie kleinreden zu wollen, war er keineswegs der Einzige am kurbrandenburgischen Hofe in konfessionellen Nöten. Zwischen 1659 und 1668 kam es zu einer weiteren Flucht inklusive Konversion sowie insgesamt zu fünf weiteren Entlassungen von Hofbeamten, die religiös motiviert waren. All diese Fälle werfen die Frage auf: Was war das für ein Hof, der eine solche Entwicklung begünstigte? Die Antwort darauf möchte dieses Buch geben.
1.2 Fragestellung und Eingrenzungen
Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst und der Dienstherr Andreas Fromms, war reformiert, so wie es alle Hohenzollern waren seit der Konversion Johann Sigismunds an Weihnachten 1613. In ganz Brandenburg-Preußen stellten die Reformierten jedoch eine sehr kleine Minderheit dar. Die Mark Brandenburg war sogar fast vollständig monokonfessionell lutherisch. Eine der wenigen reformierten Inseln war der Fürstenhof in Berlin-Cölln. Hier stellten die Reformierten die Mehrheit, wobei noch immer ca. ein Drittel der höheren Hofbeamten Lutheraner waren.9
Die Kirchenpolitik des Kurfürsten, die in den 1660er Jahren zu Konflikten mit der lutherischen Geistlichkeit führte, die man heute unter dem Begriff Märkischer oder Berliner Kirchenstreit zusammenfasst, ist schon vielfach untersucht worden.10 Obwohl in eben jene Zeit alle konfessionell bedingten Entlassungen und Fluchten bei Hofe fallen, wurden die Hofleute als Betroffene und Akteure in den Konflikten in der Forschung bisher jedoch kaum berücksichtigt.11 Darüber hinaus weiß man auch grundsätzlich wenig über die Koexistenz und das Zusammenwirken der Konfessionen bei Hofe. Seit der umfassenden prosopographischen Studie Peter Bahls zur höheren Beamtenschaft am Hof des Großen Kurfürsten aus dem Jahr 2001 ist zwar die konfessionelle Aufteilung des Hofes bekannt.12 Die Aussagekraft dieser quantitativen Daten stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn man darüber hinaus nach der Wahrnehmung und dem konkreten Verhalten der Höflinge fragt.13 In der aktuellen Forschung fehlt also noch eine akteursorientierte Untersuchung des Hofes, die sich vor allem auf qualitative Methoden stützt.14 An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Sie möchte die bisherige Forschung zur Kirchenpolitik des Großen Kurfürsten um die Perspektive der Hofleute erweitern, versteht sich aber zugleich als ein Beitrag zur allgemeinen Geschichte des kurbrandenburgischen Hofes. Ferner dient sie ganz grundsätzlich der Erforschung von konfessioneller Pluralität in einem höfischen Bezugsrahmen im 17. Jahrhundert. Das Ziel dieser Arbeit ist es also, die Bedeutung konfessioneller Unterschiede bei Hofe, ihren Einfluss auf die Beziehungen der Hofleute und das interkonfessionelle Miteinander sowie die Haltung der Hofbeamten zur Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms zu untersuchen. Damit verbunden sind einige Prämissen und Einschränkungen, die im Folgenden kurz angesprochen werden sollen.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Betrachtung einzelner Hofleute. Besonders vier von ihnen werden uns für einen großen Teil der Untersuchung begleiten: Dies sind der schon erwähnte Lutheraner und Konsistorialrat Andreas Fromm, der ebenfalls lutherische Konsistorial- und Kammergerichtsrat Martin Friedrich Seidel, der lutherische Amtskammerpräsident und Oberhofmarschall Raban von Canstein sowie der reformierte Oberpräsident Otto von Schwerin.15 Wie durch ein Vergrößerungsglas sollen Fromms, Seidels, Cansteins und Schwerins konfessionelle Verortung, ihr Umgang mit der jeweils anderen Konfession, ihre konfessionell begründeten Konflikte sowie ihre Handlungsspielräume und Bewältigungsstrategien im Umgang mit diesen Konflikten sichtbar gemacht werden. Anhand dieser vergleichsweise gut dokumentierten Einzelfälle werden allgemeine Rückschlüsse auf die Bedeutung, die Probleme und die Regulierung der Bikonfessionalität am Hof Friedrich Wilhelms gezogen.
Die Arbeit steht in ihrem Ansatz also in der Tradition der Mikrogeschichte und bedient sich ihrer Methoden, indem sie einzelne Akteure und ihre Handlungsmöglichkeiten ins Zentrum des Interesses stellt, mit dem Anspruch einer konsequenten sozialen Kontextualisierung und einer möglichst umfassenden Quellenauswertung.16 Die für die Mikrogeschichte typische Verkleinerung des Untersuchungsbereichs in Hinblick auf übergeordnete Zusammenhänge erfolgt insofern, als dass die Bewältigung multikonfessioneller Konstellationen in einem höfischen Kosmos untersucht wird: Das große Feld der konfessionellen Pluralität wird in ihrer Manifestation bei Hofe am Beispiel von vier Hofbeamten untersucht, die in ihrem individuellen Verhalten wiederum die Diskurse und Konflikte ihrer Zeit repräsentieren und somit über sich selbst hinausweisen. Auch werden die Auswirkungen eines kurzen, aber prägenden Abschnitts der Brandenburgischen Kirchengeschichte auf der Hofebene beleuchtet. Von den Einzelfällen, die in dieser Arbeit untersucht werden, wird wiederum auf eine größere Gruppe von Fürstendienern und allgemeine konfessionelle Herausforderungen bei Hofe geschlossen.
Während Andreas Fromm anhand einer dichten Überlieferung über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt werden kann, erfolgt der Zugriff auf seine Kollegen aufgrund der Quellenlage zwangsläufig weniger umfassend. Aus der Überlieferung ergibt sich hier ein Schwerpunkt, der auf einzelne Phasen und Ereignisse sowie die Interaktion und Kommunikation der Höflinge in unterschiedlichen Kontexten zugeschnitten ist. Dadurch stehen die sozialen Positionen der Fürstendiener und damit verbundene Rollenerwartungen im Vordergrund. Vereinzelt – vor allem im Fall von Andreas Fromm – erlauben die Quellen aber auch einen Einblick in die Wahrnehmungshorizonte der Hofbeamten, sodass ausschnitthaft die Gefühls- und Gedankenwelt vormoderner Hofleute in Bezug auf die gemischt-konfessionelle Konstellation greifbar wird.
Die Einschränkungen des zu untersuchenden Personenkreises hat zwei Gründe: Erstens erzwingt der oben formulierte Anspruch einer quellengesättigten, akteursorientierten Analyse von vorneherein eine Begrenzung, da das auszuwertende Material sonst kaum zu bewältigen wäre. Zweitens existiert über die vier genannten Protagonisten hinaus zu den kurbrandenburgischen Hofleuten unter Friedrich Wilhelm schlichtweg wenig Material in Bezug auf den formulierten bikonfessionellen Interessenschwerpunkt. Selbst die wenigen Hofbeamten, von denen überhaupt Nachlässe erhalten sind, haben meist keine schriftlichen Zeugnisse mit konfessionellem Bezug hinterlassen. Dennoch existieren immerhin einige Quellen zu weiteren Hofleuten, sodass die Protagonisten von einem kleinen Ensemble ihrer Kollegen begleitet werden, deren Namen unterschiedlich häufig wiederkehren werden. Mit ihren Beispielen werden die Geschichten der vier Hauptfiguren angereichert, um ihren Einzelfällen eine größere allgemeine Aussagekraft zu verleihen. Zudem stützt sich diese Arbeit auf die schon erwähnte prosopographische Studie Peter Bahls, durch welche die Konfession, die Herkunft, die Heiratsverbindungen und zahlreiche weitere Details der höfischen Elite bereits bekannt sind.17 Diese Daten werden in Beziehung zu den individuellen Fallbeispielen der oben genannten Protagonisten gesetzt. Ihr Verhältnis ist dabei wechselseitig: Einerseits lassen sich die Beobachtungen durch die prosopographischen Informationen leichter einordnen, andererseits füllen sie die Daten erst mit Leben und kreieren dadurch ein genaueres Bild vom Hofe. Damit fußt diese Arbeit zwar in Teilen auf quantitativem Material, will aber dezidiert darüber hinausgehen, indem nach konkreten Verhaltensstrategien, der Interaktion und der Wahrnehmung der Hofleute gefragt wird. Das wird deshalb betont, weil die Bikonfessionalität am Hof des Großen Kurfürsten in der Vergangenheit meist nur in Form von Heiratskreisen und politischen Hofparteiungen behandelt und – wenn überhaupt – durch wenige bekannte Fallbeispiele ergänzt wurde.18 Solche Ansätze eröffnen jedoch nur eine eingeschränkte Perspektive auf die tatsächlichen interkonfessionellen Realitäten, denn nur weil bspw. ein Lutheraner keine Calvinistin geheiratet hätte, bedeutete das noch lange nicht, dass er nicht einen Calvinisten zum Abendessen besuchen konnte.
Nachdem nun geklärt wurde, wer im Zentrum dieser Arbeit steht, soll nicht verschwiegen werden, wer es nicht tut. Hier sind zunächst die mittleren und unteren Chargen bei Hofe zu nennen ebenso wie Personen, die nur zeitweise bei Hofe waren oder kein Amt ausübten, also zur höfischen Gesellschaft, aber nicht zum Hofstaat gehörten. Beide Gruppen sind in Bezug auf konfessionelle Aspekte nicht ausreichend gut in den Quellen dokumentiert. Alle Hofleute in dieser Studie gehören somit zur höheren Beamtenschaft. Sie haben politische Ämter inne, d. h. sie sind Teil des Hofstaats und der Regierung bzw. Verwaltung. Eine klare Trennlinie zwischen politischen Entscheidungsträgern und der höfischen Gesellschaft lässt sich jedoch ohnehin nicht ziehen, da gerade die adligen Räte zugleich an gesellschaftlichen Ereignissen teilnahmen.19
Außerdem findet der weibliche Teil des Hofes kaum eine Berücksichtigung, was angesichts des wachsenden Forschungsinteresses an Frauen bei Hofe bedauerlich ist.20 Dies hängt vor allem mit der Quellenlage zusammen.21 Dorothea von Kreytzen, die lutherische Ehefrau des reformierten Oberpräsidenten Otto von Schwerin, ist die einzige Frau bei Hofe, zu der sich einige spärliche Informationen mit konfessionellem Bezug finden lassen. Es ist bekannt, dass sie eine enge Beziehung zur reformierten Kurfürstin Luise Henriette ebenso wie zu den Prinzen pflegte.2...