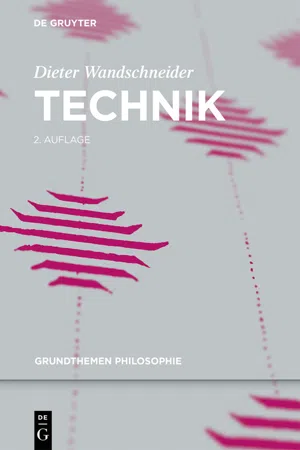1.1.1 Technik als zur ‚Natur‘ des Menschen gehörend
Die Auffassung, dass Technik – im weitesten Sinn – zur Wesensbestimmung des Menschen gehört, ergibt sich aus dessen biologischer Verfasstheit als ‚Mängelwesen‘ im Vergleich mit dem Tier (vgl. Gehlen 1962, 33 f.): Die für das Tier zur Lebensbewältigung notwendigen Instinkte sind bei dem Tier ‚Mensch‘ nur noch rudimentär vorhanden. Auf der anderen Seite hat beim Menschen eine Koevolution der Greifhand (Opposition des Daumens), des Kehlkopfs (Möglichkeit der Artikulation) und des Gehirns stattgefunden, was eine Fortentwicklung der Feinmotorik, die Entwicklung von Sprache und, damit verknüpft, von Denken ermöglichte.
Ob diese evolutionär neuen Fähigkeiten möglicherweise ursächlich waren für die Instinktreduktion des Menschen oder ob es sich dabei um eine Parallelentwicklung handelte, ist hier nicht von Belang. Wesentlich ist, dass hierdurch Mängel der Instinktausstattung kompensiert werden konnten, mehr noch: dass dem Menschen dadurch Fähigkeiten zuwuchsen, die weit über alle Instinktleistungen hinausreichen. In diesem Sinn muss Technik in der Tat als dem Menschen essentiell zugehörig verstanden werden. Helmut Plessner nennt es „das Gesetz der natürlichen Künstlichkeit“ des Menschen, der „als exzentrisch organisiertes Wesen“ sich „erst machen“ müsse zu dem, was er ist (Plessner 1975, 309); ‚exzentrisch‘ im Sinn des nicht mehr Eingepasstseins in die Natur: Der Mensch ist „von Natur, aus Gründen seiner Existenzform künstlich“ (310). ‚Kunst‘ im Sinn der griechischen ‚techne‘, also Technik im weitesten Sinn, gehört zur Natur des Menschen. Seine Natürlichkeit ist die Befähigung zu einer künstlichen Daseinsweise. Die Nicht-Angepasstheit des Menschen an die Natur erfordert umgekehrt Anpassung der Natur an den Menschen: als intelligente Herstellung einer künstlichen Natur, eben durch Technik.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass der Mensch damit nicht lediglich seine Defizite als ‚Mängelwesen‘ so weit kompensieren konnte, dass er dem Tier bestenfalls ebenbürtig war, sondern dass er es qua Technik vielmehr exorbitant übertrifft – das wird in der Bewunderung für die staunenswerten Leistungen des Organismus häufig übersehen. Wenn etwa das enorme Geruchsvermögen des Hundes angeführt wird, das – wie man hört – das des Menschen etwa um das Zweihundertfache übertreffen soll, so ist dem entgegenzuhalten, dass eine solche Fähigkeit durch technische Sensoren nochmals bei weitem überboten wird – bis zur physikalisch möglichen Grenze der Registrierung eines einzigen Moleküls. Setzt das Beispiel noch Vergleichbarkeit mit Leistungen animalischer Organisation voraus, so gilt dies für technische Leistungen grundsätzlich nicht. Man denke nur an Entwicklungen der Laser- oder Computertechnik, die dem Menschen völlig neue Dimensionen technischer Möglichkeiten und damit auch der Daseinsbewältigung erschließen.2
Die von der Technik immer auch ausgehende Faszination ist von daher begreiflich: als das Erstaunen und die Bewunderung über den immer erneuten Triumph des Geistes. Man könnte vom Wunder der Verwirklichung sprechen, dass etwas so Ätherisch-Ungreifbares, wie es Gedanken sind, in der Form technischer Schöpfungen ‚harte‘ Realität gewinnt. Darin ist schon eine Vorausdeutung auf ontologische Tatbestände enthalten, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen (Kap. 1.2). Es muss für den Ingenieur ein überwältigendes Gefühl sein, wenn der Denkentwurf eines Motors in seiner realisierten Form tatsächlich funktioniert.
Zugleich ist der zugrunde liegende gedankliche Zusammenhang damit in Wissen überführt worden. Was funktioniert, ist richtig. Wenn Giambattista Vico geltend gemacht hat, dass wir von der Natur nicht in dem Maß Wissen haben können wie von der Kulturwelt, weil wir nur diese selbst geschaffen haben (Vico 1990, Nr. 331; vgl. auch Hösle 1990, Kap. 2.3), so gilt dieses als Verum-Factum-Prinzip geläufige Diktum eigentlich erst recht für die technische Welt (die ja, wie einleitend erwähnt, in der Tat als Teil der Kulturwelt zu verstehen ist). In einem gewissen Sinn hat das Verum-Factum-Prinzip paradigmatischen Charakter für die gesamte neuzeitliche Wissenschaft, insofern sie experimentelle Wissenschaft ist: Im Labor wird die Natur erkannt, indem sie – partiell – technisch nachgeschaffen wird, „und zwar, gerade durch die Abstraktion von Störfaktoren, in einer Reinheit, die an den göttlichen Schöpfungsakt erinnert“ (Hösle 1991, 58).
Das ‚Wunder der Verwirklichung‘ ist aber nur ein – wenn auch zentrales – Motiv der Faszination von Technik. Ein anderes Faszinosum ist zweifellos der sich in der Technik eröffnende Horizont unabsehbar neuer Daseinsmöglichkeiten und Wunscherfüllungen. Jeder kennt das aus dem Alltag: Kühlschrank, Auto, Fernsehen, Computer, Digitalkamera, Laserchirurgie, Tomographie und so fort. Die Palette technischer Produkte ist überwältigend – und ihr Verlockungspotential ebenso. Dass wir dagegen nicht immun sind, macht das unstillbare Bedürfnis nach immer neuer Technik und, daraus resultierend, ihre ökonomische Bedeutung verständlich. Aber was an der Technik ist es, was uns so unwiderstehlich anzieht? Arbeitserleichterungen und Annehmlichkeiten im Alltag (etwa ‚Zentralheizung‘, ‚Fernsehgerät‘ etc.)? Organverstärkung und Organüberbietung (Gehlen 1961, 93 f.)3 (etwa ‚Motorsäge‘, ‚Elektronenmikroskop‘ etc.) oder auch Befreiung von Naturbeschränkungen (etwa ‚Flugzeug‘, ‚Zahnprothetik‘ etc.)?
Sicher von all dem etwas, aber, so will scheinen, doch auch mehr: Vielleicht eine Art Begeisterung des Geistes für seine Geschöpfe, in denen er seine eigene Intelligenz gespiegelt sieht. Natürlich habe ich den Computer, den ich verwende, nicht selbst erdacht und hergestellt, aber er imponiert mir als Zeugnis der Ingeniosität, die ich auch mir selbst, als Angehörigem der Menschengattung, die solches hervorzubringen vermag, grundsätzlich zurechnen darf.
Diese – sehr ‚anthropologische‘ – Form der Technikbegeisterung scheint mir im Übrigen eine gewisse Erklärung für das Phänomen zu bieten, dass technische Produkte, die ja als Mittel zur Erreichung eines Zwecks gedacht zu sein scheinen, immer auf dem Sprung sind, zum Selbstzweck zu werden. Man kann es auch so ausdrücken: Sie regen zum ‚Spielen‘ an, und das heißt, die Phantasie gerät in Bewegung – als technische Phantasie, die damit spielt, technische Möglichkeiten auszudenken. Auf den Computer trifft dies sicher in besonderem Maße zu. Computerprogramme sind perfektionierte logische Gebilde, aber aus begreiflichen Gründen nie so perfekt, dass sie nicht weiterer Perfektionierung fähig und bedürftig wären. Jeder, auch der Nicht-Programmierer weiß, was zu verbessern wäre, und in diesem Sinn imaginiert er sein Wunschprogramm. Jeder kann zudem im Umgang mit dem Computer seine eigenen Vorstellungen von Ordnungen und Strukturen konfigurieren und variieren. Der Computer bietet der technischen Phantasie gleichsam unerschöpflich ‚Futter‘, was seine Attraktivität zweifellos ganz wesentlich mit ausmacht.
1.1.2 Der Erfolgscharakter technischer Rationalität
Charakteristisch für Technik ist jene Denkform, die als Mittel-Zweck-Rationalität bezeichnet wird. Das richtige Mittel garantiert die Realisierung eines bestimmten Zwecks (dazu später mehr, Kap. 1.2.3). Das Mittel ‚Heizung‘ ermöglicht die Realisierung des Zwecks ‚Wärme‘. Diese der Mittel-Zweck-Relation inhärente Erfolgsgarantie macht ein weiteres Essential technischen Denkens deutlich: die Möglichkeit, den Erfolg herbeizuzwingen – ein Menschheitstraum! Das riesige, der Technik innewohnende Verlockungspotential wird von daher begreiflich.
Die mit technisch-instrumentellem Denken verknüpfte Erfolgserwartung motiviert zur Generalisierung: Warum sollten sich so nur technische Effekte erzielen lassen, warum nicht auch strategische, politische oder psychologische Siege? ‚Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg‘: Erfolgsgeleitetes technisches Denken empfiehlt sich als die Methode des Erfolgs schlechthin. In der Tat findet sich dafür im militärischen, im politisch-sozialen Bereich, in der Werbung etc. reiches Anschauungsmaterial. Der in diesem Kontext geprägte Begriff der ‚Sozialtechnik‘ ist bezeichnend. Der Gedanke, dass Menschen in dieser Weise konditioniert, instrumentalisiert, manipuliert werden können, ist einfach naheliegend. Hier ist an Kants mahnende Unterscheidung von Sache und Person zu erinnern, wonach die Sache „nur einen relativen Wert“ (Kant GM, 428), die Person aber „Würde, d. i. unbedingten, unvergleichbaren Wert“ habe (GM, 436). Dem entspricht Kants zweite Formel des kategorischen Imperativs, dass der Mensch „niemals bloß als Mittel“, sondern immer auch als „Zweck an sich selbst“ zu achten sei (GM, 429, i. Orig. hvgh.).
‚Niemals bloß‘ – damit ist auch eine Einschränkung formuliert: In der unvermeidlich arbeitsteiligen Welt ist der Mensch unvermeidlich auch Mittel: als Taxifahrer, Professor, Bankangestellter etc. Dies gilt für alle Lebensbereiche: Ohne den Einsatz von Mitteln ist Daseinsbewältigung unmöglich. Selbst in psychisch-emotionaler Perspektive müssen strategische Aspekte im Blick behalten werden – Geburtstag nicht vergessen, Öffnungszeiten des Blumenladens beachten, an Zahlungsmittel denken und so fort. Erfolgsbedingung ist hier konsequentes Mittel-Zweck-Denken, also eine im weitesten Sinn technische Rationalität: als eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung zwischenmenschlichen Handelns. Werte wie Zufriedenheit, Freundschaft etc., die im Horizont der Technik selbst keinen Ort haben, müssen gleichwohl immer auch technisch-strategisch realisiert und gesichert werden. Kurzum: Handlungserfolg ist an die Mittel-Zweck-Rationalität geknüpft derart, dass – bei gegebenem Zweck – die Wahl des richtigen Mittels die Realisierung des Zwecks garantiert. Das ist von Anbeginn an eine Grundfigur menschlichen Denkens.
Arnold Gehlen hat deren Affinität zur Magie bemerkt (Gehlen 1957, 13 ff.; 1961, 96 f.). Wer die magische Formel kennt, kann den Dingen befehlen und sie für sich arbeiten lassen: Genau das intendiert Technik in der Tat. Die Magie freilich bedient sich nicht realer Mittel, sondern sucht eine spirituelle Macht über die Dinge zu gewinnen. Gehlen nennt sie daher eine „über-natürliche Technik“ (1957, 14). Wetterzauber, Fruchtbarkeitszauber, ‚Besprechen‘ von Krankheiten, Astrologie etc. sind gewissermaßen als ‚Geisteswissenschaften der Natur‘ zu verstehen. Gehlen sieht darin ein „Resonanzphänomen“ in dem Sinn, dass der Geist dazu neigt, die Natur als durchgängig begeistet zu deuten (1957, 16). Nun, so ganz falsch liegt er damit letztlich vielleicht nicht, wenn man bedenkt, dass auch die reale Technik nur gelingen kann, wenn sie die den Dingen zugrunde liegende ‚Logik‘ – die Naturgesetze – richtig erfasst und technisch in reale Funktionalität umsetzt (hierzu Kap. 1.2.1, 1.2.2). Beides erspart sich die Magie allerdings und ist dadurch zum...