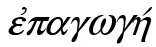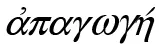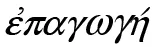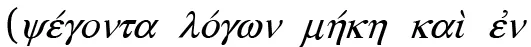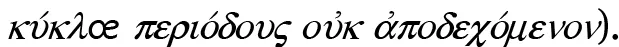1Benennungen des ordo inversus
Der
ordo inversus bezeichnet im Folgenden
allgemein eine kreisförmige Bewegung, die zunächst von einem Ausgangspunkt wegführt und dann zu diesem zurückkehrt. Bei der so bestimmten Denkfigur handelt es sich weder um einen mehr oder weniger spielerischen
ordo perversus oder
mundus perversus noch um einen
monde reversé, noch um einen
mundus inversus.
9 Der gemeinte
ordo inversus ist auch keine Paradoxie als »ideale Figur zur Beschreibung einer Welt, in der Recht und Unrecht, Gut und Böse vertauscht sind, in der überhaupt alle konventionellen Werte auf den Kopf gestellt sind«.
10 Bei diesen Formen des
ordo oder
mundus inversus werden
impossibilia oder
adynata dargestellt.
11 Der
ordo inversus, wie wir ihn hier betrachten, ist auch keine Verkehrung einer gegebenen Anordnung. Wenn es in Lukrez’
De rerum natura heißt: »hunc igitur contra mittam contendere causam, / qui capite ipse sua in statuit vestigia sese« (»Gegen den also geb auf ich, die Sache zu führen, / der mit dem Kopfe sich selbst gestellt in die eigene Fußspur«),
12 so dürfte diese verkehrte Anordnung weniger die Idee eines
ordo inversus im gemeinten Sinn zum Ausdruck bringen als vielmehr ein Bild für die Selbstwiderlegung – in diesem Fall die des Skeptikers – sein.
13 Ähnliches wie für Lukrez gilt auch für Hegels Sentenz:
Solange die Sonne am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, daß der Mensch sich auf den Kopf, d. i. auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut.14
Das Bild des gespannten Bogens, der ebenfalls Ähnlichkeiten zum gemeinten ordo inversus haben könnte, kann zwar als geschlossene (halb-)kreisförmige Figur konzipiert sein, aber in der allegorischen oder typologischen Bedeutung setzt der Ausdruck mehr das Zielen als die Rückkehr zu einem Ausgangspunkt ins Bild.15
Was aber ist dann der ordo inversus? Nur äußerst selten dürfte sich der Ausdruck wörtlich als Bezeichnung für das Ganze der hier gemeinten Denkfigur finden. Häufiger werden seine Teile mit Ausdruckspaaren wie diesen benannt: egredi/regredi, exeuntes/redeuntes, fluxus (efluxus)/refluxus, productio/reductio, exitus/reditus (reversio), progressio (egressio)/regressio sowie aposteriorisch/apriorisch, neben reciprocus, verstanden als vorwärts und rückwärts, recht häufig ascensus/descensus.16
Bonaventura (1217–1274) verwendet die Ausdrücke descendere und ascendere im Zusammenhang mit der Lösung der Exegeten von der Heiligen Schrift (originalia) und der Konzentration auf die Schriften der Väter, der magistri oder gar der Philosophen. Zu den zahlreichen Gefahren dieser Wegbewegung von der Heiligen Schrift gehört nach Bonaventura, dass man bei einem solchen ›Hinabsteigen‹ den Weg hinauf nicht wiederfinde.17 Die Vorstellung hingegen – auch sie lässt sich bei Bonaventura nachweisen –, dass der Mensch in der Erprobung seiner Unabhängigkeit und seiner Macht vom Höchsten der Gottähnlichkeit zum Tiefsten der Tierähnlichkeit herabsinken könne, stellt einen anderen Bewegungsgedanken dar. Er rührt aus der christlichen Vorstellung her, die den Menschen in der kreatürlichen ›Mitte‹ positioniert (infimum, summum und medium).18 Obwohl dieser Gedanke in dem Sinn fortgesetzt wird, dass der Mensch dabei Gefahr laufe, dass ihm irgendwann der Rückweg versperrt sei und diesen Rückweg nurmehr die Gnade eröffnen könne, bietet er trotz des Rückkehraspekts nicht eine allgemeine Vorstellung eines ordo inversus. Denn im Unterschied zu anderen Bewegungen handelt es sich beim ordo inversus nicht von vornherein um die durch eine feste Wertskala strukturierte Hierarchie ontologischer Ebenen.19
Unabhängig davon findet sich ein gemeinsamer Hintergrund: Die Kreisbewegung galt in der Antike als perfekte Bewegung, der Kreis als die vollkommenste Figur und die Kugel als das vollkommenste Gebilde. Wichtig ist dabei die
Bewegung: der
motus circularis, der Weg von etwas zu diesem wieder zurück.
20 Vollkommen ist diese Bewegung in dem Sinn, dass es nichts gibt, das hinzugefügt zu einer Verbesserung führt.
21 Dieses Muster konnte unterschiedlich variieren und eingebettet sein in übergreifende Vorstellungswelten. Nicht selten liegt kosmologischen Vorstellungen eine Art
ordo inversus zugrunde. Bei Empedokles (500–430) etwa findet man die Vorstellung eines ›unverrückbaren Kreislaufs‹ des Wirkens, in dem
(Liebe) die vier Elemente immer wieder zusammenführe, während
(Streit) sie immer wieder trenne.
22 Aufgenom
men wird Derartiges unter Verwendung der Ausdrücke
und
später etwa bei Ralph Cudworth (1617–1688).
23 Nach der nicht geringe Interpretationsprobleme aufwerfenden Charakterisierung bei Aristoteles sind die diesbezüglichen Auffassungen des Empedokles als ein Kreislauf konzipiert, der aus zwei Phasen der Bewegung und zwei Phasen der Ruhe bestehe: Auf die vollkommene Einheit der Elemente (im Sphairos) folge eine Phase der allmählichen Trennung, die in der völligen Trennung zur (zeitweiligen) Ruhe finde, die nach einer Phase der Wiedervereinigung wiederum in die Einheit (des Sphairos) zurückkehre.
24 Zu Beginn seiner
Metaphysik heißt es entsprechend bei Aristoteles: »Sooft das All durch den Streit in die Elemente sich scheidet […]. Sooft diese wiederum durch die Liebe in Eines zusammentreten.«
25 Und in
De caelo erläutert er: Wenn man die Welt abwechselnd
sich bilden und auflösen lasse, dann bedeute das nichts anderes als eine Welt anzunehmen, die ewig ist und nur ihre Gestalt ändere.
26 Und in seiner
Physik schreibt Aristoteles: »Woraus nämlich alles ist, in das löst es sich auch wieder auf«
27 Hier zeichnet sich ein Modell ab, in das der
ordo inversus integriert sein konnte: Es handelt sich um ein iterierbares Ganzes, das selbst allerdings keinen schließenden
ordo inversus bildet.
Aristoteles wurde eine Definition Gottes zugeschrieben, nach der Gott das sich bewegende Universum mit einer Art umkehrender Bewegung (replicatio) leite (quaedam preficit mundo eique eas partes tribuit ut replicatione quaedam mundi motum regat atque tuatatur); allerdings ist strittig, was damit genau gemeint ist.28 An anderer Stelle erörtert Aristoteles die Vorstellung, dass die Kette der Ursachen von einem gegebenen Endpunkt ›nach oben‹ unbegrenzt aufsteige sowie von einem gegebenen Anfangspunkt ›nach unten‹ unbegrenzt absteige.29
Schon früh konnten allerdings mit dem
ordo inversus auch geistige Bewegungen umschrieben werden. Sowohl die aristotelische
(
epagoge), die zu etwas hin oder an etwas heranführt (die ›Induktion‹), aber auch die
(
apagoge), die von etwas wegführt (der ›indirekte Beweis‹), sind mit dem Ausdruck
deducere wiedergegeben worden
30 – wobei sich bei Aristoteles hierzu weder eine ausgearbeitet Lehre findet noch klar ist, inwiefern er beide Bewegungen als ›Schluss‹ aufgefasst hat (abgesehen vom epagogischen Syllogismus, in dem sich die
als eine Art vollständige Induktion darstellt).
31In Platons
Timaios wird gefordert, dass die Bewegung des philosophischen Denkens den in sich zurückkehrenden, um eine ruhende Mitte kreisenden Kosmos nachbilden solle.
32 Dass hier ein Zurückgehen im Zuge der methodischen Bewegung im Kreis gemeint ist, macht die Passage in Platons
Politikos deutlich, in der es heißt, man dürfe sich nicht gegen die Länge des Gedankenganges und nicht gegen die »Umwege im Kreise« wehren
33 Ähnlich heißt es in Senecas
De vita bea...