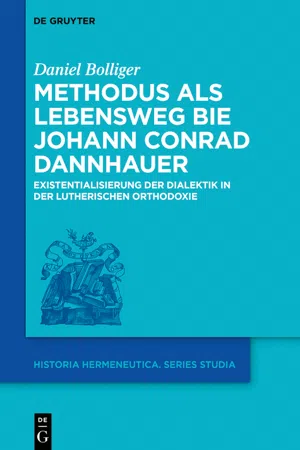1.1 Hiat zwischen Lehre und Leben? Erforschung theologischer Praxisreflexion in der lutherischen Orthodoxie als interdisziplinäres Desiderat
Zu zumindest einem, wenngleich elementaren Konsens konnte sich die internationale Forschung zur konfessionellen Theologie und Frömmigkeit des 17. Jahrhundert mittlerweile durchringen: Heute „sollte man nicht Johann Arndt und schon gar nicht Gottfried Arnold die alleinige Deutungshoheit über die Epoche des lutherischen Barock überlassen“1, denn die ausgehend von Arnold und später August Tholuck behauptete „Diastase von wissenschaftlich-objektiver Theologie (Lehre) und persönlich-subjektiver Frömmigkeit (Leben)“ ist „der lutherischen Orthodoxie selbst fremd“2. Das nun gut dreihundertjährige, aber „im allgemeinen Bewußtsein schwer auszulöschende Bild von der ’toten Orthodoxie’ ist wissenschaftlich längst überholt“3. So unumstritten solche Forderungen und Feststellungen, deren Aufreihung sich beliebig erweitern ließe,4 seit etwa einer Forschergeneration geworden sind, so auffallend ist ihre stets anhaltende Nennung. Dass sie in maßgeblichen Überblicken auch jüngsten Datums noch prominent erscheinen, ist zwar in erster Linie durch die lexikalische Notwendigkeit historiographiegeschichtlicher Information bedingt. Doch dürfte kaum fehlgehen, wer daraus schließen wollte, dass ihnen zugleich auch forschungsstrategischer Appellcharakter eignet. Die fast schon topisch stets neu auftauchenden Forderungen nach Überwindung veralteter Perspektiven sind Indiz dessen, in welchem Maße sie erst teilweise konkret eingelöst werden konnten. Die Größe der Aufgabe lässt sich anschaulich auch in der Abfolge der bisherigen Versuche ihrer Bewältigung erkennen. Vom Arnoldschen Geschichtsbild vermochten sie insofern nur stufenweise abzurücken, als die jeweils nächste Stufe dessen Restbestände bei der vorangehenden präziser in den Blick zu nehmen begann. Dieses Bild scheint unterschwellig selbst dort vorerst weitergewirkt zu haben, wo bevorzugt die praktischen, alltagsnahen und seelsorglich-trostbereiten Seiten orthodoxen Wirkens herausgestellt wurden.5
Das tat pionierhaft der im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts wirkende Rostocker Kirchenhistoriker Hans Leube, der das geographisch und bezüglich Quellenmenge bisher umfassendste Unternehmen aufstellte, die lutherische Orthodoxie wieder als Ort lebendiger Frömmigkeit zu vindizieren. Von einem elementaren, aber unpolitischen Einfluss Johann Arndts (1555–1621) auf die Frömmigkeit der Zeit unterschied er erstmals eine „Reformbewegung in der lutherischen Kirche des 17. Jahrhunderts“6, deren „Reformideen“ auch strukturelle Umgestaltung auf institutioneller Ebene vorsahen, während jener „auf obrigkeitliche und kirchliche Maßnahmen keinen Wert“7 legte. Trotz der enormen Verbreitung des Arndtschen „Wahren Christentums“ blieb die Wirksamkeit der Reformbewegung laut Leube daher auf „die Mittelpunkte der kirchlichen Reformbestrebungen“8 beschränkt. Eine breite, darum oft simplifizierende Rezeption dieses Konzepts ließ darauf die Ansicht eines letztlich statischen Gegensatzes „der“ auf gewisse Zentren beschränkten „Reformorthodoxie“ und der sozusagen normalen flächendeckenden Orthodoxie bald zur neuen communis opinio in der Barockforschung avancieren. Als nur noch mit bestimmtem Artikel verwendetes singularetantum stand sie freilich in Gefahr, nun ihrerseits die zu überwindende Kluft von toter Lehre und lebendiger Praxis mittels vorgeblich eindeutiger geographischer Differenzierung zu relativieren – und damit zugleich zu perpetuieren. Doch erwies sich der Leubesche Ansatz trotz aller Schwächen als so stimulierend, dass dank ihm zunehmend auch bei orthodoxen Autoren und Publikationen wichtige Praxisaspekte erkannt wurden, die ursprünglich bei Leube nicht im Blick gewesen waren – so dass Johannes Wallmann schon 1966 pointiert bemerken konnte, „dass es offenbar […] sehr schwierig ist, die Vertreter der herrschenden Orthodoxie ausfindig zu machen“, um dann die ebenso zugespitzte wie treffende Frage zu formulieren: „Wer aber gehört dann eigentlich zur ’Orthodoxie’?“9
Seit knapp zwei Jahrzehnten verzichten Studien zum Praxismoment der lutherischen Orthodoxie daher auf ein umfassendes, allzu grobmaschiges Orientierungsnetz und beschränken sich auf einzelne Territorien oder spezifische Quellengattungen. Die Frage lautet nicht mehr: Wer kämpfte in der Orthodoxie gegen wen für mehr Praxis? Thema ist nun eher: Wie kämpfte die Orthodoxie um eine wirksamere Praxis in ihrer spezifischen Umwelt? Das Bemühen um sinnvolle praktische Vermittlung der orthodoxen Lehre gilt – dank Leubes Nachwirkung, aber auch aufgrund der kanonischen These Max Webers einer vormodernen Transformation theologischer Inhalte in soziales Handeln – grundsätzlich als gegeben. Damit zog vermehrt die klassische, zwar nicht allein maßgebliche, aber doch höchst zentrale Verkündigungsgattung der Predigt Interesse auf sich, deren Analyse nun unter sozialhistorischem Fragehorizont erfolgte. Drei von 1988 bis 1993 erschienene mikrohistorische Arbeiten aus der Schule des früheren Tübinger Historikers Hans-Christoph Rublack10 besehen städtische Predigliteratur aus dem schwäbischen Raum und kommen zum Schluss, dass eine intime Beziehung zwischen „Theologie und Alltag“11 für sie von konstitutiver Bedeutung sei. Vornehmlich erscheint sie ihnen als starkes Interesse orthodoxer Prediger an alltagsregulativer Normenvermittlung.
Bis hinein in höchst alltägliche Lebensgebiete wie Essen und Trinken, Ehe(-anbahnung) und Sexualität oder auch Legitimität und Grenzen von Fronarbeit legt der Ulmer Superintendent Konrad Dieterich (1575–1639)12 seiner Hörerschaft den göttlichen Willen aus, wie Monika Hagenmaier in ihrer Studie anschaulich macht.13 Norbert Haag zeigt, wie die Ulmer Prediger nicht allein das alltagspraktische Verhalten, sondern auch die indiviuelle Glaubenshaltung nach Maßgabe konfessioneller Rechtgläubigkeit prägen oder umformen wollten, so dass etwa auch abergläubische Praktiken letztlich vorchristlicher Herkunft vehement bekämpft wurden.14 Sabine Holtz kommt für ein von ihr analysiertes Corpus von Predigten von Tübinger Theologieprofessoren zum Schluss, dass die orthodoxe Predigt „durch die Transformation von theologischer Doktrin in Handlungsanweisungen für die Zukunft einen Beitrag zur Konstitution der sozialen Wirklichkeit“15 leistete. Insbesondere in der zweiten Hälfte des von ihr untersuchten Zeitraums von 1550–1750 konstatiert sie dabei ein zunehmendes Bemühen um Individualisierung, die sie am wachsenden Gewicht der Dekalogauslegung innerhalb der homiletischen Themenpalette festmacht, so dass Individualisierung hier vornehmlich als Ethisisierung aufscheint. Stellvertretend für die durch Rublack initiierte sozialhistorische Forschung wird die der Sache nach schon bei Leube vorgebrachte These, dass sich „das Gegensatzpaar von ‚Lehre’ und ‚Leben’ nicht zur Bezeichnung des Unterschiedes zwischen lutherischer Orthodoxie und Pietismus heranziehen“16 lässt, durch Holtz nun mit adäquaterer Quellenbasierung wiederholt. Könnte man bei ihrer Studie allenfalls mutmaßen, dass der Württemberger Pietismus strukturell besser integriert war und kirchlicheren Charakter trug, als es sonst meist der Fall war, sind ähnliche frömmigkeitliche Konvergenzen wie die von ihr geschilderten auch im Norden Deutschlands unschwer zu beobachten, nicht nur bei den schon von Leube beschriebenen und neuerdings intensiv untersuchten Rostocker Reformern17, sondern etwa auch in Lüneburg als einen Zentrum für den Druck von Erbauungsliteratur, ja selbst bei einer so stramm orthodoxen Gestalt wie dem Hamburger Pastor primarius Erdmann Neumeister (1671–1756).18
Eine Diskussion mit den Resultaten und dem sie generierenden Theorierahmen dieser funktionsanalytisch angelegten Arbeiten zur orthodoxen Verkündigung ist die theologisch motivierte historische Wissenschaft freilich noch immer schuldig.19 Es zeichnet sich jedoch ab, dass die in ihnen gegebenen Anstöße insofern für die kirchenhistorische Epochenbildung von Bedeutung werden dürften, als ihre von den derzeit intensiven Richtungskämpfen der Kirchenhistorikerschaft unbelastete Perspektive zu unvoreingenommener Quellenwahrnehmung und damit zu größerer Präzision in der Kriterienbildung anmahnt. So gelangte die Bestimmung des beiderseitigen Profils von Orthodoxie und Pietismus in den vergangenen zehn Jahren durch das Herausarbeiten zunehmend feinerer Kriterien zu wachsender Präzision: Bereits die Orthodoxie kannte, förderte und forderte eine tiefgreifende Innerlichkeit der Frömmigkeit mit verschiedenen Mitteln, ohne allerdings den Primat der Lehre irgendwie aufzugeben. Verinnerlichungspraktiken zur nachhaltigen Memorisierung gehörter Predigten durch konzentrierte meditatio und ständige ruminatio wurden propagiert,20 doch nur streng innerhalb der Grenzen des analogia fidei Zulässigen. Orthodoxe Pastoren und Konsistorien begrüßten, ja verlangten Katechismusübungen im Kreis des Hauses, hielten sie aber noch nicht für unbedingt zwingend;21 sie gaben dazu auch schon zahlreiche kasuistische Hilfen zur Gewissenserforschung heraus, die sie jedoch an die normativ konfessionellen Vorgaben gebunden halten wollten.22 Auch in ästhetischen Dimensionen, etwa was die Liedpoetik angeht, bediente sich die Orthodoxie durchaus schon einer Innerlichkeitssprache, freilich noch in strenger Wahrung einer barocken Form-Inhalt-Entsprechung,23 im Versmaß beispielsweise im gravitätischen Trochäus, nicht aber in der „Neurung“24 durch Daktylen, wie sie dann in vielen pietistischen Schöpfungen geschätzt wurde.
Bei solchen Befunden handelt es sich jedoch noch stets um eher zufällige Streiflichter, wie in aktuellen Stellungnahmen von kirchenhistorischer Seite einhellig betont wird.25 Wie stark der Klärungsbedarf geblieben ist, zeigt sich indirekt natürlich auch darin, dass über die zeitliche Ausdehnung und damit auch das Wesen des lutherischen Pietismus in den letzten Jahren kein Konsens herzustellen war. Während Martin Brecht die Frömmigkeit vor und nach Spener als zwei Phasen eines durch Arndt initiierten lutherischen Pietismus betrachtet,26 plädiert Johannes Wallmann für ein differenzierteres Modell der Unterscheidung zwischen Pietismus in weitem Sinne vor und in engem (bzw. eigentlichem) Sinne ab Speners Wirken in Frankfurt.27 Bei Brecht werden so arndtkritische Züge vorpietistischer Orthodoxie tendenziell aus dem Fragehorizont ausgeblendet. Umgekehrt sieht Wallmann die vorspenersche Orthodoxie als insgesamt zwar reformorientiert an, betont aber für die spätere Orthodoxie die pietismuskritischen Aspekte und eine große Nähe zur Frühaufklärung, so dass er wiederholt für eine Erwägung des Begriffs „vernünftige Orthodoxie“ auch für das Luthertum votierte.28
In diesem ganzen Fragenfeld dürfte ein Weiterkommen nur dann zu erzielen sein, wenn nebst den großen konzeptionellen Themenstellungen auch die Kärrnerarbeit editorischer, mikrohistorischer, literargeschichtlicher und nicht zuletzt prosopographischer Quellenaufbereitung vorangetrieben wird. Vor allem aber dürften die Chancen auf Erfolg nachhaltig steigen, wenn nicht das auf Frömmigkeit orientierte „Leben“ der Orthodoxie, wie bisher bevorzugt, exklusiv betrachtet, sondern auch die von dieser selbst als ihr Proprium verstandene und deklarierte „Lehre“ auf ihre Bezüge zum „Leben“ untersucht wird. Wenn die jüngere Forschung quer durch die Disziplinen und epochentheoretischen Lager einhellig betont, dass Erbauungs- und Reformschriften sowie generell Predigten und Gebete frömmigkeitliche und praxisbezogene Aspekte aufwiesen, ist das in sich nicht wirklich erstaunlich – zumal die Frage nach dem Verhältnis dieser Schriften zum Primat der Lehre in der Orthodoxie im Wesentlichen damit ungeklärt bleibt. Ohne Theologiegeschichte ist auch Frömmigkeitsgeschichte auf Dauer nicht zu haben. Umgeke...