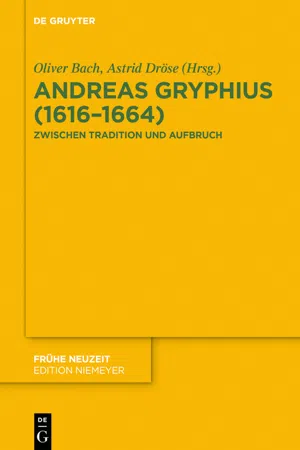Gryphius und die Jesuiten
Carolus Stuardus und Nicolaus Avancinis Pietas victrix
1 Friedenspolitik, Schlesiens Protestanten und die Jesuiten
In den Städten Schlesiens wurde der Frieden erst im Juli 1650 gefeiert, nachdem die schwedischen Truppen, die Schlüsselstellung besetzt hielten, sich für den endgültigen Abzug rüsteten.1 In Breslau wurden am 24. Juli 1650 Dankgottesdienste und Friedensfeiern veranstaltet. Gryphius hat am Ende des Jahres den ersehnten Frieden in einem Sonett begrüßt:
XX.
Schluß des 1650zigsten Jahres.
Nach Leiden / Leid und Ach und letzt ergrimmten Nöthen /
Nach dem auf uns gezuckt- und eingestecktes Schwerdt /
Indem der süsse Fried ins Vaterland einkehrt.
Und man ein Danck-Lied hört statt rasender Trompeten :
Indem wir eins aus Lust und nicht durch Glut erröthen /
Schließ ich diß rauhe Jahr und was mein Hertz beschwert:
Mein Hertz das nicht die Angst die unser Land verhert
Vermocht durch rauhen Sturm und linde Gifft zu tödten.
GOtt wir haben diß erlebet was du uns verheissen hast /
Daß der unerhörte Schmertzen und der überhäufften Last /
Letztes Ziel ist angebrochen.
Bißher sind wir todt gewesen / kan nun Fried ein Leben geben /
Ach so laß uns Friedens König durch dich froh und friedlich leben /
Wo du Leben uns versprochen.2
Das geängstigte Herz hatte trotz Verlust und Schmerzen nur einen Wunsch: ein Leben in Frieden zu erlangen. Die Aussicht auf eine friedliche Zukunft wird im Optativ und unter Voraussetzung einer Bedingung als Gebet formuliert: Allein der diplomatisch ausgehandelte Frieden könnte ein friedvolles Zusammenleben regulieren. Zu diesem Zweck wird der Erlöser angerufen. Wie allerdings der Frieden in Schlesien, dem Erbland des böhmischen Königs, umgesetzt werden konnte, war noch ungewiss.
Im Mai 1650 war Gryphius von den Ständevertretern Glogaus öffentlich in sein neues Amt eingeführt worden.3 Als Syndicus vertrat er die Interessen der protestantischen Bevölkerung und vermittelte zwischen ihnen und den kaiserlichen Beamten. Im Westfälischen Frieden, zu dessen Verhandlungen schlesische Delegierte keinen Zutritt hatten, waren mit Rücksicht auf einen Zusatz zum Prager Sonderfrieden von 1635 Glogau, Schweidnitz und Jauer die freie Religionsausübung und eigene protestantische Kirchen zugestanden worden. Gleichwohl waren 1650 im Fürstentum Glogau schon 150 evangelische Kirchen geschlossen worden. 1651 wurden protestantische Geistliche aus Glogau vertrieben, und Gryphius half ihnen bei ihrer Übersiedlung. Die Landstände finanzierten den Bau der Friedenskirche in Glogau. Gryphius hielt dort im Dezember 1651 die Einweihungsrede. Baltzer Siegmund von Stosch lobte ihn im Nachruf wegen seiner Standhaftigkeit im Engagement für die lutherischen Protestanten.4
Der Westfälische Friede war im Kern ein religionsrechtliches Werk.5 Er hat aber die Spaltung der Konfessionen dauerhaft verfestigt. In Schlesien ließ sich „das Staatsideal von Reformation und Gegenreformation – der geschlossene Konfessionsstaat“ – nicht durchsetzen.6 Dies war Ziel kaiserlicher Politik seit den dreißiger Jahren. Das Westfälische Friedenswerk schuf allerdings langfristig die Voraussetzung für Religionsfreiheit als Menschenrecht. Wer einer der drei Staatskonfessionen angehörte, genoss Religionsfreiheit; folglich war dies lediglich das Grundrecht der jeweiligen Mehrheit: „Wer als Untertan katholischer Reichsstände im Normaljahr 1624 dem lutherischen oder reformierten Bekenntnis anhing […], durfte diese Konfession auch weiterhin ausüben oder zu ihr zurückkehren.“7 Für diejenigen, die als Katholiken, Lutheraner oder reformierte Untertanen ihren Glauben 1624 nicht öffentlich oder privat ausüben durften, und für alle, die nach Friedensschluss ihren Glauben wechseln wollten, galt indes, dass sie zwar in häuslichen Andachten und in Gottesdiensten in der Nachbarschaft nicht gestört werden und ihre Kinder in ihrer Religion erziehen durften. Nur ein Recht auf Besuch des Gottesdienstes in einer Kirche ihres Glaubens hatten sie nicht.8 Wer lieber emigrieren wollte, durfte seinen Besitz mitnehmen. Alle Verhandlungspartner hatten die konfessionellen Gegebenheiten in ihren Ländern gemäß dem Zustand am 1. Januar 1624 wiederherzustellen und die mittlerweile eingetretenen Veränderungen zu revidieren. Rechtlich, politisch oder militärisch an diesen Verhältnissen in Zukunft etwas zu ändern, war verboten.
Nach dem westfälischen Friedensschluss dauerte für Protestanten außerhalb von Breslau, Schweidnitz, Jauer und Glogau in Schlesien die politische und religiöse Fremdbestimmung an.9 Denn für die Habsburger Erblande, zu denen Böhmen und Schlesien gehörten, galt eine Ausnahmeregelung, der die Regelung gemäß dem fünften Artikel des Vertrags einschränkte. Dem Kaiser wurde zugestanden, in Schlesien die rechtmäßig begonnene Rekatholisierung zu vollenden.10 Besitzansprüche Schwedens auf Schlesien wurden abgegolten durch Abtretung der Erzbistümer Magdeburg und Hamburg-Bremen, wogegen Alexander VII. (Fabio Chigi) vergeblich Protest einlegte.11 Der Kaiser hatte als Hausherr in Schlesien fortan das Recht, evangelische Kirchen zu „reduzieren“, d. h. zu schließen und umzuwidmen und die evangelischen Pfarrer durch katholische Geistliche zu ersetzen. Abgesehen von Breslau, Brieg, Wohlau und Oels wurden die Gotteshäuser rekatholisiert, Prediger vertrieben und die Bevölkerung zur Konversion gezwungen. 1653/54 wurden 656 Kirchen „reduziert“ und 500 evangelische Pfarrer ausgewiesen. Der katholisch-habsburgische Reichsadel unterstützte den Kaiser in diesem Prozess.
Die Habsburger hatten den Augsburger Religionsfrieden für Schlesien nie anerkannt, weil sie den Protestantismus in den dem Kaiser subordinierten Piastenstaaten nicht legalisieren und damit die protestantische Partei im Reich nicht stärken wollten. Vergeblich versuchten die protestantischen Fürsten sich die Privilegien des Majestätsbriefs von 1609 bestätigen zu lassen. Vielmehr behielt sich der Kaiser, zumal nach der Schlacht am Weißen Berg im November 1620, das ius reformandi in seinen Ländern vor und bestritt es den regionalen Fürsten, die dem Luthertum zuneigten. Im sogenannten Dresdner Akkord von 1621 vermittelte der sächsische Kurfürst eine Vereinbarung, wonach Schlesien zwar Ferdinand II. als rechtmäßigen Landesherrn anerkannte, sich aber gleichwohl die alten konfessionellen Privilegien von Rudolf II. und Matthias bestätigen lassen wollte. Der Prager Sonderfrieden 1635 konzedierte hingegen nur der Stadt Breslau und den Mediatherzogtümern Wohlau-Liegnitz, Brieg und Oels die lutherische Religionsausübung. Zwar erhielten die Protestanten im Artikel V des Westfälischen Friedens von 1648 ihren Konfessionsstatus auf der Basis des Prager Friedens zugebilligt, und fortan war dieser Status Reichsgesetz. Außerhalb Breslaus und der Mediatherzogtümer wurden aber ausschließlich katholische Kirchengemeinden geduldet. Die Friedenskirchen in Schweidnitz, Jauer und Glogau außerhalb der Stadtmauern waren keine Gemeindekirchen. Nach Artikel V des Westfälischen Friedens stand zwar den protestantischen Herzögen der Status als Reichsstände zu.12 Verfassungsrechtlich waren die drei Religionsparteien in einem Territorium gleichrangig und legitim. Sie durften ihr Recht im Fall der Verweigerung auf dem Immerwährenden Reichstag geltend machen der bei Religionsverwandten im Ausland um reichsrechtlichen Beistand an die Adresse des Kaisers bitten. Aber die schlesischen Ständevertreter schickten nach 1648 immerfort Beschwerden nach Dresden, Berlin oder Stockholm, dass den Protestanten die 1648 zugestandenen Rechte verweigert würden. Der Wiener Hof reagierte auf derartige Interventionen beim Kaiser mit der Erklärung, „die Vergünstigungen von 1648 seien lediglich Gnadenerweise des kaiserlichen Landesherrn.13 Vergeblich bemühten sich die Piasten, als Reichsfürsten anerkannt zu werden. Auf dem Ewigen Reichstag standen die Mitgliedschaft der Piasten und damit der schlesische Konfessionskonflikt als Dauerbrenner auf der Agenda. Als Mitglieder des Corpus Evangelicorum, der 1653 eingesetzten Vertretung protestantischer Territorialinteressen in der Reichsverfassung, klagten die schlesischen Fürsten immer wieder die im Friedenswerk vereinbarten Konfessionszusagen ein. Der Kaiser, als böhmischer Landesherr über Schlesien, wich ihnen aus. Eine Klage vor dem Reichskammergericht seitens der protestantischen Schlesier war jedoch für Territorien, die kaiserlichem Recht unterstanden, verboten. Die Schlesier setzten in dieser Rechtsfrage daher ihre Hoffnung auf den Einfluss ausländischer Potentaten auf den Kaiser. Tatsächlich vermochte Karl XII. erst 1707 den Kaiser zur Anerkennung der protestantischen Reichsstände zu bewegen. Die Folge der kaiserlichen Rekatholisierungspolitik waren massenhafte Konversionen oder scharenweise Emigration.
Die Jesuiten übernahmen durch die Unterstützung des Kaisers und seiner Beamten die evangelischen Schulen: 1625 in Glogau, 1627 in Troppau, 1629 in Schweidnitz, Sagan und Hirschberg, 1649 in Deutsch Wartenberg, 1668 in Oppeln, 1670 in Teschen und 1681 in Brieg. Seit 1638 missionierten die Jesuiten in Breslau und richteten ein Gymnasium ein, das in den vierziger Jahren erweitert wurde. Der Widerstand des Breslauer Stadtrats gegen die Berufung der Jesuiten 1638 und ihre Präsenz blieb wirkungslos. Es kam wiederholt zu Animositäten zwischen den Schülern des Jesuitengymnasiums und denen der zwei älteren protestantischen Schulen. Deren Schülerzahl verdoppelte sich von 1638 bis 1641 auf 200. 1639 und 1641 wurde erstmals im Breslauer Jesuitengymnasium Theater gespielt; Schüler führten An...