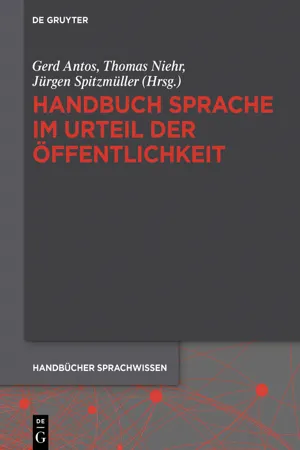Der Titelformulierung folgend soll in diesem einleitenden Abschnitt mit Blick auf die sog. Globalisierung das sprachideologische Konzept der Anglisierung des Deutschen dargestellt werden. Weiterhin werden sechs sprachpuristische Phasen und vier Diskurstypen charakterisiert, deren kritische Betrachtung im Zentrum der folgenden Abschnitte dieses Artikels steht.
1.1 Globalisierung
In der sprachpuristischen Diskussion zu Beginn der Jahrtausendwende haben Sprachkritiker erstmals einen Zusammenhang zwischen der ‚Globalisierung‘ und der ‚Anglisierung‘ des Deutschen und anderer Sprachen hergestellt (vgl. bspw. Raeithel 2000, Krischke 2001; für einen Überblick Spitzmüller 2005a, 289‒291). Dabei war zumeist unspezifisch vom (anfangs meist fatalistisch als ‚unaufhaltsam‘ betrachteten) „Zeitalter der Globalisierung“ (vgl. zu dieser Kollokation weiter unten) die Rede, welches den aus Sicht der Puristen unerwünschten Sprachwandel (mit)bedinge, ohne dass genauer ausgeführt wurde, was mit Globalisierung gemeint ist. Dies schien als bekannt vorausgesetzt zu werden. Dabei ist Globalisierung alles andere als ein klar zu bestimmendes Konzept. Wie unter anderem Kessler/Steiner (2009, 35) feststellen, ist es „bisher nicht gelungen [...], einen Konsens über seine Bedeutung zu erzielen“, weshalb der Begriff zumindest als Fachterminus problematisch sei. Ähnlich hält auch Schroer (2013, 503) fest:
Der Begriff gehört nicht nur zu den schillerndsten und anregendsten Begriffen, mit denen die Sozialwissenschaften sich je auseinandergesetzt haben, sondern auch zu den streitbarsten und widersprüchlichsten. Was damit im Einzelnen gesagt werden soll, kann in den vielen miteinander konkurrierenden Deutungsangeboten durchaus unterschiedlich ausfallen. Fest steht nur, dass die Vokabel Globalisierung geradezu allgegenwärtig ist.
Allgegenwärtig ist die Vokabel nicht nur im fachlichen, sondern auch im massenmedialen Alltagsdiskurs. Und dort wird sie auch wesentlich geprägt. Das heißt, was Globalisierung ‚ist‘, wissen wir vor allem durch massenmediale Beschreibung und Setzung, „weil man es uns unablässig [in den Medien; F.P.] mitteilt“ (Teubert 2007, 22). Globalisierung ist also zu wesentlichen Teilen ein diskursives Faktum und Konstrukt. Daher sollen zunächst exemplarisch zwei massenmediale Definitionen von Globalisierung betrachtet werden (vgl. für weitere bspw. Teubert 2002, Hermanns 2003 und die Beiträge in Wengeler/Ziem 2007).
Wikipedia (2014) definiert Globalisierung als einen Vorgang, bei dem
[...] internationale Verflechtungen in vielen Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation) zunehmen, und zwar zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten.
In einem ganz ähnlichen Sinne, wenn auch deutlich detaillierter, definiert die Brockhaus Enzyklopädie Online (2014):
Globalisierung, komplexer Begriff für mehrere zusammenhängende, aber unterscheidbare Strukturveränderungen des internationalen Systems aufgrund einer vertieften weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, Spezialisierung, Integration und Vernetzung, einer zunehmenden politischen Interdependenz sowie einer verstärkten kulturellen Durchdringung von bislang national geprägten Gesellschaften. Die Globalisierung ist eng mit der technologischen Entwicklung verbunden und stellt einen evolutionären Prozess dar, der auf mehreren interagierenden Triebkräften beruht.
In diesen Definitionen wird Globalisierung dargestellt als ein vor allem ökonomischer Prozess mit faktischer Wirkkraft. Globalisierung lässt sich aber auch als ein perzeptives Phänomen auffassen, als ein diskursiv hergestellter „Erwartungsbegriff“ (Hermanns 2003: 411) mit kontingenzreduzierender (simplifizierender) Funktion. Dies hat Hermanns (2003) in seiner Übersicht zum Globalisierungsbegriff als „brisantem“ diskursivem (und diskursordnendem) Konzept gezeigt. Er weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Frequenz des Ausdrucks vor allem ab Mitte der 1990er-Jahre in den Medien drastisch zunimmt, und dass sich dabei auch die Semantik des Begriffs deutlich verändert: Globalisierung entwickelt sich von einem ökonomischen „Fahnenwort“ immer mehr zu einem „brisanten Wort“, das als vages Erklärungsetikett für alle (und zunehmend vor allem die unerwünschten) als supranational eingeschätzten Entwicklungen dient und dabei Handlungs- (und das heißt vor allem Gegenhandlungs-)Erwartungen zum Ausdruck bringt (vgl. ähnlich auch Liebert 2003).
Ein Blick in aktuelle Referenzkorpora bestätigt dies. So vermittelt eine Recherche nach dem Term globali* im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo, Teilkorpus W-öffentlich) des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) hinsichtlich der quantitativen Entwicklung folgendes Bild: Von 1985 bis 1990 tritt der Term nur ein- bis dreimal auf; bis 1995 kommt es dann zu einem sanften Anstieg bis auf 191; 1996 erfolgt ein Sprung auf 1.612; im Folgejahr geht es gar steil auf 4.467. Werte um die 4.000 haben wir bis zum Jahr 2000, ab dann beginnt ein sanfter Abstieg: bis hinunter zu 1.884 im Jahr 2004. Es folgt ein erneuter, allmählicher Anstieg bis auf ein Rekordhoch von 6.083 im Jahr 2011, nach welchem der Wert wieder auf 1.445 abfällt. Semantische Verschiebungen lassen sich über eine Analyse von Kollokationen ermitteln. So weist Storjohann (2007) in einer Analyse, die ebenfalls auf das DeReKo zurückgreift, nach, dass Globalisierung zunehmend signifikant häufig in der Nachbarschaft negativ besetzter Ausdrücken (wie Armut, Angst etc.) auftritt und aktuell vor allem negativ gerahmt ist.
Die statistisch signifikantesten Kollokationspartner von globali* im DeReKo sind übrigens Welt (in der/einer globalisierten [...] Welt) und das schon von Hermanns (2003, 412) diskutierte, oben erwähnte Zeitalter (im Zeitalter der Globalisierung). Dies zeigt eindrücklich, dass Globalisierung nicht nur ein Schlagwort im Sinne von Hermanns (1994) ist, welches kraft seiner deontischen Bedeutung massiv „auf die öffentliche Meinungsbildung (inclusive Willensbildung)“ einwirkt, sondern, wie auch Liebert (2003) zeigt, ein Schlüsselwort unserer Zeit – im Sinne einer „komprimierte[n] [und kontrovers diskutierten; F.P.] Antwort auf [...] gesellschaftliche Grundfragen“ (Liebert 2003, 67) und im Sinne eines Schlüssels zum Verständnis vieler rezenter gesellschaftlicher Debatten, zu denen die Debatte um die so genannte ‚Anglisierung‘ zweifellos zählt.
1.2 Anglisierung
Klagen über fremdsprachliche Einflüsse auf das Deutsche und Bestrebungen zur Eindeutschung von Fremdwörtern gibt es zumindest seit dem Mittelalter (vgl. z. B. Kilian/Niehr/Schiewe 2010, 22). Derzeit ist es vor allem der weltweite Einfluss des Englischen, durch den sich Sprachkritiker zum Handeln aufgerufen fühlen (wenn in diesem Artikel von Sprachkritikern bzw. Sprachkritik die Rede ist, so sind stets laienlinguistische Sprachkritiker und laienlinguistische Sprachkritik gemeint, also bewertende Betrachter und Betrachtungsweisen von Sprache und Sprachgebrauch, die nicht primär sprachwissenschaftlichen Interessen verpflichtet sind; vgl. dazu Kilian/Niehr/Schiewe 2010, 56).
Die so genannte ‚Anglisierung‘ des Deutschen wird in allen drei großen Sprachgebieten des Deutschen in Europa beklagt. So schreibt der Schweizer Sprachkreis Deutsch der Bubenberg-Gesellschaft (2005) auf seiner Internetseite:
Die Dominanz der Sprache der hegemonialen Supermacht (US-Englisch) als ‚lingua franca‘ befördert die weltweite ‚McDonaldisierung‘ und bedroht damit andere Sprachen. Einem ‚English-only-Europa‘ mit einer weiteren kulturellen Amerikanisierung muss eine alternative Sprachenpolitik mit neutralen Lösungen entgegengesetzt werden, die Multikulturalität und Sprachenvielfalt in Europa sichert.
Auch der stellvertretende Obmann der österreichischen Interessengemeinschaft Muttersprache Graz, Gerhard Kurzmann, kritisiert die „geradezu fatale[...] ‚Anglisierung‘ des Deutschen“ und fordert:
Es ist hoch an der Zeit, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und der sprachlichen ‚McDonaldisierung‘ unserer Sprache, wenn nötig auch mit Sprachgesetzen nach französischem Vorbild, entgegenzutreten. (Kurzmann 2003)
Deutschlands größter privater Sprachverein ist der Verein Deutsche Sprache (VDS) mit einer Mitgliederzahl von „derzeit [= 2014; F.P.] 36.000 Menschen aus nahezu allen Ländern, Kulturen, Parteien, Altersgruppen und Berufen“. Der 1997 gegründete Verein hat sich das Ziel gesetzt, das Deutsche „vor dem Verdrängen durch das Englische zu bewahren“ und „der Anglisierung der deutschen Sprache entgegen[zu]treten“ (VDS 2014d). In der Ausgabe 2014 des vom VDS jährlich neu aufgelegten Anglizismen-Index beklagt Keck (2013, 278) „die Verballhornung der deutschen Sprache durch unnötige Anglizismen“ und stellt heraus:
‚Amerikanisierung‘ ist nicht mehr und nicht weniger als ein anderer Ausdruck für ‚Kulturimperialismus US-amerikanischer Prägung‘. Die weitverbreitete Verwendung von Anglizismen ist der sprachliche Ausdruck eben jener Amerikanisierung, die den deutschsprachigen Raum voll erfasst hat. [...] im Großen und Ganzen lassen wir uns bereitwillig – und nicht zuletzt auch sprachlich – disneyfizieren, cocakolonisieren [sic!] und mcdonaldisieren. (Keck 2013, 279)
Als Symptom des Anglisierungsprozesses wird vor allem eine subjektiv wahrgenommene Zunahme von ‚Fremdwörtern‘ – vor allem von ‚Anglizismen‘ – im Deutschen benannt, wobei allerdings zumeist nicht expliziert wird, was darunter konkret verstanden wird (vgl. Spitzmüller 2005a, 173–176; Pfalzgraf 2006, 74). Insgesamt ist der Begriff jedoch enger gefasst als in der Linguistik, wo unter Anglizismen in der Regel alle lexikalischen Phänomene gefasst werden, die durch Sprachkontakt zum Englischen geprägt sind (vgl. die Definition des Anglizismen-Wörterbuchs: „aus oder nach englischem Vorbild entstandene freie und gebundene Morpheme, Komposita und Mehrwortlexeme“; Busse 2001, *66). Im neopuritischen Diskurs ist der Ausdruck in der Regel auf formal (graphematisch und oder phonologisch) saliente Entlehnungen beschränkt.
Bezüglich einer angeblich stattfindenden ‚Anglisierung‘ bzw. ‚Amerikanisierung‘ des Deutschen wird, wie die obigen Zitate bereits gezeigt haben, auch häufig von einem US-amerikanischen Kulturimperialismus und einer McDonaldisierung der Sprache und Kultur gesprochen (vgl. detailliert dazu Ritzer/Stillmann 2003). Damit werden Zusammenhänge zwischen sprachlicher ‚Anglisierung‘ und kulturell-wirtschaftlicher ‚Amerikanisierung‘, ‚Globalisierung‘ und ‚McDonaldisierung‘ hergestellt. Nicht selten wird angenommen, dass es sich hierbei um eine gewollte ‚Amerikanisierung‘, eine Art zielgerichteten ‚Kulturimperialismus‘ handelt. ‚Anglisierung‘ (als angeblich stattfindender sprachlicher Prozess) gilt somit nur als Teil (und Symptom)...