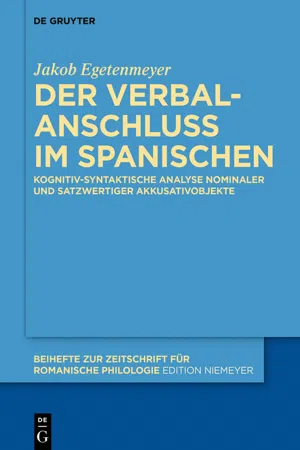1 Problemstellung
Im Spanischen1 finden sich zwei syntaktische Strukturen, die bei gleichen funktionalen Verhältnissen jeweils zwei formale Realisierungsmöglichkeiten aufweisen, das verbal regierte Akkusativobjekt und der Objektsatz. Die Frage, welche Unterschiede, insbesondere welche semantischen Unterschiede jeweils mit den beiden Realisierungen einhergehen, bzw. ob überhaupt Unterschiede vorhanden sind, wird in der Forschung vielfältig diskutiert. Bisher ist keine konsensfähige Antwort gefunden worden. Die beiden Strukturen lassen sich wie folgt exemplifizieren.
Erstens ist im Spanischen zwischen einem Verb und einem von ihm regierten nominalen Akkusativobjekt das Auftreten des Markers a möglich. Der Marker kann aber auch ausbleiben. Das Phänomen wird nach Bossong (1982) als differentielle Objektmarkierung bezeichnet. Das folgende Beispielpaar veranschaulicht es.
[1] Voy a despertar a vuestro padre. (COA:023.14)
‘Ich werde euren Vater wecken.’
[2] Coge las flores de la mesa y se las vuelve a prender en el pecho. (HOT:069.04)
‘Sie nimmt die Blumen vom Tisch und befestigt sie von Neuem an ihrer Brust.’
In Beispiel [1] tritt das Element a auf, in [2] hingegen nicht. Beide Objekt-NPs (vuestro padre, ‘euren Vater’, und las flores, ‘die Blumen’) sind definit realisiert. Sie teilen die Eigenschaft, dass sie im betreffenden Diskurs als bekannt vorausgesetzt werden. Ein klarer semantischer Unterschied besteht darin, dass das erste Objekt eine menschliche, das zweite jedoch eine unbelebte Entität denotiert. Dass der Gegensatz ‘belebt’ vs. ‘unbelebt’ keine ausreichende Erklärung darstellen kann, zeigen jedoch die folgenden Beispiele.
[3] BEGOÑA.- Una cena. Hay que darle una cena. […] ¿Por qué no matamos la vaca Marela? (HOT:046.09)
‘BEGOÑA: «Ein Abendessen. Man muss ein Abendessen für sie ausrichten. Warum schlachten wir nicht die Kuh Marela?»’
[4] Hoy […] llama la atención la falta de cautela con que se insultaba a un país cuyo primer mandatario, el Presidente Eisenhower, había de desfilar pocos años más tarde por las calles de Madrid junto al general Franco […]. (USO:029.34)
‘Heute fällt der Mangel an Vorsicht auf, mit dem man ein Land beleidigte, dessen Staatsoberhaupt, der Präsident Eisenhower, wenige Jahre später neben General Franco durch die Straßen Madrids defilieren würde.’
In [3] wird ein Objekt (la vaca Marela, ‘die Kuh Marela’) mit tierischem Denotat, das ebenfalls definit realisiert und als bekannt vorausgesetzt ist, nicht markiert. In [4] denotiert das Objekt hingegen ein Abstraktum (un país, ‘ein Land’), das zudem indefinit, wenn auch spezifisch ist. Es wird aber a-markiert. Insbesondere das Ausbleiben der a-Markierung in [3] stellt vorhandene Ansätze vor Schwierigkeiten.2
Zweitens sind auch bei spanischen Akkusativobjektsätzen zwei Realisierungen möglich. Der verbal regierte Objektsatz kann mit einer Konjunktion und einem finiten Verb auftreten (s. [5]) oder ohne Konjunktion und infinit realisiert sein (s. [6])
[5] –Estaba pensando que no entiendo a los hombres –dijo ella. (LAB:116.26)
‘«Ich dachte gerade, dass ich die Männer nicht verstehe», sagte sie.’
[6] Yo me quedo. Pienso pasar aquí todo el invierno. (CAR:155.05)
‘Ich bleibe da. Ich habe vor, den ganzen Winter hier zu verbringen.’
In dem Beispielpaar mit satzwertigen Objekten zeigt sich ein deutlicher semantischer Unterschied. Das lexikalisch gleiche Matrixverb bringt jeweils unterschiedliche Sachverhalte zum Ausdruck.3 In [5] bedeutet es ‘denken’, in [6] jedoch ‘vorhaben’. Auch in den folgenden beiden Beispielen mit infinitem (s. [7]) und finitem (s. [8]) Nebensatz tritt das gleiche Matrixverb auf. Eine Bedeutungsdivergenz scheint aber nicht gegeben zu sein.
[7] El regidor melidense afirma sentirse muy satisfecho y orgulloso por haber tomado parte en esta expedición […]. (1VO:038–1.1–03)
‘Der Stadtrat Melillas gibt an, sich sehr zufrieden und stolz zu fühlen, an dieser Reise teilgenommen zu haben.’
[8] Un estadounidense acusado de asesinato afirma que lo preparó como «una película» (2VO:017–4.0–03)
‘Ein des Mordes angeklagter US-Amerikaner gibt an, dass er den Mord wie einen Film vorbereitete (oder: vorbereitet hatte).’
Das Hauptverb afirmar (‘angeben’) in [7] und [8] weist die gleiche Bedeutung auf. Die Korrelation der Bedeutungsdivergenz beim Matrixverb mit der unterschiedlichen Realisierung des Objektsatzes der zuvor präsentierten Beispiele ist also nicht generalisierbar. Vor dem Hintergrund gehen Delbecque/Lamiroy (1999, 2027 mit Verweis auf Alcina Franch/Blecua 1975, 976) davon aus, dass es sich bei der finiten und der infiniten Objektsatzrealisierung nach afirmar und verschiedenen weiteren Matrixverben um freie Varianten handelt. Das erfasst die sprachlichen Fakten jedoch nicht (cf. etwa Bolinger 1968, 127 für die Erwartung, dass mit einer divergenten Form ein Bedeutungsunterschied einhergeht). Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass Haupt- und Nebensatz in [7] auf den gleichen Zeitpunkt oder -raum Bezug nehmen, in [8] jedoch auf unterschiedliche. Es gibt also einen Unterschied. Allerdings ist er in der Formulierung keineswegs verallgemeinerbar.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Unterschiede, die mit den voneinander abweichenden Formen auf konzeptueller Ebene einhergehen, herauszuarbeiten und einheitlich zu systematisieren. Der Erklärungsansatz soll sowohl für verbal regierte nominale als auch für verbal regierte satzwertige Akkusativobjekte Gültigkeit haben. Es soll jeweils ein geeignetes Subset an Strukturen möglichst umfassend beschrieben werden. Als entscheidender Faktor wird die Komplexität angesetzt. In Anlehnung an Givón (2009a, 1s. mit Verweis auf Simon 1962) wird sie als Menge strukturierter Information definiert. Die sprachliche Form wird auf der Grundlage eines Ikonizitätsansatzes aus der konzeptuell-semantischen Ebene heraus motiviert.
1.1 Gegenstand der Arbeit
Die vorliegende Arbeit behandelt die verbale Rektion von Nominalobjekten und Objektsätzen auf eine neue Weise. Sie zielt auf eine Beschreibung nach einheitlichen Prinzipien ab. Ihr Interesse gilt der differentiellen Objektmarkierung sowie der Finitheits-Infinitheits-Opposition bei Objektsätzen. Die jeweils oppositiven formalen Realisierungsmöglichkeiten der beiden Strukturen sollen erklärt werden. Vor dem Hintergrund des Ikonizitätsgedankens aus der funktionalen Grammatik werden sie aus der konzeptuell-semantischen Ebene heraus motiviert. Als Faktor, der die einheitliche Beschreibung ermöglicht, wird Komplexität angesetzt.
Da die formalen Gegebenheiten leicht zugänglich sind, ergibt sich ein deskriptiver Fokus auf die konzeptuellen Eigenschaften der Strukturen. Es werden ausführlich relevante Parameter der Komplexität besprochen. Wie sich zeigt, sind sie graduierbar. Die Ausprägungen der Komplexitätsparameter werden hierarchisiert. z. T. können dafür vorhandene Skalen verwendet und bzw. oder verfeinert werden, teilweise werden neue erstellt. In einem weiteren Schritt wird ein in den Skalen angelegtes binäres System herausgearbeitet, womit auch der Abgleich mit der zweigliedrigen formalen Opposition möglich wird (cf. für einen ganz ähnlichen Gedanken in einem etwas anderen Rahmen Giorgi/Pianesi 1997, Kap. 5).
Die gemeinsame Behandlung der beiden unterschiedlichen Strukturen wird legitimiert durch das Vorhandensein v. a. dreier paralleler Eigenschaften: In ihnen tritt ein Verb auf, das eine angeschlossene sprachliche Einheit regiert. Die nominal oder satzwertig realisierte angeschlossene Einheit erfüllt in beiden Strukturen die Funktion eines Akkusativobjekts. Der dritte Punkt besteht aus den besprochenen oppositiven Realisierungsmöglichkeiten, die bei beiden Strukturen vorhanden sind. Jedoch fallen auch zwei Divergenzen besonders auf. Aus ihnen ergibt sich die Motivation für eine gemeinsame Behandlung der beiden Strukturen.4 Erstens werden zwei unterschiedliche Einheiten, eine NP und ein Gliedsatz, an das Matrixverb angeschlossen. Damit geht zweitens einher, dass auch das Verhältnis zwischen Matrixverb und angeschlossener Einheit divergieren muss. Interessant ist nun, wie mit den Unterschieden umzugehen ist. Worin bestehen die divergenten Verhältnisse zwischen den Bestandteilen der Strukturen und wie weit muss das Beschreibungsinventar ausdifferenziert sein, um sie erfassen zu können? Die Frage impliziert die wichtige Feststellung, dass die einheitliche keine identische Behandlung sein darf. Die Bestimmung der konzeptuellen Komplexität muss für die beiden Strukturen jeweils individuell erfolgen. Für die nominalen Objekte wird eine einzelne, aber bifaktorielle Skala eingesetzt, die auf der Typen-Theorie aus Pustejovskys generativem Lexikon (1991a; 1995b; 2001) basiert. Der eine Faktor sind die Qualia, die auf Moravcsik (1975) zurückgehen. Der andere besteht in der ein- oder mehrfachen (d. h. komplexen) Typenrealisierung (s. Kap. 2.8). Es ist insbesondere der zweite Faktor, anhand dessen das Mapping zwischen Konzeptualisierung und Form möglich wird. Die typenbasierte Skala erfasst die Konzeptualisierung aller nominalen Objekte in ihrer Einbettung unter das Verb. Für die Beschreibung der satzwertigen Objekte sind hingegen mehrere Komplexitätsparameter nötig, die sich in drei Domänen strukturieren lassen. Es werden die Sachverhalts-, die temporale und die Domäne des Weltbezugs berücksichtigt. Innerhalb der Domänen werden Skalen erarbeitet, die auch anderweitig nutzbar sind. Das für das Mapping nötige binäre Verhältnis wird anhand eines in allen drei Domänen anwendbaren Merkmals vorgenommen, der Eigenständigkeit innerhalb der Domänen. Wie eingehend gezeigt wird, ist Komplexität die den vielschichtigen Ansatz einende Eigenschaft. Dennoch wird in Kap. 6 die Frage noch einmal gezielt aufgegriffen, worin letztlich die deskriptiven Gemeinsamkeiten bestehen.
Die Applizierung des Beschreibungssystems wird anhand eines repräsentativen Ausschnitts der spanischen Verbalrektion umfassend vorgestellt, wobei auch die Relevanz des Faktors der Komplexität eingängig belegt wird. Die Okkurrenzen der Korpusuntersuchung, sowohl typische Fälle als auch solche mit geringer Frequenz, lassen sich mit sehr weitgehender Vollständigkeit erklären. Der hier vertretene Ansatz setzt sich so von anderen ab, die entweder bei einer ganzheitlichen Herangehensweise einige Okkurrenzen unerklärt lassen oder aber von vornherein nur Okkurrenzen mit bestimmten Merkmalen berücksichtigen.
Für die umfassende Behandlung der Strukturen müssen auch die regierenden Verben mit in den Blick genommen werden. Sie werden hinsichtlich diverser Facetten detailliert beschrieben. Ihre Relevanz für die Realisierungsoppositionen wird in Abgrenzung von der betreffenden Forschungsliteratur diskutiert. Wie sich zeigt, ergeben sich für lexikalische Gruppen von Verben grundsätzlich deskriptiv relevante Tendenzen, besonders bei den Nominalobjekten aber keine einheitlichen Korrelationen. Nichtsdestotrotz wird die Systematik des Analysekapitels zur differentiellen Objektmarkierung an ihnen ausgerichtet, da das methodische Vorteile bietet. Durch die eingehende Behandlung leistet die Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Beschreibung von Verben, insbesondere in Hinblick auf ihre transitiven Eigenschaften.
1.2 Besonderheiten und Relevanz der Arbeit
Der theoretische Rahmen der vorliegenden Arbeit verbindet verschiedene Ansätze zu einer in unterschiedlicher Hinsicht neuen Theorie. Das Beschreibungssystem und die Ausgestaltung zentraler Bestandteile sind eigenständig. Einige wichtige Besonderheiten der Arbeit sollen im Folgenden überblicksartig vorgestellt werden.
Als erste Besonderheit ist zu wiederholen, dass im Rahmen der Arbeit zwei unterschiedliche Strukturen umfassend und nach einheitlichen Prinzipien beschrieben werden. Der erarbeitete theoretische Ansatz präsentiert Komplexität als zentrales abstraktes Merkmal. Sie wird als Menge strukturierter Information definiert (cf. Givón (2009a, 1s. nach Simon 1962) und, da sie den Ikonizitätsgedanken der funktionalen Grammatik zugrunde legt, auf formaler sowie insbesondere auf semantisch-konzeptueller Ebene bestimmt. Die konzeptuelle Komplexität wird hierarchisierend gerankt, was als wichtige Besonderheit der vorliegenden Arbeit hervorzuheben ist. Es werden dabei verschiedene Skalen verwendet, etwa für die Nomen eine in der Typen-Theorie Pustejovskys (2001) angelegte. Sie werden z. T. leicht verfeinert, t...