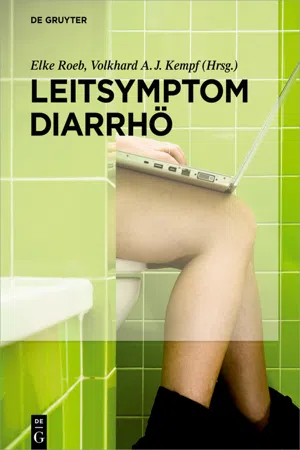1.1 Historisches
In den Forschungen zur Medizingeschichte steht
„Für den Durchfall: Der den Durchfall hat, der nehme Schafslunge und lege diese in einen Wein drei Tage und wärme es dann und trinke es nüchtern.“ [1].
Seither hat sich die Diagnostik und Therapie der Durchfallerkrankungen grundlegend geändert. In DER SPIEGEL Ausgabe 6/1970 war zu lesen:
Athleten im olympischen Mexiko nannten die Unpässlichkeit „Tanz der Azteken“ oder auch „Montezumas Rache“. Touristen in Fernost fürchten sich in den ersten Urlaubstagen vor dem „Hongkong-Hund“ und nahezu jeder zweite der neuangekommenen GIs in Vietnam fühlte, dass seine Kampfkraft anfänglich durch „los Revanche“ vermindert werde. So phantasievoll lauten die Bezeichnungen, die Sportler und Touristen, Soldaten und weltläufige Manager einer zwar harmlosen, aber beschwerlichen Erkrankung gaben; fast jeder dritte aller Reisenden in südliche Länder ist ihr hilflos ausgeliefert: der Diarrhö (dem Durchfall). So wird der Durchfall, ein bekanntes und unangenehmes Symptom, weltweit mit geistreichen Begriffen tituliert.
Kurz vor Publikation des Spiegelartikels entdeckten englische Wissenschaftler um Bernhard Rowe aus dem Zentral-Laboratorium für Öffentliche Gesundheit in London einen neuen Bakterienstamm [2]. Die Bedeutung von Escherichia coli (E. coli) als Ursache einer Reisediarrhö wurde erstmals am Diarrhö Ausbruch bei britischen Soldaten verursacht durch den Stamm E. coli 0148 beschrieben, einem Keim, der nicht zu den klassischen enteropathogenen Serotypen gehörte [2]. Durch eine Ausweitung der diagnostischen Methoden gelang dann George Morris der Nachweis, dass enterotoxische E. coli eine weitaus häufigere Ursache der Reisediarrhö darstellen als die klassischen Erreger wie z. B. Salmonellen, Shigellen oder Entamöben [3]. Aber erst das Next-Generation Sequencing (NGS), die bioinformatische Datenanalyse und die entsprechende Interpretation haben es ermöglicht, die Ursachen einer Diarrhö in großem Maßstab zu identifizieren und zu analysieren [4]. In Kap. 3 und Kap. 17 werden die modernen diagnostischen Routine- und Spezialmethoden ausführlich beschrieben. Der Reisediarrhö ist ein eigenes Kap. 5 gewidmet.
1.2 Definition der WHO
Diarrhö, d. h. Durchfall wird nach der World Health Organisation (WHO) als weicher bzw. flüssiger Stuhlgang dreimal pro Tag (oder häufiger als normal für das jeweilige Individuum) definiert [5]. Diarrhö ist in aller Regel ein Symptom einer gastrointestinalen Infektion, die durch eine Vielzahl von bakteriellen, viralen und parasitären Organismen verursacht werden kann. Die zugrundeliegende Infektion wird durch kontaminierte Lebensmittel oder Trinkwasser oder von Person zu Person durch unzureichende Hygiene übertragen. Starke Diarrhöen führen zu Flüssigkeitsverlust und können lebensbedrohlich sein, vor allem bei kleinen Kindern (siehe auch Kap. 13) und Menschen, die unterernährt sind oder eine Beeinträchtigung ihres Immunsystems aufweisen (siehe Kap. 12). Die WHO befasst sich seit fast 20 Jahren intensiv mit dem Krankheitsbild, den Ursachen und den therapeutischen Möglichkeiten der Diarrhö [6].
Weltweit machen Pneumonien und Diarrhöen zusammen ca. 29 % aller pädiatrischen Todesfälle aus, das sind mehr als zwei Mio. Kinder pro Jahr. Kinder, die in armen oder abgelegenen Gemeinden leben, sind am meisten gefährdet. Dies bedeutet, dass Kinder an prinzipiell vermeidbaren Krankheiten sterben, weil wirksame Interventionen und Präventionen nicht flächendeckend greifen. Der integrierte „Globale Aktionsplan zur Prävention und Bekämpfung von Pneumonie und Durchfall (GAPPD)“, der von der WHO/UNICEF initiiert wurde, hat erkannt, dass die einzige Möglichkeit, diese beiden vermeidbaren Krankheiten zu bekämpfen, darin besteht, sie in einem integrierten und kombinierten Ansatz anzugehen [7].
Bereits jetzt sind wirksame Interventionen bekannt, z. B. konsequentes Stillen bis zu sechs Monate nach der Geburt, Impfstoffe, Händewaschen, Trinkwasserbereitstellung – um nur einige wirkungsvolle Therapieansätze zu nennen. Zur Vermeidung von Todesfällen, müssen die am stärksten betroffenen Kinder Zugang zu diesen Interventionen haben. Der GAPPD-integrierte Ansatz soll die Zahl der kranken Kinder unter fünf Jahren bzw. deren Tod durch effizientere und effektivere Nutzung von knappen Gesundheitsressourcen reduzieren. Das erklärte Ziel des GAPPD ist es bis zum Jahr 2025 die Todesrate durch Pneumonie unter drei von 1000 Lebendgeburten und durch Diarrhö unter 1 von 1000 Lebendgeburten zu senken [7].
Nach dem Fact sheet on diarrhoeal disease, aktualisiert laut WHO im Mai 2017 [8], gilt:
- –
Diarrhö ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern unter fünf Jahren. Sie ist sowohl vermeidbar als auch behandelbar.
- –
Jedes Jahr sterben durch Diarrhöen etwa 525.000 Kinder unter fünf Jahren.
- –
Ein signifikanter Anteil der Diarrhöen kann durch sicheres Trinkwasser und ausreichende Hygiene verhindert werden.
- –
Weltweit gibt es fast 1,7 Milliarden Fälle von kindlicher Diarrhö pro Jahr.
- –
Diarrhö ist eine führende Ursache für Unterernährung bei Kindern unter fünf Jahren.
Diarrhö ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern unter fünf Jahren. Jährlich sterben rund 525.000 Kinder an Diarrhö. Die Erkrankung kann mehrere Tage andauern und sowohl eine Dehydratation als auch einen Verlust lebensnotwendiger Elektrolyte verursachen. In der Vergangenheit waren schwere Dehydratation und Flüssigkeitsverlust die Hauptursachen für Todesfälle infolge von Diarrhö. Aktuell führen andere Ursachen wie Septikämien infolge bakterieller Infektionen die Liste an. Unterernährte Kinder oder Immunsupprimierte, sowie HIV infizierte Menschen sind die am stärksten gefährdeten Personen [8].
In Deutschland wird die Diarrhö als das Absetzen von drei oder mehr weichen oder flüssigen Stuhlgängen pro Tag definiert [9]. Häufiges Absetzen von geformten Stühlen ist somit ebenso kein Durchfall wie der Übergang von weichen zu „pastösen“ Stuhlgängen gestillter Neugeborener. Diarrhö ist in der Regel ein Symptom einer Infektion im Darmtrakt, die durch eine Vielzahl von bakteriellen, viralen und parasitären Organismen verursacht werden kann. Auch in Deutschland wird die Infektion vorwiegend durch kontaminierte Lebensmittel, Trinkwasser oder von Mensch zu Mensch infolge mangelnder Hygiene verbreitet [8]. Interventionen zur Vermeidung von Diarrhö, einschließlich der Bereitstellung sauberen Trinkwassers, einer verbesserten Hygiene und Handwäschen mit Seife kann das Krankheitsrisiko reduzieren. Diarrhö sollte mit oraler Rehydratationslösung (ORS) behandelt werden, einer Lösung von sauberem Wasser, Zucker und Salz. Eine 10–14 tägige ergänzende Behandlung mit Zinktabletten verkürzt die Diarrhödauer und verbessert die Ergebnisse [8]. Die Kap. 18, 19 und 20 beschäftigen sich intensiv mit unterschiedlichen therapeutischen Möglichkeiten, z. B. durch Ernährung, Probiotika, Mikrobiota, Antibiotika und therapeutische Impfstoffe.
1.3 Leitlinien zur Diarrhö
Das Krankheitsbild und Symptom Diarrhö wird in zahlreichen internationalen Leitlinien sowie in den Rom-III-Konsensuskonferenzen behandelt [10]. Viele der diagnostischen und therapeutischen Algorithmen aus dem europäischen und amerikanischen Ausland sind allerdings mit Blick auf die konkrete Anwendbarkeit in Deutschland nur eingeschränkt nutzbar. Im weiteren Verlauf wird daher vorwiegend auf die Leitlinien fokussiert, die mit den Patientenpfaden, Diagnosewegen und verfügbaren Therapien des deutschen Gesundheitssystems kompatibel sind.
1.3.1 ACG clinical guideline
Aktuelle evidenzbasierte Ansätze zur Diagnose, Behandlung und Prävention bei Diarrhö von Erwachsenen wurden 2016 von der ACG publiziert [11]. Weltweit sind akute Durchfall-Infektionen ein häufiges gesundheitliches Problem insbesondere bei Reisen in Entwicklungsländer (siehe auch Kap. 4 und 5).
1.3.2 Clostridioides difficile
Clostridioides difficile Infektionen (CDI) sind eine führende Ursache für Krankenhaus-assoziierte gastrointestinale Erkrankungen und stellen eine hohe Belastung für unser Gesundheitssystem dar. Patienten mit CDI haben in der Regel eine verlängerte Liegezeit in Krankenhäusern, und CDI stellt eine häufige Ursache für nosokomiale Infektionen dar [12]. Die CDI Leitlinie von 2013 gibt Empfehlungen für die Diagnose und das Management von CDI sowie zur Prävention und Kontrolle von Ausbrüchen. Neue molekulardiagnostische Stuhltests (z. T. in Kombination mit ELISA-basierten Antigen-Nachweisverfahren) werden die derzeitigen Enzym-Immunoassays-Tests ersetzen [12].
1.3.3 Reisediarrhö
Um den aktuellen Stand des Wissens über die Ätiologie, die Risikofaktoren, die Prävention und das Management der sogenannten Reisediarrhö zu überprüfen hat das WHO Collaborating Centre for Travellers’ Health der Universität in Zürich mit einem internationalen Autorenteam fast 3.000 Artikel durchsucht, von denen letztendlich 122 als geeignet eingestuft wurden und in einen Übersichtsartikel einflossen [13]. Die Autoren kommen zum Schluss, dass die Reisediarrhö auch weiterhin ein generelles Problem für Reisende darstellt. Personen, die in gefährdete Länder reisen wollen, sollten in Bezug auf Präventionsmaßnahmen beraten werden und entsprechende Medikamente zur Selbstbehandlung vorhalten [13].
1.3.4 Deutsche Leit- und Richtlinien
Verlässliche internationale Daten zur Häufigkeit einer chronischen Diarrhö fehlen. Man geht davon aus, dass drei Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Während die akute Diarrhö eine sich meist selbst limitierende Erkrankung ist, ist für die Beendigung einer chronischen Diarrhö – also einer über vier Wochen hinausgehenden Erkrankung – oft eine spezifische Therapie notwendig. Die Therapie hängt entscheidend von einer sicheren Diagnose ab wie Lankisch und Co-Autoren 2006 im Deutschen Ärzteblatt formulierten, ein klinischer Pfad für eine schnelle und effiziente Diagnostik bei akuter und chronischer Diarrhö [14]. Neben den erregerbedingten Diarrhöen gehen wir in diesem Buch auch auf die funktionellen Diarrhöen (Kap. 15) und die durch häufige innere Erkrankungen (z. B. chronische entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, mikroskopische Kolitis, nahrungsmittelbedingte Diarrhöformen, endokrine Störungen, chronische Pankreatitis) ausgelösten Diarrhöformen ein (siehe Kap. 6, 7, 8, 9, 10, 14). Nicht zu vergessen sind die Formen, in denen Pharmaka (Kap. 11) und frühere medikamentöse Therapien (Kap. 16) die Diarrhö verursachen.
Die deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin hat unter dem AWMF Register Nr. 053/030 eine S1 Leitlinie zu „Akuter Durchfall (Epidemiologie, diagnostische und therapeutische Empfehlungen)“ mit einem 1-seitigen Behandlungsalgorithmus herausgegeben [15].
1.3.5 S2k Leitlinie Gastrointestinale Infektionen und Morbus Whipple
Vor dem Hintergrund der Häufigkeit aber auch der Bandbreite von blanden, selbst-limitierenden Verläufen bis hin zu vital bedrohlichen Infektionen ist ein evidenzbasiertes Vorgehen in der Diagnostik und Therapie gastrointestinaler Infektionen notwendig, um den Patientenbedürfnissen gerecht zu werden, aber auch um die zur Verfügung stehenden Ressourcen adäquat einzusetzen. Aufgrund dessen hat sich die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS) entschlossen, eine S2k Leitlinie zu erstellen, die diesem wachsenden Problem Rechnung trägt [16]. Andreas Stallmach und Ansgar Lohse befassten sich als Koordinatoren mit den Themenfeldern [16]
- –
Diagnostik der ambulant erworbenen Gastroenteritis
- –
klinisches Bild und Therapie der ambulant erworbenen Gastroenteritis
- –
nosokomiale Diarrhö und Clostridioides difficile
- –
Diarrhö bei Immundefizienz
- –
akute Gastroenteritis bei Reiserückkehrern
- –
Morbus Whipple
2016 erschien die Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung, Information und Beratung im Rahmen der Selbstmedikation am Beispiel Durchfall [17]. Auch die Apothekenumschau, mit eine...