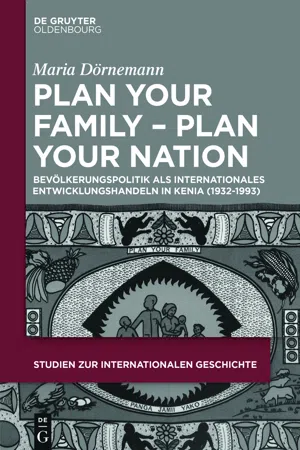
eBook - ePub
Plan Your Family - Plan Your Nation
Bevölkerungspolitik als internationales Entwicklungshandeln in Kenia (1932-1993)
- 366 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Plan Your Family - Plan Your Nation
Bevölkerungspolitik als internationales Entwicklungshandeln in Kenia (1932-1993)
Über dieses Buch
Die Vorstellung einer "Bevölkerungsexplosion" in der "Dritten Welt" entstand am Übergang von Kolonial- und Imperialpolitik zur internationalen Steuerung von Entwicklungsprozessen. Maria Dörnemann untersucht auf dieser Grundlage die Konstruktion von Bevölkerung und damit verknüpfter politischer Praktiken in Kenia durch lokale, nationale und internationale Akteure für die lange Dauer der 1930er bis in die 1980er Jahre. Sie zeigt, inwiefern sich die Produktion bevölkerungspolitischen Wissens, deren Umsetzung in konkrete Programme und die Entwicklungsvisionen für Kenia zwischen ländlicher Entwicklung und Modernisierung wechselseitig bedingten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Plan Your Family - Plan Your Nation von Maria Dörnemann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & African History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Vom „leeren“ zum „überfüllten“ Raum: Die Entdeckung eines Bevölkerungsproblems in der Kolonie Kenia in lokalen und globalen Bezügen
Die Geschichte Kenias im Besonderen und die der so genannten Entwicklungsländer beziehungsweise der Dritten Welt im Allgemeinen seit den 1950er Jahren wird in der Historiographie nicht selten unter den Voraussetzungen einer „Bevölkerungsexplosion“ betrachtet. Der US-amerikanische Afrikahistoriker Daniel Branch bemerkt in seiner Geschichte Kenias für die Zeit nach der Unabhängigkeit: „The story of Kenyan politics after independence is the story of politics in a time of demographic explosion.“1 Allgemeiner erklärt Eric Hobsbawm in seiner Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts die „Bevölkerungsexplosion“ als ein für die „Existenz der Dritten Welt“ seit den 1950er Jahren konstitutives Faktum, so dass die „Betrachtung ihrer demographischen Struktur“ am Anfang „jede[s] Bericht[s] über diese Welt“ stehen müsse.2 In den beiden handbuchartigen Darstellungen erscheint diese „Bevölkerungsexplosion“ mithin als eine Realität, die die politischen Gestaltungsmöglichkeiten postkolonialer Staaten prägte und beeinflusste. Zugleich schien sie erst die Bedingungen geschaffen zu haben, unter denen die Dritte Welt als ein Raum entstand, der mit Attributen wie Rückständigkeit oder Ungleichheit in Relation zur Ersten Welt belegt und dessen Entwicklungspotentiale auch davon abhängig gemacht wurden, inwieweit das Bevölkerungswachstum eingedämmt werden könne.
Diese Wahrnehmung einer „Bevölkerungsexplosion“ und das prägende Potential, das ihr allenthalben für die gegenwärtige Verfasstheit der Welt zugeschrieben wurde und wird, hat jedoch selbst eine Geschichte. Für Kenia führen die Anfänge dieser Geschichte in die Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück, in der aus einem zuvor nicht als zusammenhängend definierten Territorium in Ostafrika eine europäische Siedlerkolonie im Herrschaftsgebiet des British Empire wurde. Aus imperialer Perspektive fand die Kolonisierung unter dem Eindruck statt, einen gleichsam leeren oder zumindest weitgehend unbesiedelten Raum zu besiedeln. Diese Perspektive veränderte sich noch vor der Unabhängigkeit Kenias im Jahr 1963. So lässt sich zwischen den 1930er und 1950er Jahren ein Prozess beobachten, in dem sich sowohl die imperiale als auch die internationale und afrikanische Perspektive auf Bevölkerung in Kenia wandelten. In dieser Zeit wurden die konzeptionellen Grundlagen gelegt, einen vormals als leer definierten Raum als überfüllt wahrnehmen zu können.
1.1 Die Konstruktion einer „rückständigen“ afrikanischen Bevölkerung in ethnischer Gestalt
„Kenya is a country in which people live“,3 stellte der englische Journalist John S. Roberts, der drei Jahre in Nairobi für den East African Standard gearbeitet hatte, 1967 fest. Die Betonung einer solchen Selbstverständlichkeit scheint erklärungsbedürftig. Sie illustriert, dass die afrikanischen Bewohner nicht im Vordergrund der Aufmerksamkeit standen, die der Kolonie Kenia von Großbritannien aus entgegengebracht wurde. Vielmehr richteten sich die Pläne zur Entwicklung des ostafrikanischen Territoriums im Zuge der britischen Kolonisierung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auf den Raum und nicht auf die dort lebenden Menschen. Gleichwohl resultierte aus diesem Entwicklungsdenken eine bestimmte Wahrnehmung und Konstruktion der afrikanischen Bevölkerung. Im Folgenden soll die Geschichte der britischen Kolonie Kenia, zugespitzt auf den Zusammenhang zwischen den Entwicklungsplänen für die Kolonie und der Konstruktion der afrikanischen Bevölkerung, skizziert werden. Im Anschluss daran wird eine in den 1930er Jahren im Entstehen begriffene internationale Ebene in den Blick genommen, auf der sich ein veränderter Blick auf demographisches Wachstum herauskristallisierte. Die Konsequenzen für die Konstruktion indigener Bevölkerungen in den Kolonien blieben aber vorerst die gleichen. Dies zeigt sich anhand des Aushandlungsprozesses um die Landverteilung zwischen britischen Siedlern und afrikanischen Bewohnern der Kolonie Kenia vor der Kenya Land Commission.
1.1.1 Die Kolonie Kenia als „leerer Raum“?
Die Kolonie Kenia entstand auf einem Teilgebiet des Territoriums, welches das britische Foreign Office als Erbe der bankrottgegangenen British East Africa Company am 1. Juli 1895 übernommen und als ostafrikanisches Protektorat zunächst dem britischen Generalkonsul von Sansibar unterstellt hatte.4 Im selben Jahr trat Joseph Chamberlain an die Spitze des Colonial Office. Seine koloniale Agenda war bestimmt von den strukturellen und sozialen Problemen Großbritanniens in dieser Zeit, insbesondere einer chronisch hohen Arbeitslosigkeit und dem Niedergang der stahlverarbeitenden Industrie.5 Vor diesem Hintergrund befürchtete er einen Machtverlust Großbritanniens gegenüber konkurrierenden Großmächten wie dem Deutschen Reich, den Vereinigten Staaten oder Russland.6 Er leitete daraus einen Entwicklungsimperativ für die Kolonien in den Tropen ab. Mit vielen anderen Publizisten und Politikern seiner Zeit teilte er die Ansicht, dass es sich hierbei um an Bodenschätzen und Rohstoffvorkommen überaus reiche Gebiete handeln würde, die jedoch vollkommen unerschlossen seien.7 Mithilfe der neuesten Errungenschaften in Wissenschaft und Technik, namentlich dem Eisenbahnbau, der Dampfschifffahrt und der Telegraphie, gelte es, das tropische Empire zu durchdringen und dessen Reichtümer und Ressourcen zugunsten Großbritanniens zu erschließen.
Der Bau der Uganda-Bahn in Ostafrika entsprach diesem technologisch gesättigten und auf den ökonomischen Wiederaufstieg Großbritanniens ausgerichteten Entwicklungsdenken. Es stellte sich jedoch alsbald heraus, dass die wirtschaftlichen Erwartungen an dieses 1901 fertiggestellte Projekt, welches den Küstenort Mombasa mit dem Viktoria-See im Landesinneren verband, völlig übertrieben waren.8 Denn es waren keine wertvollen Rohstoffe, insbesondere keine Mineralvorkommen entdeckt worden, die ursprünglich mithilfe der Bahn aus dem Landesinneren an die Küste hätten transportiert werden sollen. Zugleich hatte der Eisenbahnbau den britischen Steuerzahler viel Geld gekostet. Um die entstandenen Kosten zu neutralisieren, entwickelte die britische Kolonialmacht alternative Pläne zur wirtschaftlichen Erschließung des ostafrikanischen Protektorats. In Ermangelung von Rohstoffvorkommen schien Landwirtschaft der einzige Weg zu sein, einen florierenden Exporthandel zu ermöglichen, um einen ökonomischen Mehrwert für Großbritannien oder mindestens die finanzielle Autarkie der Kolonie zu gewährleisten. Insbesondere der zu dieser Zeit amtierende Gouverneur der Kolonie, Sir Charles Elliot, vertrat die Ansicht, dass eine wirtschaftlich profitable Landwirtschaft allein durch britische Siedler gewährleistet werden könne. Er setzte sich daher dafür ein, dass deren Einwanderung nach Ostafrika ab 1902 gefördert wurde.9
Die britische Besiedlung des ostafrikanischen Protektorats wurde auf eine im Rahmen der Kolonisierungspraxis des Empire gängige Argumentationslinie gestützt, nämlich auf die Vorstellung, einen leeren Raum zu kolonisieren.10 Hier entsprach die Definition eines leeren Raumes weniger einer quantitativen Erfassung der indigenen Einwohner, als dass sie die ökonomische Erschließung und Entwicklung des Raumes bewertete.11 Ob ein Raum als leer oder überfüllt definiert werden konnte, hing aus der Sicht der Kolonisatoren von der Fläche des angeblich brach liegenden oder landwirtschaftlich nicht adäquat in Wert gesetzten Landes ab.
Der politische Kontext in Großbritannien, in dem diese Vorstellung auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch eine Rolle spielte, war die Wahrnehmung verarmter, arbeitsloser und stetig wachsender Bevölkerungsmassen in den Städten des Landes. Einigen zeitgenössischen Beobachtern erschien die Besiedlung kolonialer Besitzungen als Lösung dieses Problems. Beispielsweise skizzierte der Engländer Edward Gibbon Wakefield in seinen Schriften zu Land und Empire, die 1829 im liberalen Morning Chronicle publiziert worden waren, dass diese in Großbritannien als „Bevölkerungsüberschuss“ definierten Menschen als Arbeitskraft für den Aufbau neuer Gesellschaften in den Kolonien benötigt werden könnten.12 Bezug nehmend auf Thomas Robert Malthus, der um die Wende zum 19. Jahrhundert eine Verbesserung der Lebensbedingungen für Arbeitslose und eine Lösung für das rasche Bevölkerungswachstum in den Städten nur dann für möglich hielt, wenn die Nachfrage nach landwirtschaftlicher Arbeit erhöht würde, schrieb Wakefield den Kolonien ein hohes ökonomisches Potential zu. Als Experimentierfeld diente ihm der Süden Australiens. Er veranlasste, dass das Land vermessen und an Einwanderer verkauft wurde. Ziel sollte sein, eine sich finanziell selbsttragende Kolonie auf der Grundlage eines Unternehmerkapitalismus einzurichten.
Hinter diesem Vorgehen stand das rechtliche Konstrukt der terra nullius, das es im Süden Australiens zu ermöglichen schien, 50 000 Jahre der Besiedlung dieses Landstrichs durch eine halbe Million Aborigines insofern zu ignorieren, als dass ihnen ein Recht auf Landbesitz abgesprochen wurde. Die dieser Vorstellung zugrunde liegende Argumentation wird in der Literatur bis ins Jahr 1629 zurückverfolgt, als der Gouverneur der Kolonie von Plymouth, John Winthrop, in einem Pamphlet privaten Besitz an menschliche Arbeit knüpfte.13 Winthrop bezog sich hierbei auf den niederländischen Juristen Hugo Grotius, der erklärt hatte, dass brach liegendes Land in den Besitz desjenigen übergehe, der es landwirtschaftlich kultivieren und mithin aufwerten würde. John Locke hat mit dieser Begründung schließlich Schule gemacht. In seiner Abhandlung Of Property argumentierte er, dass es sowohl zu den Rechten als auch zu den Pflichten des Menschen gehöre, Land und die Früchte, die es hervorbringe, nicht verderben zu lassen: „But if either the grass of his inclosure rotted on the ground, or the fruit of his planting perished without gathering, and laying up, this part of the earth, notwithstanding his inclosure, was still to be looked as waste, and might be the possession of any other.“14 Diese Definition von waste land als Land, das zwar umgrenzt sei, aber nicht adäquat kultiviert würde und daher in den vermeintlich rechtmäßigen Besitz desjenigen übergehen könne, der es in Wert setze, spielte im Zuge der Kolonisierung Kenias an der Wende zum 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle.
Allerdings wurde diese Definition lediglich auf eine bestimmte Region des heutigen Kenia angewandt, das so genannte Hochland.15 Denn aus britischer Perspektive schien allein das Hochland in Zentralkenia für eine Besiedlung und Landwirtschaft geeignet zu sein. Dieser Teil Ken...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Vorwort
- Einleitung
- 1 Vom „leeren“ zum „überfüllten“ Raum: Die Entdeckung eines Bevölkerungsproblems in der Kolonie Kenia in lokalen und globalen Bezügen
- 2 Bevölkerungspolitik als Modernisierungspolitik?
- 3 Die Auflösung der Modernisierungsformel oder: „Development is more than what happens […] demographically“
- Schluss
- Abkürzungsverzeichnis
- Zeitschriften und Archive
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Personenregister