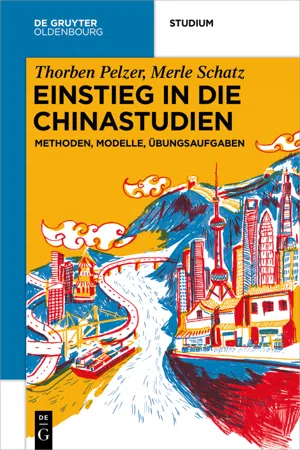Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die ambivalenten Konnotationen des Begriffs „China“ diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage nach der Deutungshoheit über den Begriff „China“ und seinen Assoziationen. Zur Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung wird in grundlegende Methoden und Modelle der Kulturstudien, insbesondere die des Postkolonialismus, eingeführt.
1.1 Chinabilder
Egal, ob wir von „Chinastudien“, „Chinawissenschaften“ oder lateinisch von der „Sinologie“ sprechen: Dem Namen nach befasst sich unsere Disziplin mit etwas, das wir „China“ nennen. Im Alltag mag die Bedeutung des Wortes „China“ trivial erscheinen. Haben unsere Freunde in „China“ einen Urlaub verbracht, denken wir unweigerlich an Drachen, grünen Tee, Konfuzius, chinesische Schriftzeichen, Reis, Maultaschen, Tierkreiszeichen, oder an den Film The Great Wall (2016). Je nach Interessenslage denken wir an imposante Naturlandschaften, an die maoistischen Bündnisse an den deutschen Universitäten 1968, oder an David Bowies Lied „China Girl“ (1983). Bei einer sich anbahnenden Geschäftsreise sind unsere Chinabilder oftmals weniger romantisch: Wir denken an überfüllte U-Bahnen, an Korruption und an Fabriken mit schlecht bezahlten Arbeitskräften. Womöglich studieren wir vor dem Abflug noch einen Reiseführer, der uns auf tatsächliche oder angebliche kulturelle Eigenarten vorbereiten soll. Im Zeitschriftenregal titelt Der Spiegel mit der Überschrift „Chinas Welt – Was will die neue Supermacht?“ und abends stellen sich auf dem Fernsehsender 3sat die Gäste einer Talkshow der Frage „Wie tickt China?“.1 In politischen Diskussionen wirkt „China“ häufig eher wie ein einzelnes, durchschaubares Individuum als wie ein großflächiges Land mit vielfältigen Gruppen, Interessen und Weltanschauungen.
Als Menschen sind wir empfänglich für Vorurteile und Abstraktionen. Sie machen unseren Alltag berechenbarer. Wir können das Verhalten von Individuen und Institutionen voraussagen, in dem wir auf unsere bisherigen Erfahrungen zurückgreifen. Wenn wir in der Bibliothek für die verspätete Rückgabe eines Buches eine Strafgebühr zahlen müssen, können wir berechtigterweise annehmen, dass wir im folgenden Monat für die nächste verspätete Buchrückgabe ebenfalls eine Strafgebühr zahlen müssen. Anhand erkannter Regeln und Muster passen wir unser Verhalten an: Wir geben das nächste Buch lieber fristgerecht zurück. Haben wir in unserem Leben bereits einige Freunde mit indischen Wurzeln kennengelernt, die ihr Essen für unseren Geschmack zu scharf würzen, könnten wir zu der Annahme gelangen, dass schärferes Essen ein fester Bestandteil einer „indischen Küche“ sei, und uns in der Konsequenz vornehmen, indische Restaurants in Zukunft zu vermeiden. Nicht alle Muster, die wir auf diese Art und Weise entdecken, müssen in der Wirklichkeit Bestätigung finden: Zwar hat unsere Nachbarin regelmäßig mit zwei arabischen Anwohnern Streit. Doch ob sie tatsächlich, wie wir schnell annehmen, eine allgemeine Aversion gegen Ausländer*innen hegt, oder einfach nur mit genau diesen zwei Menschen nicht zurechtkommt, können wir anhand der zu geringen Stichprobe nicht mit Sicherheit feststellen.
Auf diese Weise sind auch unsere Chinabilder eine Ansammlung von stereotypischen Motiven (auch „Tropen“ genannt). Die meisten dieser Vorurteile stammen dabei nicht einmal aus unseren eigenen Erfahrungen, sondern wurden kollektiv über Jahrhunderte in unserer Gesellschaft angesammelt. Da wir Teil dieser Gesellschaft sind und von klein auf in ihr kultiviert wurden, können wir uns nicht vollständig von diesen Vorstellungen befreien. Es ist allerdings unsere Aufgabe, zu verstehen, woher diese Ideen rühren und mit welchen Absichten sie popularisiert wurden. Es ist weiterhin wichtig, dass wir uns bewusstwerden, dass diese Abstraktionen die Realität nicht passiv wiederspiegeln, sondern sie aktiv beeinflussen. Anders ausgedrückt: Unsere Vorstellungen, auch in Bezug auf China, sind keine unmittelbaren Abbilder von dem, was wir wahrnehmen, sondern bilden das Kaleidoskop, durch welches wir die Realität betrachten.
1.2 Der Orient als das „Andere“
Werden wir uns der Funktion relativer Adjektive bewusst: Wir können Gegensatzpaare wie lang und kurz, groß und klein, oder dick und dünn nur anwenden, wenn wir mindestens zwei Objekte in einer Kategorie vergleichen können. Wir können nur zu der Aussage gelangen, Kapellen seien relativ klein, wenn wir von der Existenz von Kirchen und Kathedralen wissen. Stellen wir uns vor, es würde außer uns keine andere Person auf der Welt geben: Wir könnten nicht sagen, ob wir relativ groß oder klein gewachsen sind. Das Mittelmaß unserer Mitmenschen würde uns auch keinen Eindruck darüber geben können, ob wir an Über- oder Untergewicht leiden. Unsere Schuhgröße wäre nicht größer oder kleiner als der Durchschnitt, denn unsere Schuhgröße wäre gleichsam der Durchschnitt. Wir könnten nicht einmal von uns behaupten, dass wir über einen besonderen Charakter verfügen: Wir wären uns nicht bewusst, dass wir ein Individuum sind, welches sich durch irgendwelche Eigenarten von anderen Individuen abgrenzt. In der Fachsprache nennen wir diese Gegensatzpaare „binäre Opposition“.
Es braucht also das Gegenüber, um uns unserer Selbst bewusst zu werden. Das gilt nicht nur für Individuen. Um von Verwandtschaften sprechen zu können, brauchen wir Regeln, die bestimmen, welche Menschen nicht als unsere Verwandten gelten. Einen nationalistischen Chauvinismus kann es nur geben, wenn es in unserem Bewusstsein auch andere Nationalstaaten gibt, die wir für unterlegen erklären können. Schließlich kann es „den Westen“ mit seinen aufklärerischen Idealen nur geben, wenn es Regionen auf der Erde gibt, die explizit nicht dem „Westen“ zugehörig sind.
In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelten Philosophen der sogenannten Frankfurter Schule die Kritische Theorie der Gesellschaft. Sie hat zum Ziel, den ideologischen Überbau einer Gesellschaft zu hinterfragen. Zum Überbau gehören neben unseren Institutionen, Ritualen und Strukturen auch unsere geistigen Vorstellungen und damit auch jene Gedanken, die wir über den „Anderen“ oder das „Andere“ hegen. Teilweise auf der Kritischen Theorie aufbauend, teilweise mit ihr in Konkurrenz stehend, etablierte sich ab den 1960ern die wissenschaftliche Disziplin der Kulturstudien (oft englisch belassen: cultural studies), welche die Dynamiken des gesellschaftlichen Überbaus als kulturelle Felder analysiert. Die vielleicht wichtigste Gemeinsamkeit dieser wissenschaftlichen Strömungen ist es, dass Wissen nicht mehr als zeitlos gültig verstanden wird, sondern dass Wahrheiten als sich mit der Zeit verändernde Machtstrategien begriffen werden.2 So analysieren als Teilgebiet der Kulturstudien die Postkolonialen Studien das Wissen und die damit einhergehende Macht über „fremde“ Gebiete, beispielsweise das Wissen und die Macht Europas über China.
Aus dem Geschichtsunterricht kennen wir den für die postkolonialen Studien namensstiftenden Begriff Kolonialismus: Er meint die staatlich geförderte Inbesitznahme auswärtiger Territorien und die Unterwerfung, Vertreibung oder Ermordung der ansässigen Bevölkerung. In den postkolonialen Studien ist der Begriff aber weiter gefasst und meint auch einen „kulturellen Kolonialismus“: Auch, wenn die Herrschaft einer Kultur über eine andere strenggenommen nicht der politischen Ordnung einer Kolonialherrschaft entspricht, kann sie über ihre kulturelle Hegemonie Macht über Werte und Vorstellungen einer fremden, „anderen“ Kultur ausüben.
Das Fremde oder das „Andere“ wird in den postkolonialen Studien als „the Other“ bezeichnet (auch in deutschsprachigen Publikationen meist auf Englisch belassen). Durch sogenanntes Othering wurden in der Vergangenheit sowohl soziale und ethnische Gruppen als auch kulturelle und geografische Regionen als „andersartig“ abgegrenzt und für minderwertig erklärt. Der beobachtende Blick (im Englischen gaze) auf das „Andere“ erlaubt uns, zu Aussagen über uns selbst zu gelangen. Ein Beispiel für „Othering“ ist der Umgang Europas mit dem „Orient“, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Der historische Umgang Europas mit dem Orient ist für Sinolog*innen von Belang, da unsere Forschung immer auch eine Begegnung mit dem Fremden darstellt. Wir sind dazu angehalten, unsere Rolle als Mittler*innen kritisch zu überprüfen, um eine differenzierte Auseinandersetzung mit unserer Forschungsregion zu ermöglichen.
1.2.1 Der Osten des Westens
Wie der Literaturtheoretiker Edward Said (1935–2003) in seinem disziplinenübergreifend einflussreichen Werk Orientalismus 1978 festgehalten hat, sicherte sich der selbsternannte „Westen“ auch zur eigenen Identitätsbildung die Deutungshoheit über den „Orient“. Der „Orient“ wird dabei homogenisiert (das heißt undifferenziert und stereotypisch) betrachtet: Kulturelle Eigenarten eines weiten geografischen und gesellschaftlichen Raumes fallen außer Acht, um eine gesamte Landmasse und ihre Bevölkerung als kulturell rückständig und „anders“ zu charakterisieren. Diese rhetorische Strategie wird in der Fachsprache Orientalismus genannt.
Ein frühes Beispiel für einen Schriftsteller, der China in dieser Weise diskutierte, ist der deutsche Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770–1831). In einer Vorlesung, die er ab 1822 hielt, erklärte er:
Unter allen Verhältnissen hat China seinen Charakter immer behalten; kein Volk von einem andern geistigen Prinzip hat sich an die Stelle des alten gesetzt. Insofern hat China eigentlich keine Geschichte. Wie es jetzt ist, so ist es das Resultat seiner Geschichte; wir sprechen hier nicht bloß von einem vergangenen, sondern auch von einem noch gegenwärtigen Reiche, und indem wir von seiner ältesten Geschichte sprechen, zugleich von seiner Gegenwart. Dies ist das Prinzip des chinesischen Staates, und über seinen Begriff ist er nicht hinausgegangen; doch besitzt er in diesem seinem Bestande eine hohe Kultur.
Wenn wir also mit China anfangen, so haben wir vor uns den ältesten Staat und doch keine Vergangenheit, sondern einen Staat, der ebenso heute existiert, wie wir ihn in alten Zeiten kennen lernen.3
Für Hegel war China also ein unveränderbares Motiv, welches den Konsequenzen historischer Entwicklungen nicht unterworfen sei. Chinas Gesellschaft sei damit statisch und geschichtslos. Wenige Jahrzehnte später übernahm der Philosoph Karl Marx (1818–1883) diese Vorstellung, als er China 1862 als „lebendes Fossil“ beschrieb.4 Es handelt sich hier um „kulturessentialistische“ Betrachtungen: Individuen werden auf Grundlage ihrer Gruppenzugehörigkeit (hier: ihrer Kultur) notwendige („essentielle“) Eigenschaften zugewiesen, was zur Stereotypisierung führt. Dass weiße, männliche Autoren eine komplexe Bevölkerung zu einer kollektiven Masse oder einem abstrakten Phänomen subsumieren, mag uns heute vielleicht ignorant und einem vernünftigen, differenzierenden Geist zuwider erscheinen. Tatsächlich argumentieren kontemporäre „Chinaversteher*innen“ aber häufig auch heute noch auf einer vergleichbaren Ebene, wenn sie versuchen, komplexe soziale Zusammenhänge auf eine Staatenebene zu abstrahieren. Noch 1991 soll Richard Nixon, einst der erste US-amerikanische Präsident, der in die Volksrepublik China reiste, zur Möglichkeit einer...