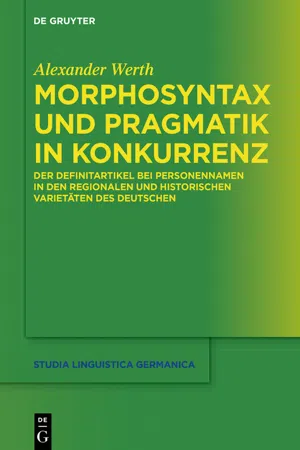Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe sprachlicher Phänomene, die eine Redundanz dahingehend aufweisen, dass scheinbar gleiche grammatische Funktionen formal mehrfach kodiert werden. Dies ist z. B. beim sog. Doppelperfekt (gesehen gehabt), bei mehrfacher Negation (das macht kein Mensch nicht), bei Koordination mit beide (beide Peter und Stefan haben kein Auto), bei periphrastischen Possessivkonstruktionen (des Mannes sein Pferd) und beim Definitartikel am (inhärent definiten) Personennamen (der Peter, die Merkel) der Fall. Das zuletzt genannte Phänomen ist Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Mittels qualitativer und quantitativer Datenanalyse soll empirisch geklärt werden, in welchen Verwendungskontexten der Definitartikel am Personennamen (kurz: PersN-Artikel) in den historischen und rezenten Varietäten des Deutschen wie häufig auftritt und welche Funktionen er dabei erfüllt.
Wesentlich für die Darstellung der Zusammenhänge sind dabei die Begriffsapparate der Grammatikalisierungstheorie und Konstruktionsgrammatik. Die zentrale Aussage der Arbeit ist, dass Verbindungen aus Definitartikel und Personenname varietätenabhängig unterschiedliche sprachliche Funktionen zum Ausdruck bringen. Diese lassen sich grammatikalisierungstheoretisch auf einem breiten Spektrum zwischen semantisch-pragmatischen und syntaktischklassenmarkierenden Funktionen einordnen. Unter konstruktionsgrammatischen Gesichtspunkten haben Verbindungen aus Definitartikel und Personenname zudem mitunter Zeichencharakter, resp. die Eigenschaften von Konstruktionen. Diachron zeigen sich die Funktionsunterschiede in einer zunehmenden Generalisierung und Entpragmatisierung der Artikelverwendung, die sehr gut zu der passt, die allgemein für die Grammatikalisierung des Definitartikels im Deutschen angenommen wird. Diatopisch haben wir es hingegen aus der Perspektive des Sprachgebrauchs mit einem strikten Gegensatz von pragmatischer und syntaktischer Artikelverwendung zu tun, der in den Bewertungen der Sprachteilnehmer allerdings nicht konsequent aufrechterhalten wird.1
1.1Problemaufriss
Die normativen Grammatiken des Deutschen weisen übereinstimmend eine grammatische Regel aus, der zufolge der PersN-Artikel nicht oder nur in sehr spezifischen syntaktischen und pragmatischen Kontexten gebraucht werden kann (z. B. IDS-Grammatik 1997: 1931–1932; Helbig & Buscha 2001: 344–345; Engel 2004: 318; Weinrich 2005: 423–426; Duden-Grammatik 2016: 299–302).2 Als Begründung für diese Regel wird die inhärente semantische Definitheit von Namen genannt, die – anders als bei Appellativa (APP) – eine Definitheitsmarkierung durch den Artikel redundant und damit obsolet macht, vgl. (1).
| (1) | a. | Peter steht vor der Tür. |
| b. | Der/Ein/Kein/Mein Hund steht vor der Tür. |
| c. | *Hund steht vor der Tür. |
So kann in (1a) Peter auch ohne den Gebrauch eines Artikelwortes eine eindeutige (gelungene) Referenz erbringen, während selbiges bei Hund in (1b) und (1c) nicht der Fall ist.3 Das APP muss hier (zumindest im Singular) obligatorisch durch ein Artikelwort (durch einen Determinierer) als Definitheitsmarker eingeleitet werden, andernfalls ist der Satz als ungrammatisch zu werten. Die angeführten semantisch-determinativen Gebrauchsbeschränkungen scheinen allerdings nicht für eine Vielzahl sonstiger Klassen von EigenN zu gelten, die im Deutschen obligatorisch von einem Definitartikel begleitet werden, auch wenn sich der Definitheitsstatus dieser Namen augenscheinlich nicht von denen der PersN unterscheidet.4 Nübling, Fahlbusch & Heuser (2015: 80–81) reklamieren dies z. B. für Gewässernamen (der Rhein, der Pazifik), Straßennamen (die Hegelstraße, die Schwanallee), Gebirgsnamen (der Harz, die Alpen), Produkt- bzw.
Markennamen (die ZEIT, der Wendler) und manche Landschafts- und Ländernamen (die Wetterau, die Schweiz).5 Für die regionalen Varietäten des Deutschen gilt zudem, dass dort PersN mitunter sehr häufig von einem Definitartikel begleitet werden, wie die folgenden Belege aus den Korpora „Regionalsprache.de“ (REDE) und „Zwirner“ (ZW) illustrieren:6
| (2) | a. | de niklas ha ich gestern obend noch mal ageschwätzt. (REDE, RA4, Alemannisch) |
| b. | der jörg ist auch rettungssanitäter. (REDE, BOR2, Westfälisch) |
| c. | de grintz ludgen is in urlaub. (REDE, TRSWalt2, Moselfränkisch) |
| d. | wie der martin luther emol gsagt hat – de lait aufs maul gschaut. (Zwirner, ZW899, Bairisch) |
| e. | derweil sitzt da e seene brut beieinander rum – der strauß kitl, der justel veri und der woiß hinten. (Zwirner, ZWL03, Bairisch) |
| f. | und die frau martha gehrke, die stand gleich auf. (Zwirner, ZWA25, Mecklenburgisch) |
Erste flächendeckende Kompetenzerhebungen zum Gebrauch des Definitartikels bei RufN wurden von Bellmann (1990: 274), Eichhoff (2000: Karte 76) und Elspaß & Möller (2003ff.) vorgelegt. Ihre Daten weisen für das bundesdeutsche Sprachgebiet eine regional bedingte Variation in der Artikelverwendung aus. Demnach akzeptieren Sprecher aus oberdeutschen (obd.) und mitteldeutschen (md.) Varietäten in Befragungen den RufN-Artikel deutlich häufiger als Sprecher aus dem niederdeutschen (nd.) Raum. Zugleich weisen Befunde zur Spracheinstellung in Bellmann (1990: 277–281) aus, dass seine Informanten aus dem nd. Raum den Gebrauch konsequent ablehnen und ihn vielmehr als distanzlos oder gar respektlos gegenüber dem Referenten empfinden. Umgekehrt werten die obd. Informanten dessen Nichtverwendung als Ausdruck sprecherseitiger Distanziertheit und Überheblichkeit, wodurch das Phänomen insgesamt eine starke sozio-pragmatische Relevanz erhält. Die Befunde in Bellmann deuten zudem auf eine funktionale (hier: pragmatische) Belastung des Definitartikels bei RufN hin, indem sein Gebrauch „in einem großen Areal von kontextuellen und situativen Faktoren gesteuert“ ist bzw. in „Arealen mit nichtobligatorischem Vornamenartikel [...] zur spontanen expressiven und auffällig konnotierten Verwendung zur Verfügung [steht, A. W.]“ (Bellmann 1990: 271, 273). Insbesondere für den nd. Raum lässt sich bei den Informanten dabei eine auffällige Diskrepanz zwischen der Verwendung des PersN-Artikels und seiner fehlenden Akzeptanz feststellen, was die Frage nach geeigneten Methoden zur Untersuchung des Phänomens aufwirft.
Ein Blick in ältere Forschungsarbeiten verrät zudem, dass es sich bei der Verwendung des PersN-Artikels um kein junges grammatisches Phänomen handelt. So finden sich in Baermann (1776: 145) und Cunradi (1808: 134) bereits für das 18. und beginnende 19. Jh. Hinweise auf eine regionale Variation in den Gebrauchshäufigkeiten. Der PersN-Artikel tritt außerdem in mittelhochdeutscher bzw. mittelniederdeutscher Zeit auf, was seine häufige Nichtverwendung im heutigen Schriftdeutschen als rätselhaft erscheinen lässt, vgl. (3).
| (3) | a. | Unde dat was de Henneke Wulff. (Geschichte des Henning Wulff, Mnd. zirka 1600) |
| b. | [...] alse Clawes Moller unde Hynryck Junge dem Danyel Lubbeken carspelvaget des vagedes bock averandtwerdeth. (Geschichte des Henning Wulf, Mnd. zirka 1600) |
| c. | diz was den Daniel slâfinde gesach / in einem troume dâ er lach. (Alexanderlied 475, Mhd. zirka 1150) |
| d. | Von demi gezûgi des stiphtis / Worti diu Semîramis / Die burchmura viereggehtich. (Annolied X, 15, Mhd. 11. Jh.) |
Ebenfalls rätselhaft ist der Abbau der Namenflexion im Dativ und Akkusativ, welcher von mehreren Autoren in einen direkten Zusammenhang gebracht worden ist mit dem Aufkommen des PersN-Artikels und welcher historisch auf eine komplementäre Verteilung von Definitartikel und Namenflexion zurückzuführen ist, wie sie heute im Schriftdeutschen noch bei der Genitivflexion zu beobachten ist, vgl. (4).7
| (4) | a. | Peters Hund geht gerne spazieren. |
| b. | Der Hund des Peter geht gerne spazieren. |
| c. | *Des Peters Hund geht gerne spazieren. |
Syntaktische Funktionen erfüllen Artikelwörter im Deutschen allgemein als eröffnendes Klammerelement der Nominalphrase (NP) sowie als Anzeiger der morphologischen Kategorien Numerus, Kasus, Genus und Person. Vor allem die Funktion des Artikels als Träger morphologischen Kasus wurde und wird in der Literatur häufig als Motiv für die Verwendung des PersN-Artikels herangezogen (Adelung 1781: 94; Bauer 1828: 260; Paul 1919: 182; Wunderlich & Reis 1925: 309–310, 314; Bach 1952: 54; Seibicke 2008: 61; Nübling, Fahlbusch & Heuser 2015: 127). Demnach hätte nach dem Wegfall der Namenflexion (spätestens seit dem 18. Jh.; vgl. Nübling 2012: 225–229; Ackermann 2018a) der Definitartikel die Kasusmarkierung in den Objektkasus und zusätzlich die im Nominativ übernommen und damit ...