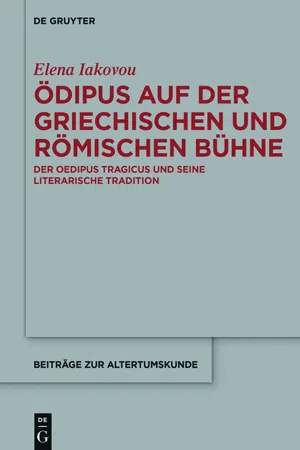1.1 Hinführung zum Thema
Wie der Komödiendichter Antiphanes in seiner Poiesis beobachtet, reicht der Name Ödipus aus, um eine Vorstellung von seinem Mythos in Erinnerung zu rufen: Der Name „Ödipus“ erinnere auch an seinen Vater Laios, seine Mutter Iokaste, seine Kinder, seine Leiden sowie seine grauenvollen Taten.
ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος – auf seine allgemeine Bekanntheit weist Ödipus im sophokleischen König Ödipus (V. 8) selbst hin, und diese Aussage gilt nicht nur für die Welt innerhalb des Stücks: Der Ödipus-Stoff war in der mündlichen Tradition,1 in der Literatur, in der Kunst und im Kult weit verbreitet. Ödipus ist der Held eines Mythos, der im Zentrum des thebanischen Sagenkreises steht, bereits lange vor Sophokles’ tragischer Bearbeitung seinen Anfang hatte und bis in die Moderne weiterlebt. Erzählkern ist das unwissentlich begangene doppelte Verbrechen des Ödipus, nämlich die Ermordung seines Vaters und der Inzest mit seiner Mutter. Um diesen Kern herum entstanden zahlreiche Varianten des Mythos, denen jeweils ein eigener Stellenwert zugebilligt werden muss. Das bis heute ungebrochene Interesse an der Sage des Ödipus lässt sich anhand von modernen Theateraufführungen und Neubearbeitungen dieses mythischen Stoffs nachweisen.2
Die Elemente des Ödipus-Mythos und seine unzähligen Bearbeitungen sind auch ein beliebter Forschungsgegenstand vieler Disziplinen und komparatistischer Studien. Die Beschäftigung mit den antiken literarischen (sowie einigen bildlichen) Versionen des Mythos wurde nachhaltig geprägt durch die Monographien von Legras (1905) und Robert (1915). Obwohl beide einen Überblick über die antiken Quellen des Ödipus-Mythos bieten, lässt sich keine scharfe Trennung zwischen dem tradierten Mythos und den literarischen Bearbeitungen (teilweise neue Varianten) erkennen. Edmunds (2006) stellte umfassend die Rezeption des Ödipus-Stoffs von der griechischen vortragischen Tradition über die römische Zeit und das Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert dar.3 Allerdings werden die jeweiligen Texte isoliert betrachtet; mögliche (gegenseitige oder andere) Einflüsse werden nicht benannt. Ferner gibt es zahlreiche Veröffentlichungen, die auf einzelne literarische Bearbeitungen des Mythos fokussiert sind; in diesem Rahmen finden sich mitunter auch Bemerkungen dazu, welche Prätexte auf die jeweilige Darstellung eingewirkt haben könnten oder wie ein Text seinerseits spätere Bearbeitungen des Stoffes prägte. Bisher fehlt aber eine breit angelegte Studie und komparatistische Analyse der Abhängigkeiten der vielfältigen Ödipus-Bearbeitungen.4
Diesem Forschungsdesiderat möchte die vorliegende Arbeit abhelfen, indem sie gattungsübergreifend die Entwicklung des Ödipus-Stoffes in der antiken Literatur in den Blick nimmt. Den Schwerpunkt sollen dabei die tragischen Darstellungen des Stoffes bilden, der ja vorrangig aus dieser Textgattung bekannt ist; dazu wird ein Bogen von der tragischen „Trias“5 zu den römischen Dichtern Accius und Seneca geschlagen.6 Zunächst soll gefragt werden, wie Aischylos, Sophokles und vor allem Euripides in ihren Dramen, die sich mit dem Ödipus-Stoff befassen, frühere literarische Darstellungen strukturell oder motivisch adaptiert bzw. sich – bewusst oder unbewusst – gegen mögliche Vorgänger abgegrenzt haben. Es gilt also, das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation auszuleuchten. In ähnlicher Weise werden anschließend die römischen Tragödien untersucht. Grundannahme ist dabei, dass die literarische Bearbeitung eines mythischen Stoffs z. T. auf seine Darstellung durch frühere Autoren Bezug nimmt.
Die vorliegende Arbeit verfolgt also ein philologisches Ziel, indem sie auf literarische Werke fokussiert ist. Es geht nicht darum, die Ursprünge des Ödipus-Mythos darzulegen und die religionsgeschichtlichen Aspekte zu untersuchen. Auch der Mythos-Begriff kann und soll hier nicht diskutiert werden; zugrunde gelegt wird die Definition von Zgoll: „Ein antiker Mythos ist ein traditioneller Erzählstoff von kollektiver Bedeutsamkeit, in dem sich auf dem Hintergrund bereits vorhandener Stoffe eine transformierende und transzendierende Auseinandersetzung mit angenommenen Wirklichkeiten verdichtet.“7 Den Mythos gibt es nicht in einer kohärenten Form, sondern in verschiedenen Varianten, die teils miteinander übereinstimmen, teils voneinander abweichen.8 Da nicht zu rekonstruieren ist, welche Versionen wann in der mündlichen Tradition existierten, können sie in der vorliegenden Arbeit als mögliche Quellen nicht näher berücksichtigt werden. Man muss aber davon ausgehen, dass neben früheren schriftlichen auch mündliche Überlieferungen Einfluss auf die Entstehung neuer literarischer Bearbeitungen hatten.
Dass in der vorliegenden Arbeit zum Ödipus-Stoff die Gattung Tragödie im Zentrum steht, ergibt sich beinahe von selbst. Der Mythos ist die „Seele eines Stücks“.9 Aristoteles weist zum einen darauf hin, dass sich die Tragödiendichter an verschiedenen Mythenversionen orientiert hätten (poet. 13, 1453a17 – 39). Zum anderen erklärt er, dass sie nicht in diese überlieferten Geschichten eingreifen sollen (poet. 14, 1453b22 – 26).10 Nichtsdestotrotz kann der Tragödie ein großer Spielraum für Innovationen und Erfindungen eingeräumt werden; hierfür führt Aristoteles den Antheus des Agathon als Beispiel an (poet. 9, 1451b19 – 25).11
Ein solcher kreativer Umgang mit dem jeweiligen mythischen Stoff in den Tragödien lässt sich nicht zuletzt durch den agonalen Kontext der literarischen Produktion des 5. und 4. Jh.s v. Chr. begründen, der zu einem erheblichen Zuwachs an Mythenversionen geführt hat.12 Es ist zu vermuten, dass auch die diversen verlorenen Tragödien eine Vielzahl an weiteren Varianten enthielten. Nicht nur für diese Blütezeit der Tragödie in Griechenland, sondern für die literarische Produktion in allen Zeiten gilt, dass sowohl der Innovationsanpruch der Autoren als auch das soziokulturelle Umfeld zur Entstehung neuer Mythenversionen beigetragen haben.
Zur Beantwortung der Frage, welche literarischen Bearbeitungen des Ödipus-Stoffs aufeinander eingewirkt haben, müssen sprachliche, motivische und strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert werden; es gilt also, anhand von intertextuellen Bezügen die Abhängigkeit einzelner Texte oder Textpassagen voneinander festzustellen. Der vorliegenden Arbeit liegt dabei begründet durch das einerseits große und breit gefächerte, anderseits oft nur fragmentarisch erhaltene Textcorpus – ein bestimmter Intertextualitätsbegriff zugrunde.
Dieser Begriff wurde zuerst von Kristeva eingeführt und lässt sich als die Bezugnahme auf andere Texte erklären; dadurch entsteht eine Art Kommunikation zwischen den Texten.13 Genette bezeichnet als „Intertextualität“ eher die wörtlichen Zitate und klaren Anspielungen. Er weist dabei auf vier weitere Formen von „transtextualité“ (Transtextualität) hin.14 Hassler bemerkt, dass diese insgesamt fünf Kategorien Aussagen über „die Sinngebung relevantes Hinausweisen eines Textes über sich selbst“ liefern.15
In der vorliegenden Arbeit verstehe ich unter ‘Prätext’ den Text, der als Vorlage für zeitgenössische und spätere Texte dient und auf den motivische, wörtliche, strukturelle u. a. Verweise zu finden sind. Mit dem Begriff ‘Intertext’ beschreibe ich einen Prätext, auf den der Sekundärtext mehrfach Bezug nimmt und der dadurch als ‘intertextuelle’ Folie und dementsprechend als potentielle Quelle des Sekundärtextes fungiert. Dementsprechend begreift sich in der vorliegenden Arbeit als „Intertextualität“ nicht nur die Übernahme von Teilen eines Prätextes, sondern eher die Relationen zwischen Teilen des Prätextes und des Sekundärtextes.16
Hierzu schlägt Helbig vier Kategorien vor: eine unmarkierte („Nullstufe“), eine implizit markierte („Reduktionsstufe“), eine explizit markierte („Vollstufe“) und eine thematisierte Intertextualität („Potenzierungsstufe“).17 Bei einer unmarkierten Intertextualität ist dem Rezipienten nicht deutlich, dass verborgene Intertextualität vorliegt. Mit der implizit markierten Intertextualität ist eine „höhere Anforderung an die Allusionskompetenz des Rezipienten“ verbunden,18 wohingegen eine explizit markierte Aussage transparent und deutlich auf Intertextualität hinweist. In der letzten Markierungsform werden die intertextuellen Bezüge offen dargelegt und sprachlich thematisiert (durch „Thematisierung literarischer Produktion und Rezeption“ und „Identifizierung des Referenztextes“).19 Aufgrund der vielfältigen Ausdrucksformen von Intertextualität befinden sich Autor und Rezipient in einem stetigen Dialog.20 Böhn formuliert: „Einzeltextbezüge können sich punktuell auf einzelne Elemente eines oder mehrerer Einzeltexte richten oder aber auf übergreifende Strukturen eines Einzeltextes oder von Teilen desselben.“21 Obwohl in diese Kategorie der „Einzeltextbezüge“ an erster Stelle das wörtliche Zitat fällt, gehören hierzu auch „Anspielungen oder paraphrasierende Hinweise auf einzelne Stellen eines Werkes oder auch auf Figuren“.22 Abhängigkeiten können sich natürlich nicht nur in Übereinstimmungen, sondern auch in gezielten (und entsprechend markierten) Abweichungen von Prätexten ausdrücken.
Der Nachweis von intertextuellen – strukturellen wie motivischen (ggf. wörtlichen) – Bezügen soll in der vorliegenden Arbeit dazu dienen, die Entwicklung des Ödipus-Mythos in der griechischen und lateinischen Literatur nachzuzeichnen. In welcher Reihenfolge die Texte behandelt werden, wird im Folgenden erläutert.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in drei große Teile gegliedert: die literarischen Bearbeitungen des Ödipus-Stoffs außerhalb der großen Tragiker (TEIL I), die tragische Tradition des Ödipus-Stoffs in Athen (TEIL II) und die tragische Tradition des Ödipus-Stoffs in Rom (TEIL III). Die Untersuchung beginnt im 8./7. Jahrhundert v. Chr. und endet im 1. Jahrhundert n. Chr.; sie umfasst also eine Zeitspanne von fast einem Jahrtausend, in dem diverse Mythenvarianten auftreten. Die vielfältigen literarischen Bearbeitungen des mythischen Ödipus-Stoffs sollen in einem diachronen Durchgang zueinander in Bezug gesetzt und ihr komplexes Abhängigkeitsverhältnis beschrieben werden. Eine umfangreiche, gattungsübergreifende Bestandserhebung zu den literarischen Bearbeitungen des Ödipus-Stoffes sowie die systematische Identifikation und übersichtliche Präsentation der traditionellen und neuen Aspekte soll im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen.
Eine Leitfrage wird sein, welche Autoren und Werke darauf abzielen, sich durch einen besonders stark ausgeprägten Innovationscharakter von den literarischen Vorgängern abzusetzen und welche sich eher auf die Autorität ihrer Vorbilder berufen. Dabei soll berücksichtigt werden, dass es sich im Einzelnen nicht immer klären lässt, ob ein bestimmtes Motiv aus einem konkreten Prätext oder sogar aus dem mythischen (womöglich mündlichen oder bildlichen) Erzählgut stammt, da die Texte ja eine „fließende“ Mythentradition verarbeiten. Zudem sollen in der Arbeit die strukturellen Elemente bzw. Motive erörtert werden, die in den zu besprechenden Texten auftreten; es wird nicht nur der inhaltliche Handlungsablauf (die mythischen Strukturelemente), sondern auch ggf. die literarische Anordnung (im Prolog, Botenbericht, vor Dramenbeginn oder in der Handlung) dargestellt.
Der erste Teil der Arbeit bietet einen Überblick über die literarischen Bearbeitungen...