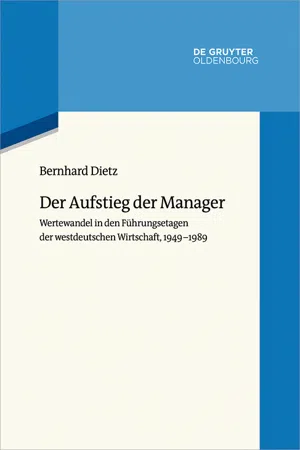
eBook - ePub
Der Aufstieg der Manager
Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989
- 524 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der Aufstieg der Manager
Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989
Über dieses Buch
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Manager auch in der Bundesrepublik zur prägenden Figur moderner Unternehmen. Bernhard Dietz erklärt diesen Aufstieg der Manager und setzt ihn in Beziehung zu sich wandelnden Idealen und Leitbildern. Indem er untersucht, wie sich "Arbeit", "Leistung" und "Führung" zwischen Nationalsozialismus und Neoliberalismus veränderten, leistet er einen ganz neuen Beitrag zu einer Kulturgeschichte des Kapitalismus.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Aufstieg der Manager von Bernhard Dietz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Verwaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
1.1 Thema und Fragestellung
Alles begann mit den großen Streiks im Winter 1918/19. Im Zuge der Novemberrevolution legten auch die Angestellten der Berliner Metall- und Elektroindustrie die Arbeit nieder, um für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren. Streikposten, die ein gemeinsames Vorgehen aller Angestellten sicherstellen sollten, verwehrten daher auch Direktoren, Prokuristen, Oberingenieuren und Abteilungsleitern einer Reihe von Berliner Firmen den Zutritt zu den Fabriken. Somit mussten auch die leitenden Angestellten gegen ihren Willen vor den Werkstoren bleiben. Das Verhalten der Streikposten lag durchaus in der Logik der Entwicklung der letzten Kriegsjahre, in denen eine breitere Angestelltenbewegung Gestalt angenommen und organisatorischen Vertretungen in den Betrieben und kollektiven Gehaltsforderungen zum Durchbruch verholfen hatte.1 Von den neuen Angestelltenausschüssen sollte sich nun auch jene Gruppe vertreten fühlen, die sich vor dem Krieg als betriebliche Oberschicht herauskristallisiert hatte. Wer mehr als 5000 Mark im Jahr verdiente, durfte sich dieser Betriebselite zugehörig fühlen – denn so hatte das Angestelltenversicherungsgesetz von 1911 zum ersten Mal die Gruppe der leitenden Angestellten abgegrenzt.2
Nun, am Ende des Weltkriegs, war diese Sonderstellung in Gefahr. Die Angst vor einer Kollektivierung in einer einheitlichen Angestelltenschaft ging schon länger um. Aus Sicht der betroffenen Männer zeigte der Streik, dass ihre soziale und betriebliche Sonderstellung akut bedroht war, und so nahm eine Reihe von leitenden Angestellten von Siemens, der AEG und anderen Berliner Großbetrieben ihr Schicksal selbst in die Hand. Am 22. Dezember 1918 gründeten sie die VELA – die Vereinigung der leitenden Angestellten in Handel und Industrie.3 Deren erste Aktion bestand in Verhandlungen mit den Gewerkschaften und den Firmenleitungen, um den leitenden Angestellten wieder Zugang zu ihren Büros zu ermöglichen. Geradezu symbolhaft steht am Beginn der Organisation der leitenden Angestellten dieser durch eine neue Solidargemeinschaft erwirkte Bruch mit den anderen Arbeitnehmern. Sie wollten nicht zur restlichen Angestelltenschaft gehören und waren daher bereit, sich mit anderen Männern4 ihrer Position zusammenzuschließen – nicht auf der Basis des gemeinsamen Berufs oder der gemeinsamen Branche, sondern auf der Basis ihrer Funktion bzw. ihres Status in der Betriebshierarchie, beispielsweise als Abteilungsleiter.
Elitäres Selbstverständnis und kollektive Interessenvertretung waren dabei nicht immer leicht zusammenzubringen:
Es klingt paradox, dass leitende Angestellte, die geistig schöpferischen, als Wirtschaftsführer anzusprechenden Persönlichkeiten, die sich herausheben aus der Menge der ausführenden Tätigkeiten, eine Organisation brauchen, eine Kollektivität über die gegebene Individualität stellen müssen,
erklärte der Hauptgeschäftsführer der VELA auf der Hauptversammlung der Organisation am 9. April 1921.5 Die Idee einer Art Gewerkschaft für betriebliche Führungskräfte stieß auf kulturelle Ablehnung, aber in einer komplexer werdenden und zunehmend verrechtlichten Wirtschafts- und Arbeitswelt war es auch für die leitenden Angestellten notwendig geworden, ihre spezifischen Interessen gemeinsam zu vertreten. Mit ihrer leitenden Tätigkeit, ihren „geistig‐schöpferischen“ Aufgaben und ihrer „besonders gearteten seelischen Einstellung zur Arbeit“ rechtfertigten sie ihre Abgrenzung von den restlichen Angestellten. Für sie war die Arbeit „nicht nur reine Ware, in ihr liegt Ehre, innere Befriedigung, Stolz“.6 Aber Angestellte waren sie dennoch. Obwohl sie aus ihrer Sicht „alle geistigen Herausforderungen des Unternehmertums“ erfüllten,7 gehörte ihnen die Fabrik nicht, ihre ökonomische Macht war ihnen nur übertragen worden. Sie waren also Manager – auch wenn sie 1918 noch nicht so hießen und sich der Begriff in Deutschland erst 50 Jahre später durchsetzen sollte.8
Der Beginn der Geschichte der leitenden Angestellten ist also in der Weimarer Republik zu suchen, ihre eigentliche Bedeutung bekommt sie aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Emanzipationsbewegung der leitenden Angestellten ging in der Weimarer Zeit im Wesentlichen noch auf der Verbandsebene vonstatten. In den Betrieben wurden sie noch nicht als Zielgruppe identifiziert, eine systematische Führungskräfterekrutierung gab es noch nicht. Die leitenden Angestellten wurden zwar erstmals als arbeitsrechtliches Problem und soziologisches Phänomen erkannt und wissenschaftlich vermessen, aber eine größere gesellschaftliche Auseinandersetzung über leitende Angestellte oder Manager fand noch nicht statt. Waren die Verbände der leitenden Angestellten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wie die aller anderen Arbeitnehmer zugunsten der Idee der Volksgemeinschaft aufgelöst oder gleichgeschaltet worden (wobei die VELA sich schon Ende 1932 ideologisch angepasst hatte)9, begann nun nach 1945 nicht nur der organisatorische Wiederaufbau, sondern auch eine soziale Erfolgsgeschichte, die von einer steigenden Zahl der leitenden Angestellten wie auch einer zunehmenden Anerkennung ihrer besonderen Position zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geprägt ist. Für die Geschichte des Arbeitsrechts, der Mitbestimmung in den Betrieben und Unternehmen in der Bundesrepublik ist die Gruppe der leitenden Angestellten von zentraler Bedeutung. Dabei wurde um den Status dieser Männer (und bis zu den 1980er Jahren sehr wenigen Frauen) weiter gestritten und im Prinzip hatte sich an den Grundfragen, die im November 1918 vor den Werkstoren von Siemens und AEG diskutiert wurden, nicht viel geändert: Sollen alle Arbeitnehmer gemeinsam ihre Interessen gegenüber den Arbeitgebern vertreten oder gibt es eine Sondergruppe zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit eigenen Problemen und Interessen? Gehören die leitenden Angestellten zur Unternehmensleitung oder zu den übrigen Angestellten und Arbeitern? Letztlich lief dies auf die entscheidende Frage hinaus: Wer kann und soll im Unternehmen führen?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Manager auch in der Bundesrepublik zum Beruf. Die Unternehmensleitungen wurden professioneller, die Ausbildung der Manager systematischer. Bildung und innerbetrieblicher Bewährungsaufstieg und damit höhere Funktionen im unteren und mittleren Management waren vor allem seit den 1960er und 1970er Jahren für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich. Gleichzeitig kam es zu einer internationalen und zu einem großen Teil populärwissenschaftlichen Expansion von Managementwissen durch neue Managementverlage, -zeitschriften und -ausbildungsstätten. Diese Geschichte der Professionalisierung, Demokratisierung sowie später auch der Verwissenschaftlichung des Managerberufs steht im Zentrum dieser Arbeit. Es sollen anhand der Führungskräfte empirische Antworten auf die Frage nach Idealen und Leitbildern in der Wirtschafts- und Arbeitswelt gegeben werden. Was bedeuten „Arbeit“, „Leistung“ und „Führung“ 20, 30 und 40 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus und der Gründung der Bundesrepublik, und welche Rolle spielt dabei der „Wertewandelschub“ der späten 1960er und frühen 1970er Jahre? Welche normativen Konzepte liegen der Wirtschafts- und Arbeitswelt zugrunde, woher kommen sie und wie verändern sie sich? Welche Konflikte um die Benennung und Auslegung der normativen Ordnungen gab es? Konkret gefragt: Wie haben sich vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels Arbeitsethos, Leistungsvorstellungen und Führungskonzepte verändert?
Zur Beantwortung dieser Fragen verfolgt die Untersuchung vier miteinander verwobene thematische Entwicklungsstränge:
- – erstens die Geschichte der leitenden Angestellten: Anhand dieser Gruppe lassen sich spezifische Aussagen über sich verändernde ökonomische Leitbilder, Führungssemantiken und Arbeitswerte treffen. Den leitenden Angestellten kam eine Schlüsselrolle zu, weil ihre unternehmensinternen Orientierungskulturen sich sowohl nach „oben“ als auch nach „unten“ richteten: Als Chefs mussten sie Leistung einfordern und führen, gleichzeitig waren sie selbst weisungsgebunden und mussten ihre eigene Leistung gegenüber dem Unternehmer beziehungsweise dem Vorstand herausstellen. Für die Auseinandersetzungen über Autorität und Führung in der bundesdeutschen Wirtschaft stellten sie somit eine soziale Schlüsselgruppe dar.
- – zweitens die Geschichte der Führungskräfteausbildung: Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen westdeutsche Unternehmer intensiv über die Ausbildung des eigenen Nachwuchses nachzudenken. Nachdem sie noch in den 1950er Jahren eine Amerikanisierung der Managementausbildung und Business Schools nach amerikanischem Vorbild strikt ablehnten, führte vor allem seit den mittleren 1960er Jahren kein Weg mehr an einer Professionalisierung der Führungskräfteausbildung vorbei. Doch wie man Führung lehren sollte, welche Führungsmethoden zu vermitteln seien, blieb umstritten. Gerade deswegen erlaubt der historische Blick auf die verschiedenen Ansätze der Managerschulung einen Zugriff auf die normativen Konzepte von Führung, Leistung und Arbeit. Hier wurde Führungswissen aggregiert, kanonisiert und weitergegeben.
- – drittens die Geschichte von Personalführungskonzepten, Motivationstechniken und Managementmodellen: Seit den 1920er Jahren wurde ausgehend von der amerikanischen Human‐Relations‐Bewegung auch in den deutschen anwendungsorientierten Arbeitswissenschaften über die ideale Gestaltung der Arbeitsumwelt und die Beteiligung von Arbeitern und Angestellten im Rahmen der betrieblichen Arbeitsorganisation geforscht. Nach 1945, vor allem aber um 1970 änderten sich nicht nur die Antworten der Personalexperten, sondern auch die Bereitschaft der Unternehmer, ihnen zuzuhören und die Ressource Mensch in den Mittelpunkt der betrieblichen Organisation zu stellen. Gerade in Verbindung mit der Geschichte der leitenden Angestellten und der Geschichte der Führungskräfteausbildung erlaubt diese wissensgeschichtliche Perspektive neue Aussagen über den schon länger vermuteten Wandel von einer autoritär‐diszipliniert‐kontrollierten zu einer vertrauensvoll‐motivierenden und auf Selbstverantwortung setzenden Arbeitswelt.
- – viertens die Konfliktgeschichte zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit: Was Führung zu sein hatte und wie Leistung eingefordert und begründet wurde, konnten schon bald die Unternehmer nicht mehr allein entscheiden, sondern die Diskussion wurde von einer zunehmend kritischer werdenden Öffentlichkeit und sich verändernden politischen, arbeitsrechtlichen und medialen Rahmenbedingungen begleitet. Gelang es den westdeutschen Unternehmern nach 1945 relativ schnell, aus der gesellschaftlichen Defensive herauszukommen, wurde im Laufe der 1960er Jahre der Legitimationsdruck durch Wissenschaft und Gesellschaft wieder größer. Dieser verstärkte sich in den 1970er Jahren durch die Mitbestimmungsdiskussion und die Kritik der „neuen Linken“. Die Strategien der Unternehmen, auf diese Öffentlichkeit nicht nur zu reagieren, sondern an der Formierung einer speziellen Wirtschaftsöffentlichkeit aktiv mitzuwirken und so dem Vertrauensverlust des Kapitalismus entgegenzuwirken, sind besonders aufschlussreich. Es zeigt sich, dass die alten Legitimationsstrategien um 1970 aus unterschiedlichen Gründen in eine Krise gerieten und es neuer Leitbilder bedurfte, bis auch diese um 1980 erodierten und der „Geist des Kapitalismus“ sich erneut wandelte.
Die Untersuchung versteht sich als eine sozialkulturelle Problemgeschichte bundesdeutscher Wirtschaftseliten. Erforscht werden die Einstellungen zu Arbeit, Führung und Leistung und ihr Wandel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Damit ist die vorliegende Untersuchung erstens ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Kapitalismus in der Bundesrepublik. Mentalitäten, kulturelle Orientierungshorizonte und Rechtfertigungsformen westdeutscher Unternehmer und leitender Angestellter werden als historisch bedeutsame Untersuchungsgegenstände ernst genommen, aber nicht losgelöst von ökonomischen Notwendigkeiten und Zwängen interpretiert. Die Arbeit ist zweitens ein Beitrag zur Strukturbruchdebatte, also der vieldiskutierten Frage, ob sich um 1970 die ökonomischen Führungs- und Organisationsideale fundamental wandelten und ob sich ein neues Produktionsregime (Postfordismus/Posttaylorismus) von einem älteren abgrenzen lässt. Diese Frage lässt sich sinnvoll nur durch eine Einbettung in die längerfristigen wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge beantworten. Drittens versteht sich die Arbeit als Beitrag zu einer historischen Wertewandelforschung, also einer historischen Betrachtungsweise, die Werte – verstanden als Ideen, Ideale oder Leitbilder – als zentrale Faktoren gesellschaftlich‐kultureller Ordnung und epochentypischer Mentalität versteht und ihren Wandel zu erklären sucht. Dabei grenzt sich diese historische Wertewandelforschung, die im Übrigen das ganze 20. Jahrhundert im Blick hat, von der sozialwissenschaftlichen Werteforschung nicht nur methodisch und theoretisch ab. Sie historisiert vielmehr auch die sozialwissenschaftliche Forschung der 1970er und 1980er Jahre und macht damit die wirklichkeitsformende Qualität ihrer Ergebnisse selbst zum Untersuchungsgegenstand.
1.2 Zum Forschungsstand
Wie oben schon erwähnt, ist die Thematisierung von „Leistung“ und „Führung“, von wirtschaftlichen Mentalitäten und insbesondere der sich verändernden Auffassungen von Unternehmertum nichts grundsätzlich Neues. Das gilt insbesondere für die Frage nach dem Wandel von Führungsstilen. Vor allem die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte diskutiert seit langem, wann nach 1945 und in welcher Form genau sich in Westdeutschland der Wandel vom stark autoritär‐patriarchalischen „Herr-im-Hause“-Unternehmer zum tendenziell sozialpartnerschaftlichen Manager vollzogen hat. Maßgeblich sind die Arbeiten des Historikers Volker Berghahn, der die Zeit des „Wirtschaftswunders“ als eine Periode identifiziert, in der autoritäre und paternalistische Führungsstile eine neue Hochzeit erlebten und amerikanische Einflüsse nur teilweise aufgenommen, nicht selten aber auch aktiv bekämpft wurden.10 Dies habe sich ab Mitte der 1960er Jahre geändert. Berghahn brachte diese Entwicklung auf die Formel: „vom Betriebsführer zum ‚sozialverantwortlichen‘ Manager“.11 Eng verbunden mit der Frage nach den Führungsstilen ist das Thema „Amer...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- 1 Einleitung
- 2 Führung nach dem Führer: Unternehmer und leitende Angestellte auf der Suche nach ihrer Rolle in den 1950er Jahren
- 3 Der lange Abschied von der Autorität: Die Professionalisierung von Führung in den 1960er Jahren
- 4 Das „1968“ der Manager: Vetrauenskrise des westdeutschen Kapitalismus
- 5 Die dritte Kraft zwischen Arbeit und Kapital? Die leitenden Angestellten in den 1970er Jahren
- 6 Zwischenfazit: „Wertewandelschub“ oder „neuer Geist des Kapitalismus“?
- 7 Die „Aufwertung der Werte“: Reflexiver Wertewandel, Flexibilisierungsparadigma und die Führungskräfte in den 1980er Jahren
- 8 Fazit: Der Aufstieg der Manager und der Wandel der normativen Konzepte von Arbeit, Leistung und Führung
- Personenregister