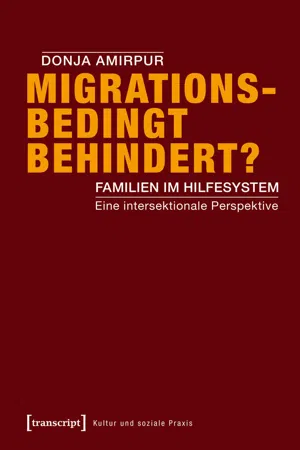![]()
1 Ausgangssituation
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und ihre Implikationen für das Hilfesystem
Der Begriff der Inklusion ist seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (im Folgenden kurz UN-BRK) in Deutschland in den nationalen und vor allem bildungspolitischen Fokus gerückt. Während international die Orientierung an die Leitidee der Inklusion als Basis für die Realisierung der Allgemeinen Menschenrechte betrachtet wird (Platte 2012, 141), befasst sich die Bildungspolitik in Deutschland im Kontext von Inklusion vornehmlich mit dem gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen. Dass diese Schwerpunktsetzung zu kurz greift und nicht dem Kerngedanken von Inklusion entspricht, zeigt ein Blick in die UN-BRK.
Die UN-BRK ist ein Völkerrechtsvertrag, der 2006 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde und seit 2009 auch in Deutschland gilt. Die Konvention stellt eine weitere Ergänzung der sieben Kernkonventionen der Vereinten Nationen dar, zu denen unter anderem das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der »Rassendiskriminierung« (die Antirassismuskonvention von 1965) und das Internationale Übereinkommen über die Rechte des Kindes (die Kinderrechtkonvention von 1989) zählen. Deutschland verpflichtete sich mit der Ratifizierung der UN-BRK, die Chancengleichheit von behinderten Menschen zu fördern, diese auf allen Ebenen umzusetzen sowie Diskriminierung gegen behinderte Menschen zu unterbinden. Dabei handelt es sich nicht um Sonderrechte von behinderten Menschen. Diese Menschenrechtskonvention zeigt vielmehr auf, was die bestehenden Menschenrechte für behinderte Menschen bedeuten und wie sie in den unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft umzusetzen sind. So soll die Ausübung der Menschenrechte unter Berücksichtigung der Verschiedenheit, die durch eine Behinderung hervorgebracht werden kann, gesichert werden. Ein besonderes Merkmal der Konvention ist demnach die Revision der vormals herrschenden Annahme, dass eine Behinderung die Möglichkeit der Wahrnehmung von Menschenrechten durch behinderte Menschen verhindere (vgl. Degener 2009).
Charakteristisch für die Konvention ist ihr starker Empowermentansatz (vgl. Bielefeldt 2006), die Bezugnahme auf die Menschenwürde und auf die Leitidee der Inklusion (vgl. Platte 2012). So fordert die UN-BRK die Partizipation behinderter Menschen in die Gesellschaft vor dem Hintergrund der sozialen Inklusion (»full and effective participation and inclusion in society«, Artikel 3, Buchst. c) mit dem Ziel »Raum und Rückhalt für die persönliche Lebensgestaltung« zu bieten (Bielefeldt 2006, 11). Theresia Degener, Mitglied des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, definiert Inklusion im Sinne der UN-BRK als ein »Prinzip der gleichberechtigten Partizipation unter Berücksichtigung der Menschenwürde und Anerkennung der Verschiedenheit der Menschen. Außerdem bedeutet Inklusion eine eindeutige Absage an separierende gesellschaftliche Systeme« (Degener/Mogge-Grotjahn 2012, 66). Damit untermauert die Konvention den Anspruch einer in unterschiedlichsten Bereichen selbstverständlichen Zugehörigkeit von behinderten Menschen und markiert das »strukturelle Unrecht«, wenn behinderte Menschen daran gehindert werden, ihr Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt mit anderen leben zu können (Bielefeldt 2006, 9).
Bielefeldt sieht das Anliegen, Ansprüche auf Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu formulieren, sie rechtsverbindlich zu verankern und mit möglichst wirksamen Durchsetzungsinstrumenten zu verknüpfen, in keiner anderen Menschenrechtskonvention in dem Maße abgebildet wie in der UN-BRK (Bielefeldt 2006, 4). Die Konvention erhält dadurch ein hohes Innovationspotential mit einer weitreichenden Bedeutung für die Menschenrechtstheorie im Allgemeinen, weil die in der UN-BRK verankerten Menschenrechte »jedem einzelnen […] die Position eines Subjekts gleichberechtigter Freiheit zuerkennen« und zugleich »eröffnen sie über ihre unverzichtbare negativ-abwehrende Funktion […] auch positive Möglichkeiten, Gemeinschaften und die Gesellschaft im Ganzen nach Gesichtspunkten von Freiheit und Gleichberechtigung weiter zu entwickeln« (ebd., 13).
1.1 Modelle von Behinderung und das menschenrechtliche Modell der UN-BRK
Zwar lässt sich in der UN-BRK keine dezidierte Definition von Behinderung finden, doch vermittelt diese durch ihre Inhalte ein Modell von Behinderung, das Degener als das menschenrechtliche Modell von Behinderung bezeichnet. So wird durch die UN-BRK einmal mehr mit der Vorstellung gebrochen, bei einer Behinderung handle es sich um eine individuelle Beeinträchtigung, wie es das medizinische Modell von Behinderung vermittelt. Das medizinische Modell von Behinderung betrachtet die individuelle körperliche, psychische oder kognitive Beeinträchtigung als Abweichung von einer Norm des vollumfänglichen »Funktionierens« und reagiert darauf mit Diagnose, Therapie und Förderung im Sinne der Minderung der individuellen Ursachen von Behinderung. Das menschenrechtliche Modell von Behinderung hingegen – heute offizielles Modell der europäischen Behindertenpolitik – ist auf die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen gerichtet und die Zugangsbarrieren, die behinderte Menschen aussondern und diskriminieren (vgl. Degener/Mogge-Grotjahn 2012).
Das menschenrechtliche Modell von Behinderung nimmt die Menschenwürde zum Ausgangspunkt, wobei die Schädigung bzw. Beeinträchtigung nicht übersehen wird. Mit dem Fokus auf behinderte Menschen als Menschenrechtssubjekte und dem daraus folgenden Blick auf die Umwelt und die Gesellschaft mit ihren exkludierenden Strukturen und verletzenden Verhaltensweisen werden Marginalisierungen und Benachteiligungen schließlich nicht mehr mit der Beeinträchtigung erklärt, sondern mit Ausgrenzungsmechanismen (vgl. Quinn/Degener 2002). »Dieses rechtsbasierte Modell von Behinderung basiert auf der Erkenntnis, dass die weltweite desolate Lage behinderter Menschen weniger mit individuellen Beeinträchtigungen als vielmehr mit gesellschaftlich konstruierten Entrechtungen (gesundheitlich) beeinträchtigter Menschen zu erklären ist und bildet so den Gegenpol zu einer an Bedürftigkeit orientierten Fürsorge- und Wohlfahrtspolitik« (Degener/Mogge-Grotjahn 2012, 69). Damit geht das menschenrechtliche Modell weiter als das soziale Modell (vgl. Oliver 1996; Barnes et al. 1999), das sich zu Beginn der 1980er Jahre als Reaktion auf das medizinische Modell entwickelte. Das soziale Modell verweist durch seine Unterscheidung zwischen Impairment (Schädigung) und Disability (Behinderung) zwar nicht auf ein individuelles Defizit, sondern geht von gesellschaftlichen Zusammenhängen aus, mit seiner strengen Dichotomie und der Annahme einer faktischen Beeinträchtigung unterliegt es aber der Kritik, die hinter den Entrechtungen steckende soziale Konstruktion und die kausale Beziehung zwischen Impairment und Disability zu übersehen (vgl. Waldschmidt 2005, Kastl 2010). Damit laufe das soziale Modell Gefahr, »sich in behindertenpolitischen Forderungen nach rechtlicher Gleichstellung und dem Abbau von räumlichen Barrieren […] zu erschöpfen« (Dannenbeck 2007, 106). Denn sowohl das medizinische als auch das soziale Modell (z.B. Oliver 1996) verfolgen das Ziel, Strategien und Lösungen für eine Störung zu entwickeln, die es zu beheben gilt.
Als Gegenpol dazu bezeichnen Degener und Mogge-Grotjahn den menschenrechtlichen Ansatz, durch den Behinderte nicht mehr länger als Objekte der Sozialpolitik, sondern als Bürgerrechtssubjekte gelten (Degener/Mogge-Grotjahn 2012, 69). Einen weiteren Gegenpol zum sozialen Modell von Behinderung bildet das kulturelle Modell von Behinderung, bei dem es verstärkt um ein vertieftes Verständnis der Kategorisierungsprozesse selbst geht. Die Dekonstruktion der ausgrenzenden Systematik und der damit einhergehenden Realität rücken in den Mittelpunkt der Analyse. Dabei wird nicht nur die Behinderung an sich hinterfragt, sondern das, was als »Normalität« bezeichnet wird: »Die kulturwissenschaftliche Sichtweise unterstellt nicht – wie das soziale Modell – die Universalität des Behinderungsproblems, sondern lässt die Relativität und Historizität von Ausgrenzungs- und Stigmatisierungsprozessen zum Vorschein kommen. Sie führt vor Augen, dass die Identität (nicht)behinderter Menschen kulturell geprägt ist und von Deutungsmustern des Eigenen und des Fremden bestimmt wird« (Waldschmidt 2005, o.S.).
Der Unterschied zwischen menschenrechtlichem und kulturellem Modell liegt also vor allem in der Akzentuierung. Mit einer rechtlichen Perspektive rückt erstes verstärkt Teilhabebedingungen in den Fokus, zweites blickt verschärft auf die Prozesse der Herstellung von Behinderung – in ihrer Kritik am sozialen Modell und der Absage an Sondersysteme sind sie miteinander verbunden.
Im Folgenden wird nun dargelegt, wie sich der »rechtspolitische Überbau« (in Abgrenzung zum rechtstheoretischen Überbau) der Behindertenbewegung (Degener 2009, 281) genau strukturiert. Dabei werden insbesondere relevante Inhalte der Konvention an der Schnittstelle von Migration und Behinderung vorgestellt.
1.2 Die UN-BRK im Kontext von Migration und Behinderung
Die UN-BRK besteht neben zwei Völkerrechtsverträgen aus einem Fakultativprotokoll mit 18 Artikeln und einem Übereinkommen aus 50 Artikeln (vgl. UN-BRK 2011). Das Übereinkommen wird von einer Präambel eingeleitet, die die gemeinsamen Grundsätze und Ziele der Vertragspartner artikuliert. Sie gilt als Orientierungsrahmen, die zwar von einer rechtlichen Unverbindlichkeit geprägt ist, gleichzeitig dienen die in der Präambel enthaltenen Grundsätze aber als Maßstab und Hilfsmittel zur Auslegung und Anwendung der UN-BRK (Kreutz et al. 2012, 64).
Die in dem Übereinkommen aufgezeigten Richtlinien sollen bei der Überwindung von Barrieren und Ausgrenzungen helfen und gleichzeitig die Rechte von behinderten Menschen schützen und fördern. Dabei werden zentrale Lebensbereiche berücksichtigt, wie zum Beispiel Bildung (Art. 24), Arbeit (Art. 27) oder das Zusammenleben (u.a. Art. 23), aber auch Aspekte wie politische Partizipation (Art. 29) oder der freie Zugang zu Informationen (Art. 21). Im Folgenden werden beispielhaft einige Bereiche der UN-BRK skizziert, die für die Fragestellung der Untersuchung und den Kontext Migration von besonderem Interesse sind.
Die UN-BRK und Migration
Zwar erhält die Kategorie Migration im Gegensatz z.B. zu Gender (Art. 6) keinen eigenen Artikel in der Konvention, allerdings wird in der Präambel an zwei Stellen auf weitere Heterogenitätsdimensionen im Kontext von Behinderung Bezug genommen. So sind die 50 Artikel des Übereinkommens »in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen mit Behinderung« (Präambel Buchst. i) vereinbart worden. Zudem betonen die Vertragsstaaten in Buchst. p ihre Sorge »über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung aufgrund der Rasse (sic!), der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind«.
Auch wenn die Präambel keine rechtliche Verbindlichkeit besitzt, schafft die UN-BRK durch die Anerkennung der heterogenen Lebenslagen von behinderten Menschen und dem Hinweis auf »verschärfte Formen der Diskriminierungen« unter Migrationsbedingungen dennoch eine Basis dafür, den Blick auf intersektionale Diskriminierung zu schärfen und um den Einbezug migrationsbedingter Faktoren fordern zu können. In diesem Kontext sind auch die darauffolgenden 50 Artikel zu verstehen.
Allgemeine Grundsätze
Die Grundgedanken der Freiheit, der Autonomie und der Nichtdiskriminierung (Buchst. a und b) werden direkt zu Beginn in den Allgemeinen Grundsätzen (Art. 3) aufgeführt und stellen die Kernelemente der Konvention dar. Sie handeln u.a. von der Achtung der Unterschiedlichkeit (Buchst. d), der Chancengleichheit (Buchst. e), der Zugänglichkeit (Buchst. f), der Achtung von den sich entwickelnden Fähigkeiten von behinderten Kindern und der Achtung ihres Rechts auf Identität (Buchst. h). Auch diese Grundsätze sind bei der Umsetzung der nachfolgenden Artikel des Übereinkommens stets zu berücksichtigen.
Allgemeine Verpflichtungen
Artikel 4 der UN-BRK regelt die allgemeinen Verpflichtungen, die die Vertragsstaaten eingehen. Da es sich um allgemeine Verpflichtungen handelt, beziehen sie sich auf alle Lebensbereiche, die von der UN-BRK erfasst werden, und wirken sich auf die Interpretation aller Artikel aus. Insofern erhält Absatz 1 (Art. 4) eine entscheidende Bedeutung. Darin verpflichten sich die Vertragsstaaten, die »volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderung ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern« (Artikel 4, Abs.1). Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten, und dies wird in neun Unterpunkten dezidiert aufgeführt u.a. zu geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung der in dem Übereinkommen anerkannten Rechte (Buchst. a), Handlungen und Praktiken, die dem Übereinkommen nach unvereinbar sind zu unterlassen (Buchst. d), alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisationen etc. zu ergreifen (Buchst. e) oder eine behindertenfreundliche Infrastruktur inklusive einer neuen Verwaltungspraxis zu etablieren (Buchst. f-i). Das Besondere der Allgemeinen Verpflichtungen ist – ...