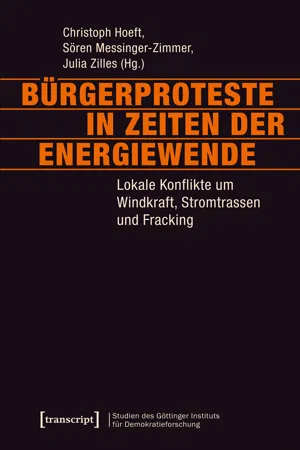![]()
Teil C:
Beteiligte und Unbeteiligte – Perzeption und Perspektiven
![]()
5 „Eigentlich füllen wir nur ein Verantwortungsvakuum aus.“
Die Konflikte aus Perspektive der Bürgerinitiativen
JULIA KOPP
Bürgerinitiativen im Bereich von Technologisierungsdebatten und Infrastrukturprojekten gelten entweder als „Be- und Verhinderer von technischem Fortschritt“1 oder als „glaubwürdige Anwälte von Bürgerinteressen und unverzichtbare Wegbereiter einer demokratisierten Technologiepolitik“2 – jeweils abhängig von der Perspektive des jeweiligen Akteurs/der jeweiligen Akteurin. So wird ein Unternehmen, das der Adressat von Protest ist, Bürgerinitiativen anders bewerten als ein(e) LokalpolitikerIn, der/die gute Kontakte zu lokalen Bürgerinitiativen pflegt und vielleicht die gleichen Ziele verfolgt. Die Perspektive der Bürger-Innen, die sich an dem Aushandlungsprozess von Infrastrukturprojekten beteiligen, vielleicht auch von diesen betroffen sind, auf jene, welche die Interessen der ansässigen Bevölkerung vertreten oder dies zumindest für sich in Anspruch nehmen, hängt wiederum von einer Vielzahl weiterer Aspekte ab, die von persönlichen Kontakten bis hin zu politischen Positionierungen reichen können. Dabei ist zu beachten, dass die Rolle der Bürgerinitiativen innerhalb der skizzierten Konflikte grundlegend verschieden zu den anderen AkteurInnen ist. Denn im Gegensatz zu den politischen RepräsentantInnen, Verwaltungen und Unternehmen ist die Rolle der Bürgerinitiativen kaum durch rechtliche Kompetenzzuweisungen, Verträge oder Aufträge geregelt.
Damit haben sie einerseits weniger Verantwortung zu tragen, sind nicht weisungsgebunden und unabhängiger von Fraktions- und Parteizwängen sowie Wirtschafts- und Unternehmenslogiken; andererseits verfügen sie jedoch über keinerlei Entscheidungskompetenzen und befinden sich damit in einer äußerst schwachen Ausgangsposition hinsichtlich ihres Einflusses auf den Verhandlungsverlauf. Ihre Rolle und ihre Einflussmöglichkeiten sind also davon abhängig, ob es überhaupt Beteiligungsverfahren gibt, wenn ja, wie diese beschaffen sind und wie durchlässig die Verfahren oder wie zugänglich die anderen Akteur-Innen im Konflikt für die Anliegen der Bürgerinitiativen sind. Dabei sind Bürgerinitiativen hauptsächlich auf die Ressourcen und Kompetenzen – wie Bildung, Zeit, und finanzielle Mittel – sowie den sozioökonomischen und -kulturellen Hintergrund ihrer aktiven Mitglieder angewiesen. Innerhalb der Bürgerinitiativen befördert dies eine hohe Repräsentanz von VetreterInnen ressourcenstarker Gesellschaftsschichten.
Aus politikwissenschaftlicher Perspektive wird darüber hinaus diskutiert, ob Bürgerinitiativen einen Mehrwert für das parlamentarische System, insbesondere in demokratietheoretischer Hinsicht, darstellen oder ob sie viel eher gesellschaftliche und soziale Ungleichheiten fördern, indem sie partikulare Interessen einer ressourcenstarken Bevölkerungsgruppe artikulieren und damit gerade nicht das mit ihnen verbundene partizipatorische Versprechen einlösen. So unterschiedlich die Einschätzungen zur Rolle von Bürgerinitiativen auch ausfallen mögen: Es zeigt sich, dass unabhängig von diesen Diskussionen Bürgerproteste wie Stuttgart 21 sowie Bürgerinitiativen seit den 1970er Jahren im Prozess politischer Entscheidungsfindung konstant an Bedeutung gewonnen haben.3 Sie sind zu einem festen Bestandteil politischer Konflikte geworden und als Akteurinnen nicht mehr wegzudenken, wenn es um Aushandlungsprozesse von Infrastrukturprojekten etwa im Bereich der Energiewende geht.4 Damit hängen die Dynamiken solcher Konflikte ganz wesentlich von den Bürgerinitiativen ab; insbesondere auf lokaler Ebene können solche Zusammenschlüsse die Stimmung vor Ort prägen. Die Sicht der Bürgerinitiativen auf die jeweiligen (politischen) Konflikte, in die sie involviert sind, gestaltet sich wiederum äußerst vielschichtig: Ihr Blick auf die beteiligten AkteurInnen und ihr Verhältnis zu diesen kann ihre Position dabei ebenso prägen wie etwa ihr Selbstverständnis, die von ihnen verfolgten Ziele oder auch ihre Wahrnehmung parlamentarischer Entscheidungsprozesse oder politischer RepräsentantInnen.
5.1 ZIELE UND KRITIK DER BÜRGERINITIATIVEN
Alle drei der hier untersuchten Bürgerinitiativen verfolgen jeweils dasselbe Ziel: Sie wollen das Projekt – zumindest in ihrer Region – verhindern. Damit stehen sie in grundsätzlicher Opposition zu denjenigen AkteurInnen, die das Projekt unterstützen; wobei sich die jeweiligen Konstellationen durchaus unterscheiden – je nach ihrer Position zu dem umstrittenen Projekt ist insbesondere die Kommunalpolitik mal Adressatin von Protest, mal „Verbündete“. Auch in der konkreten Ausdifferenzierung ihrer Ziele bestehen strukturelle Differenzen zwischen den Bürgerinitiativen der einzelnen Fallbeispiele: Die Bürgerinitiativen gegen Windparks lehnen zwar das jeweilige Projekt in Gänze ab, betonen aber immer wieder, nicht gegen Windenergie im Allgemeinen zu sein, und beziehen sich zumeist, wie auch im Fall SuedLink, generell positiv auf die Energiewende. Die Bürgerinitiativen gegen SuedLink sind in erster Linie darum bemüht, ihre Region aus den von der Umsetzung betroffenen Gebieten herauszulösen. Argumente gegen die Trasse als Ganzes und gegen das dieser zugrunde liegende Konzept der Energiewende sind weniger Motivation des Protests als Strategie, um die Ziele zu erreichen. Bei Fracking hingegen orientiert sich der Konflikt trotz der regionalen Verortung stärker an allgemeinen energiepolitischen und technologisch-ideologischen Fragen. Hier wird zwar auch konkret das einzelne Projekt kritisiert; eigentlich richtet sich der Protest jedoch grundsätzlich gegen diese Förderungstechnik.
In allen drei Konfliktfeldern bieten die Bürgerinitiativen Alternativen an oder verweisen auf solche. Damit wirken sie etwa dem Vorwurf entgegen, aus individuellen Gründen oder gar grundlos gegen das Projekt zu sein; stattdessen können sie sich als AkteurInnen mit sachbezogenem Interesse und dementsprechenden Forderungen präsentieren. Zudem ist dieses Moment der Versachlichung des Konflikts bzw. der Positionsbegründung der Bürgerinitiative auch eine Reaktion auf die den Bürgerinitiativen von anderen AkteurInnen unterstellte Emotionalität, welche Motivation ihres Protests sei und ihr Handeln anleite.
Zu den Zielen der Bürgerinitiativen gehört immer auch der Schutz von etwas, das man durch das jeweilige Vorhaben als bedroht oder gefährdet wahrnimmt. Das ist zumeist die Region, die jedoch unterschiedlich konnotiert wird. So nehmen WindkraftgegnerInnen eine vornehmlich kulturalistische Perspektive auf die Verbindung von Landschaft, Boden, Bevölkerung und Heimat ein. Ein Eingriff in die Landschaft bedeutet in diesem Verständnis dann eine mögliche Veränderung der Charakteristika von Land und Leuten. Auch bei den Bürgerinitiativen gegen Stromtrassen soll der Status quo aufrechterhalten werden; sie verweisen dabei aber stärker auf die Auswirkungen auf den Tourismus, Verletzungen des Naturschutzes oder Gesundheitsrisiken. Dabei ist das Verhältnis zum Natur- und Landschaftsschutz innerhalb der Bürgerinitiativen durchaus ambivalent: Einigen geht es auch gerade darum, die wahrgenommene Dominanz dieser Ziele in der Planung und den Verfahren zu brechen und den Menschen und seine Bedürfnisse zu einem legitimen Einspruchsgrund zu machen – was oft unter dem Begriff Menschenschutz thematisiert worden ist: „Naturschutz oder Artenschutz ist furchtbar wichtig, aber vergesst den Menschenschutz nicht.“
Neben den Zielen und ihren erklärten Forderungen, die alle Bürgerinitiativen mit ihrem Engagement zu erreichen versuchen, formulieren sie überdies eine Kritik, die trotz der unterschiedlichen Projekte, Akteurskonstellationen, Regionen und politischen Ausrichtungen stets ganz ähnliche Züge trägt: Sie kritisieren, dass wirtschaftliche Interessen und Gesichtspunkte bei der Umsetzung und Planung derartiger Infrastrukturprojekte weitaus größeren Wert hätten als die Orientierung „am Menschen“, um den es aber, so die Proklamation, bei politischen Entscheidungen und Maßnahmen gehen müsse. Diese Kritik ist neben den durchführenden Unternehmen auch an die politischen VertreterInnen gerichtet, die mit dem Protest der Bürgerinitiativen aufgerufen werden sollen, die Interessen ihrer BürgerInnen und WählerInnen zu berücksichtigen. So kritisieren etwa die Bürgerinitiativen gegen den SuedLink die „bürger- und naturschutzfeindliche Planung“5, womit sie sich zwar zuvorderst gegen TenneT als das die Planung durchführende Unternehmen, aber eben auch an die politischen Verantwortlichen, die ihrer Meinung nach deren Kontrollauftrag nicht nachkommen, wenden. Wird diese Kritik jedoch von politischer Seite aufgenommen, wird dieses Bemühen vonseiten der Bürgerinitiativen nur selten goutiert. Gerade die Bürgerinitiativen gegen Windenergie äußern teils scharfe Kritik an politischen VertreterInnen. Diese betrachtet man als die maßgeblich Verantwortlichen, von denen man bitter enttäuscht ist und denen man oft mit starkem Misstrauen begegnet; wobei in den untersuchten Fällen häufig die (mitregiereden) Grünen besonders betroffen sind.
„Der größte Gegenspieler ist die Dummheit! Ja, vertreten in unserem Falle durch die Ministerpräsidentin, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Die hat also wirklich Leuten von uns gegenübergesessen, und hat gesagt: ‚Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das nicht gemacht. Aber jetzt haben wir’s gemacht.‘ Ja. So etwas an verantwortlicher Stelle, gell. […] Wobei es schon auffällt, seit die Frauen in Rheinland-Pfalz das Sagen haben, läuft so vieles verkehrt, gell.“
Dieses Misstrauen gegenüber politischen VertreterInnen sowie demokratischen Institutionen oder vermeintlich unabhängigen AkteurInnen wie der Wissenschaft tritt auch in der Kritik und im Handeln der AktivistInnen gegen Fracking deutlich hervor.
5.2 SELBSTVERSTÄNDNIS DER BÜRGERINITIATIVEN
Die untersuchten Bürgerinitiativen sehen sich selbst als Interessenvertretungen der ansässigen Bevölkerung sowie des jeweiligen Ortes oder der Region. Somit formulieren sie aus ihrer Perspektive nicht nur ein individuelles Anliegen oder das einer abgrenzbaren Gruppe, sondern eine Art objektives Interesse von Region und betroffenen AnwohnerInnen. Denn diese, so die Argumentation, würden im Grunde denselben Standpunkt einnehmen, wären sie auf demselben Wissensstand wie die Aktiven der Bürgerinitiativen. Gegenüber der Bevölkerung nehmen die Engagierten in den Initiativen also eine Art Vorreiterrolle in Anspruch – indem sie konstatieren, mehr zu wissen als die anderen und dadurch bereits einen Schritt weiter zu sein. Im Hinblick auf PolitikerInnen, Parteien und Unternehmen stellen sie ihr Selbstverständnis sicher, auf Augenhöhe mit diesen Eliten zu sein, und erfüllen im Selbstbild die von diesen nicht wahrgenommene Aufgabe der Verantwortung für Region und Menschen:
„Wir haben die ganze Zeit hier einen Teil von gesellschaftlicher Verantwortung übernommen, weil sie an anderer Stelle nicht gelebt wird. Eigentlich füllen wir nur ein Verantwortungsvakuum aus.“
So stellt die Bereitstellung von Informationen für die Bevölkerung und für kommunale PolitikerInnen eine zentrale Aufgabe der Bürgerinitiativen dar; das Ziel lautet Aufklärung – über technische Daten des Projekts, seine Vor- und Nachteile, Planungen, Alternativen –, um darüber schließlich vor Ort zu mobilisieren. Verstehen sich die Bürgerinitiativen somit sowohl als Sprachrohr wie auch als eine Art Dienstleisterin, streben sie über diese Aufbereitung von Information und Wissen obendrein eine Kontrolle der mit den Planungs- und Entscheidungsprozessen beauftragten politischen und wirtschaftlichen AkteurInnen an oder wollen zumindest eine Grundlage schaffen, um deren Handeln zu beurteilen. Das entspricht dem Verständnis von Bürgerinitiativen als zivilgesellschaftlichem Kontrollmoment derer, die oberhalb der BürgerInnen in Zusammenarbeit mit wirtschaftlichen Eliten Entscheidungen treffen, und trifft damit durchaus auch eines der Kennzeichen von Zivilgesellschaft, die sich – definitorisch in Abgrenzung zu den Bereichen Politik und Wirtschaft – in ihrer historischen Genese u. a. als bürgerlicher Freiraum gegenüber dem Staat entwickelt hat. Eine oppositionelle Rolle einzunehmen, einen kritischen Blick zu pflegen, Skepsis zu bewahren – die allerdings teilweise bereits in Misstrauen umschlägt –: All das gehört zu diesem Verständnis und wird von den Bürgerinitiativen als Qualitäten bzw. Kompetenzen und Ressourcen angesehen.
Dies wiederum steht in engem Zusammenhang mit dem StaatsbürgerInnen-Begriff d...