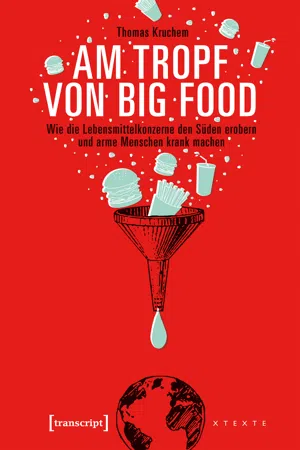![]()
1. Der stille Hunger
1.1 STILLER HUNGER IN BANGLADESCH
In der Grundschule des Dorfes Badatoli im Süden von Bangladesch deutet Lehrerin Sumea Nasrin auf vier still in der Bank sitzende Kinder – Kinder mit leerem Blick, denen der Glanz der Neugier in den Augen fehlt; viel zu klein für ihr Alter. »Ich mache mir große Sorgen um sie. Ständig sind sie müde. Sie können sich nicht konzentrieren und verstehen fast nichts von dem, was ich ihnen erkläre. Mindestens 20 unserer 200 Kinder sind betroffen.« Die Kinder bekämen außer Reis nichts Richtiges zu essen, sagt Sumea mit resigniertem Achselzucken.
Eine Ursache der in Bangladesch verbreiteten chronischen Mangelernährung springt dem Besucher sofort ins Auge. Auf fast allen bebaubaren Flächen steht nichts als Reis. Gemüsefelder, Obstbäume, Rinder, Ziegen und Hühner sind nur vereinzelt zu sehen. Für diese Konzentration der Landwirtschaft auf den Reisanbau gibt es gute Gründe: Bis vor 30 Jahren erlebte Bangladesch immer wieder Hungersnöte; heute kann das kleine Land mit einer Fläche von gerade zweimal Bayern seine 160 Millionen Menschen selbst mit Reis versorgen; viele Bauern ernten dreimal im Jahr.
»Reissicherheit jedoch ist keine Ernährungssicherheit«, sagt Sukanta Sen, Leiter der lokalen Hilfsorganisation BARCIK. »Der bei uns ausschließlich gegessene polierte Reis enthält fast nichts außer Kohlenhydraten.«
Andere Nahrung ist oft außer Reichweite für die meisten Bangladescher: Milch, zum Beispiel, ist extrem teuer. Denn immer weniger Bauern halten Kühe, weil es ihnen an Futter fehlt. Freie Weideflächen gibt es kaum mehr. Und weil der heute angebaute Hochertragsreis kürzere Halme hat als traditionelle Reissorten, gibt es weniger Stroh. Auch Hühnerfleisch ist knapp: Seit die Bauern zur Zeit der Vogelgrippe vor einigen Jahren ihre Hühner töten mussten, scheuen sie das Federvieh wie der Teufel das Weihwasser.
Schließlich: Immer weniger Fische, die gern gegessen werden, tummeln sich in Bangladeschs Flüssen, Teichen und Reisfeldern – weil die Flüsse zusehends versanden, weil zum Schutz des Reisanbaus vor Fluten Tausende Dämme und Deiche das Land durchziehen; weil zahlreiche zuvor öffentliche Teiche privatisiert wurden. Dort betreiben jetzt kommerzielle Unternehmen Aquakultur für den Konsum der Wohlhabenden und für den Export.
Die Privatisierung, klagt Sukanta Sen, habe auch öffentliche Landflächen erfasst, wo sich früher Millionen Menschen mit wild wachsendem Obst und Gemüse versorgten. »Heute sind fast alle Brachflächen verpachtet.« Auch Obst und Gemüse werden deshalb immer teurer. Äpfel, Mandarinen und Trauben, die aus Indien und China importiert werden, können sich ohnehin nur wenige leisten.
Bittere Armut großer Teile der Bevölkerung ist denn auch eine weitere Ursache der Mangelernährung in Bangladesch – Armut insbesondere auch alleinstehender Mütter wie Rumela Katun, die außerhalb der Stadt Mymensingh im Straßenbau arbeitet – für 2.000 Taka, umgerechnet 23 Euro, im Monat. »Ich habe drei Söhne von zehn, acht und fünf Jahren«, erzählt die ausgezehrt wirkende Frau. »Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Das Geld, das ich verdiene, reicht gerade so für Reis, Chili und ein paar Kartoffeln. Manchmal muss ich meine Kinder mit leerem Magen zur Schule schicken.«
Frauen wie Rumela Katun können keine Vorräte anlegen; sie müssen kleinste Portionen Reis und Dal, Linsen, teuer auf dem Markt kaufen. Und viele erliegen der Versuchung, billiges Kesari Dal zu essen. Kesari Dal – die Saat-Platterbse, wissenschaftlich Lathyrus sativus – ist eiweißreich, braucht zum Gedeihen wenig Wasser und zum Garen wenig Brennholz. Häufiges Essen dieser Hülsenfrucht jedoch führt zur chronischen Nervenkrankheit Lathyrismus, die früher auch in Europa verbreitet war. Zu den Symptomen zählen Lähmungen, Krämpfe und Tremor.
Im Süden des 17-Millionen-Molochs Dhaka taucht der Besucher in ein Labyrinth aus schmalen, von Fahrradrikschas und Ochsenkarren befahrenen Wegen ein. Zwischen Hütten und Kiosken aus Bambus, Wellblech und Plastikplane steht ein etwas größeres Betonhäuschen. Hier betreut die lokale Hilfsorganisation BRAC Frauen im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft.
»Ich arbeite in einer Textilfabrik«, erzählt die hochschwangere und kaum einen Meter 45 große Afsana Begum, »von morgens um acht bis abends um acht. Zum Essen komme ich nur zwischendurch.« »Afsana hat zu wenig zugenommen und wirkt anämisch«, kommentiert die Ärztin Nauruj Jahan. »Fast alle Frauen, die unser Zentrum besuchen, haben mit kaum 16 Jahren geheiratet und wurden schwanger, bevor sie ausgewachsen waren. Fast alle essen zuhause nur, was die Männer übrig lassen; sie essen bei Schwangerschaftsübelkeit sogar weniger als sonst; fast alle arbeiten bis kurz vor der Geburt. Eine regelmäßige Folge: schwere Anämie, die das Kind schädigt und das Leben der Mutter gefährdet.«
Die Hebammen des BRAC-Zentrums können die Auswirkungen nur mildern: Sie beraten und betreuen die Frauen; sie geben ihnen Tabletten mit Eisen und Folsäure sowie nach der Geburt eine Vitamin-A-Kapsel. Die versorgt das Baby mit dem lebenswichtigen Vitamin – wenn es denn, wie empfohlen, sechs Monate lang von der Mutter gestillt wird – und zwar exklusiv, ohne jede Zufütterung.
Aber nur 55 Prozent der Mütter in Bangladesch halten sich an diese Empfehlung. »Ein miserabler Wert, aber besser als in vielen anderen armen Ländern«, sagt UNICEF-Mitarbeiterin Noreen Prendiville und kritisiert zugleich unzureichende Hygiene. »Gerade zwei Prozent der Mütter waschen sich die Hände, bevor sie ihr Baby stillen. Die Babys werden deshalb öfter krank.«
Außerdem gehen Millionen arme Frauen spätestens sechs Monate nach der Geburt wieder arbeiten. Mittelschichtsfrauen überlassen ihr Baby dann einem oft überforderten Hausmädchen, Frauen in Armenvierteln der acht- oder zehnjährigen Schwester des Babys. »In der Folge bekommt das Kleinstkind, wenn es Glück hat, Reisbrei mit Zucker zu essen«, klagt Erica Roy Khetran von der US-Hilfsorganisation Helen Keller International. »Allzu oft aber bekommt das Kind Schokolade, Chips und aufgeweichte Kekse vom nächsten Kiosk.«
1.2 DAS PHÄNOMEN CHRONISCHER MANGELERNÄHRUNG
Die Ernährungssituation in fast allen Entwicklungs- und Schwellenländern ist bis heute schlecht – vielfach ähnlich schlecht wie in Bangladesch: Nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF sind Hunger und Mangelernährung in all ihren Formen verantwortlich für den Tod von 3,1 Millionen Kindern jährlich oder 45 Prozent aller Todesfälle bei Kindern (Black et al. 2013).
Fast 800 Millionen Menschen können noch immer nicht ihren täglichen Kalorienbedarf decken. 50 Millionen von 670 Millionen Kindern unter fünf Jahren sind wasted: Sie sind akut unterernährt bzw. untergewichtig – vor allem wegen eines dramatischen Mangels an Energie und Proteinen.
Zugleich leiden zwei von sieben Milliarden Menschen an einem nagenden Hunger, der weniger sichtbar ist und deshalb »stiller Hunger« genannt wird: chronische Mangelernährung. Die Betroffenen mögen genug Energie aufnehmen; doch es fehlt ihnen an Proteinen und Mikronährstoffen wie Vitamin A, Eisen, Vitamin D, Kalzium, Jod oder Zink. Erst seit wenigen Jahren nehmen Regierungen und Entwicklungshilfe die Folgen dieser chronischen Mangelernährung wirklich zur Kenntnis. Die vielleicht schlimmste Folge nennen Experten stunting – womit die englische Sprache unverblümt Verkrüpplung und irreversible Entwicklungsstörungen bezeichnet. Fast jedes vierte von 670 Millionen Kindern unter fünf Jahren weltweit ist in diesem Sinne verkrüppelt infolge chronischer Mangelernährung: stunted.
Die Kinder sind im Wachstum zurückgeblieben und werden lebenslang ihr körperliches und geistiges Entwicklungspotential nicht ausschöpfen. Sie bleiben zu klein und leiden unter kognitiven Einschränkungen; ihr Stoffwechsel funktioniert nicht richtig; sie sind besonders anfällig für Infektionskrankheiten und im Erwachsenenalter für Fettleibigkeit sowie Diabetes.
Stunting entsteht vor allem in den ersten tausend Lebenstagen eines Kindes – in der Zeit von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag. In dieser Zeit erlittene Entwicklungsschäden infolge von Mangel- oder Unterernährung sind kaum mehr rückgängig zu machen.
- Infolge des starken Mangels an spezifischen Nährstoffen leiden mehrere hundert Millionen Kinder, unterschiedlich ausgeprägt, an Mangelkrankheiten:
- Der Eiweißmangelkrankheit Kwashiorkor, deren Ursachen allerdings nicht nur in zu geringem Proteinkonsum zu suchen sind (vgl. Kismul et al. 2014), ist besonders im südlichen Afrika verbreitet. Wassereinlagerungen und eine vergrößerte Leber führen zum typischen Symptom des Hungerbauchs.
- Vitamin-A-Mangel, an dem weltweit 200 Millionen Kinder leiden (Hodge 2014), führt zu Sehbeeinträchtigungen oder gar Blindheit sowie zu einem erhöhten Sterberisiko.
- Jodmangel führt zum Struma (Kropf) und, in schweren Fällen, zu geistiger Behinderung.
- Niacinmangel führt zu Pellagra, einer Erkrankung, die Darm- und Hautprobleme, Tremor sowie psychische Störungen mit sich bringt.
- Eisenmangel führt zu Anämie, von der weltweit 300 Millionen Kinder betroffen sind (Hodge 2014).
Von chronischer Mangelernährung und stunting betroffene Menschen hat der Autor in nahezu jedem afrikanischen oder südasiatischen Dorf gesehen, das er besucht hat. Viele Menschen dort essen von frühester Kindheit an fast nur polierten Reis oder Mais; viele Kinder wirken antriebsschwach; sie leiden oft an chronischen Atemwegsinfektionen oder Durchfall. Und besonders schlimm betroffene Erwachsene führen eine randständige Existenz im Dorf: Sie finden keine Ehepartner und sterben früh.
1.3 URSACHEN VON MANGELERNÄHRUNG
Armut und Ungleichheit
Zu den zentralen Ursachen von Mangelernährung zählt verbreitete Armut in betroffenen Gesellschaften: Die Menschen haben nicht genug Land bzw. Geld, sich Nahrungsmittel für eine gute Ernährung zu beschaffen und diese gesundheitsfördernd zuzubereiten. Diese Not wird vielerorts durch zu kurz aufeinanderfolgende Schwangerschaften verschärft.
Die WHO schätzt, dass 56 Prozent der mangelernährten Kinder in afrikanischen und 36 Prozent in asiatischen Entwicklungsländern leben – in wirtschaftlich sehr unterschiedlich strukturierten Ländern: Im armen Äthiopien etwa sind zwei Drittel der heute erwachsenen Bevölkerung Opfer von stunting (Thurow 2014); in den Schwellenländern Indien und Südafrika gibt es genug Geld und Nahrung, diese sind jedoch extrem ungleich verteilt.
Da die meisten Menschen weltweit heute in Städten leben, sind in etlichen Ländern inzwischen mehr Stadtbewohner mangelernährt als Bewohner des ländlichen Raums: 62 Prozent der Stadtbewohner im Afrika südlich der Sahara und 35 Prozent der Stadtbewohner Südasiens leben in Slums. Sie haben zwar meist besseren Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, Wasser und sanitären Anlagen als Bewohner des ländlichen Raums; aber sie sind Preiserhöhungen bei Lebensmitteln deutlich schutzloser ausgesetzt als Dorfbewohner, die selbst Lebensmittel anbauen.
Die Benachteiligung von Frauen
Eine wichtige Rolle als Ursache von Mangelernährung spielen auch sozioökonomische und -kulturelle Faktoren. Sie betreffen vor allem Frauen und Mädchen in armen Gesellschaften: Zahllose Frauen arbeiten körperlich hart für das Überleben der Familie; sie sind von häuslicher und anderer Gewalt betroffen und leiden in der Folge an chronischem Stress. Besonders in Südasien sind unter armen Frauen Depressionen verbreitet.
Frauen essen auch häufig als Letzte in der Familie und bekommen dann nur Überbleibsel. Und wenn die Familie am Essen sparen muss, sind in der Regel zuerst Frauen und Mädchen betroffen.
Frauen, die so leben, sind in hohem Maße mangelernährt, insbesondere anämisch. Sie bringen deshalb häufig untergewichtige und bei der Geburt bereits mangelernährte Kinder zur Welt. Sie stillen oft nicht oder nicht regelmäßig; der Milch dieser Frauen mangelt es nicht selten an Nährstoffen, weil sie selbst nicht ausreichend versorgt sind.
Später bekommen die Kinder nicht die richtige bzw. richtig zubereitete Beikost: Statt Milchprodukten, Eiern, Gemüse, Obst, Fleisch oder anfangs auch Komplementärnahrung in Pulverform wird stärkereicher, aber protein- und mikronährstoffarmer Reis-, Mais- oder Maniokbrei zugefüttert. Die Beikost wird zudem oft unhygienisch zubereitet, weil es den Frauen an sauberem Wasser und gut nutzbaren Kochstellen fehlt. Die Kinder bekommen dann häufig Durchfall und parasitäre Erkrankungen (Würmer, Bilharziose) – was ihre Ernährungssituation weiter verschlechtert.
Fehlendes Wissen
Mit traditionellen Einstellungen verbundenes Unwissen führt oft dazu, dass die Bevölkerung ganzer Regionen sich einseitig oder mit giftbelasteten Lebensmitteln ernährt. Viele Menschen im südlichen Afrika essen fast ausschließlich Mais oder Maniok, ohne die nährstoffreichen Blätter zu verzehren. Viele Menschen in Südasien essen fast nur polierten Re...