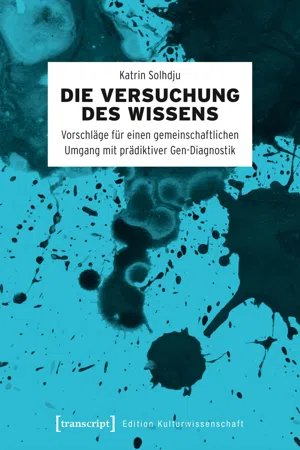
eBook - ePub
Die Versuchung des Wissens
Vorschläge für einen gemeinschaftlichen Umgang mit prädiktiver Gen-Diagnostik
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Versuchung des Wissens
Vorschläge für einen gemeinschaftlichen Umgang mit prädiktiver Gen-Diagnostik
Über dieses Buch
»Es wird unerträglich werden!« – Medizinische Einschätzungen auf Grund von prädiktiven Gentests sind eine moderne Form des Fluches – mit unerbittlich sicheren Folgen. Ausgehend vom Fall Alice Rivières, deren Test auf die Huntington-Krankheit positiv ausfällt, zeigt Katrin Solhdju die Fallstricke im Umgang mit einer existentiell bedrohlichen Form des Zukunftswissens auf: Wie lässt sich solcher Gewalt denkend begegnen? Wo lassen sich begriffliche, epistemologische und imaginative Elemente auffinden, ihr effektiv entgegenzuwirken? Und was sind die »ökologischen« Bedingungen für einen kunst vollen und gewalt armen Umgang mit dieser modernen Variante des Vorherwissens?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Versuchung des Wissens von Katrin Solhdju im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Social Sciences & Social History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Dritter Teil: Zukunftskünstler
EINE »SPEKULATIVE ERZÄHLUNG«
Stories are much bigger than ideologies. In that is our hope.
DONNA HARAWAY1
Tippt man auf YouTube die Suchanfrage »Huntington’s Disease« ein, trifft man grob gesagt auf zwei Arten von Dokumenten. Zum einen sind dort kurze Filme zu sehen, die das Format der Informationsbroschüre reproduzieren – sie erklären die genetischen Hintergründe der HD anhand von Schaubildern und geben in möglichst neutraler Tonlage Auskunft über Symptome, klinischen Verlauf und Pflegeoptionen. Zum anderen klickt man sich durch einen Reigen qualitativ mittelmäßiger, privat gedrehter Dokumentationen, die einem Gruselkabinett in nichts nachstehen: Düstere Räume, in denen eine bis aufs Skelett abgemagerte Frau auftaucht, die wahnwitzig-irrende, in ihrer offenbaren Hilflosigkeit beängstigende Tanz-Fall-Torkel-Bewegungen vollführt, werden hier von Narrativen juveniler Formen der HD überboten, in denen sich Kleinkinder von niedlichen rennenden Wesen in ununterbrochen zappelnde und letztlich bewegungslose Schwerstkranke verwandeln – begleitet von den Kommentaren der vor Angst und Verzweiflung erstarrten Kinder, Eltern oder Geschwister. Dem ärztlich und kulturell eingeübten Bilder-Sprechen über HD als einer monströsen Form moderner Besessenheit ohne Aus- und Umwege wird hier unter teils gutgemeint aufklärerischer, teils schlicht verzweifelt einsamer Mitarbeit von Betroffenen gewissermaßen die Krone aufgesetzt.
Im Oktober 2013 hat sich zu diesen filmischen Materialien ein ganz anderes Video hinzugesellt, nämlich die erste Communication du Docteur Olivier Marboeuf.2 Dabei handelt es sich um den Monolog eines Neurologen, der über die Gründungsgeschichte der von ihm geleiteten experimentellen, pluridisziplinären Forschungseinrichtung berichtet, die von Pflegenden und Betroffenen gemeinsam erdacht wurde und sich mit der HD sowie dem sie betreffenden Test auseinandersetzt. Während des gesamten Kurzfilms sieht man den Arzt in seinem Sprechzimmer am Schreibtisch sitzen, er spricht offenbar zu seinen ›Peers‹ einerseits und zu von dieser Krankheit auf die eine oder andere Weise Betroffenen – Risikopersonen, Familienangehörigen und Pflegenden – andererseits. Dr. Marboeuf erzählt zunächst, dass er als Mitarbeiter eines der so genannten Referenzzentren, die den präsymptomatischen Test in Frankreich anbieten, immer wieder in die Situation gerät, Risikopersonen für die Huntington-Krankheit mit ihren Testergebnissen konfrontieren zu müssen.
Er wolle, sagt Dr. Marboeuf, von der Begegnung mit einer Patientin und deren Schwester sowie den Effekten, die diese Begegnung auf ihn hatte, Zeugnis ablegen. Im letzten Jahr hätten ihn die beiden Frauen auf eine ihm bis dahin unbekannte Weise dazu herausgefordert, die eigene Praxis, aber auch sein stabil geglaubtes Wissen über die Huntington-Krankheit selbst, ihre Symptome, ihre Dramatik und ihre Verlaufsformen in Frage zu stellen. Alles habe damit begonnen, dass er die junge Frau über ihren ungünstigen genetischen Status informiert, ihr die Anzahl ihrer CAG-Wiederholungen mitgeteilt und ihr die gewohnten Hinweise für verfügbare sowohl medizinische als auch psychologische und sozialfürsorgliche Hilfestellungen vermittelt hat. Aber diese Patientin reagierte anders als alle, die er zuvor erlebt hatte: mit einem Wutausbruch. In harschen, aber klaren Worten habe sie ihm zu verstehen gegeben, dass sie keinesfalls wünsche jemals wieder mit ihm oder seinem Team in Kontakt zu treten oder gar ihre Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, woraufhin sie türknallend den Raum verlassen und ihn vollkommen fassungslos zurückgelassen habe.
Einige Monate später, so Dr. Marboeuf, habe ihn dann die Schwester eben dieser Patientin angerufen und um einen Termin gebeten. Zu diesem Termin seien die zwei Frauen gemeinsam erschienen, das Gespräch aber habe die Schwester der Getesteten geführt. Auch sie, erzählt der Arzt weiter, klagte ihn ganz explizit an. Immer wieder insistierte sie auf einer einzigen variierten Frage: »Wie können Sie wissen, was meiner Schwester zustoßen wird?«, »Wie können sie genau wissen, was ihr zustoßen wird«, »Wie können sie wissen, was genau meiner Schwester zustoßen wird?« Dr. Marboeuf berichtet, wie er sich zu rechtfertigen versucht habe, wie er defensiv reagiert und deutlich gemacht habe, dass es seine Pflicht als Spezialist sei, mit Genauigkeit zu informieren, klar zu sein, keine falschen Hoffnungen zu wecken etc. »Warum sagen Sie nicht, dass Sie nicht wissen?«, konterte die Schwester. Das sei seiner Position als Arzt nicht angemessen, antwortet er. »Es gibt aber Leute, die sagen, dass sie nicht wissen«, reklamierte sie. Dann habe sie ihm von dem auf Huntington-Kranke spezialisierten Atlant-Institut im niederländischen Apeldoorn berichtet, das sie besucht habe. Die dort geleistete Pflege sei auf allen Ebenen ganz phantastisch und die Huntington-Kranken, die in diesem Zentrum lebten, seien trotz fortgeschrittener Krankheitsentwicklung keineswegs in desolaten Zuständen, sondern wirkten durchaus lebenslustig. Als Dr. Marboeuf die beiden Frauen am Ende des Gesprächs mit einem »bis hoffentlich bald« verabschiedete, habe die Schwester ihre Forderung in aller Konsequenz deutlich auf den Punkt gebracht: »Wir kommen erst wieder, wenn Sie dazu in der Lage sein werden zu sagen, dass Sie nicht wissen!« Frustriert und auch ein wenig genervt habe er die beiden Frauen ziehen lassen und sich gesagt, dass er sie aller Wahrscheinlichkeit nach nie wiedersehen würde.
Dennoch, diese denkwürdige Begegnung hatte seine Neugierde geweckt. Als er im Juni 2013 an einem Kongress in den Niederlanden teilnahm, habe er beschlossen, seinen Aufenthalt um einen Tag zu verlängern, um besagtes Atlant-Institut in der Stadt Apeldoorn zu besuchen. »Das ist schon beeindruckend«, gibt er zu, wie dort der Alltag der Kranken gestaltet ist – maßgeschneidert nennt er die vor Ort praktizierte Pflege. Zurück in Frankreich stellt sich Dr. Marboeuf die Frage, »was ich tun kann?« Denn in Anbetracht der Erfahrungen, die er im Atlant-Institut gesammelt hat, erscheinen ihm die Ansprüche seiner Patientin und ihrer Schwester weniger extravagant. Er muss vielmehr zugeben, dass sie mit ihrer Forderung »nicht ganz Unrecht haben«. Daraufhin, so endet dieses erste Video, habe er beschlossen, bei seiner Klinikverwaltung einen Antrag auf Finanzierung einer kleinen experimentellen Forschungseinheit zu stellen, in deren Rahmen sich Mediziner und Pflegepersonal gemeinsam mit Patienten und deren Familien mit unterschiedlichen Aspekten der Huntington-Krankheit und ihrer Diagnose auseinandersetzen sollen. Diese Einheit, die den Namen Alice Rivières trägt, sei im September 2013 von der Klinikleitung bewilligt worden und habe im März 2014 die Arbeit aufgenommen. Und dies, so Dr. Marboeuf, sei erst der Anfang!
Als Abspann des Films ein einziger Satz: »Posté depuis un monde possible à construire ensemble, Septembre 2014«, d.h. »Gepostet aus einer möglichen Welt, die es gemeinsam zu konstruieren gilt, September 2014«. Allein dieser Satz weist den gesehenen Film nicht als Dokumentation, sondern eindeutig als Fiktion aus. Und zwar zunächst durch den zeitlichen Index. Zuerst in einer Plenarsitzung des World Congress of Huntington’s Disease 2013 in Rio de Janeiro gezeigt und im Anschluss daran auf YouTube gestellt, spielte die Erzählung des Dr. Marboeuf sich offensichtlich in der Zukunft ab. Forscht man genauer nach, stellt sich heraus, dass weder Dr. Marboeuf noch die Unité Alice Rivières außerhalb dieses Videos existieren. Ein Hoax also? Nein: ein Köder!
Bei besagtem Video handelt es sich um das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Filmemachers Fabrizio Terranova, Mitglied von Dingdingdong – Institut zur Koproduktion von Wissen über die Huntington-Krankheit – und des Performance- und Erzählkünstlers Olivier Marboeuf. Gemeinsam haben sie ebenso wie ich für dieses Buch, die Geschichte Alice Rivières zum Anlass für ihre Arbeit genommen und sie auf ihre Art und Weise aufgegriffen. Damit folgen sie einem Arbeitsprinzip, das sich für Dingdingdong als konstitutiv erwiesen hat. Diesem Prinzip zufolge gilt es Ideen, die uns am Herzen liegen, im wortwörtlichen Sinne zum ›schäumen‹ zu bringen. Neue Ideen werden von den Mitgliedern des Kollektivs nicht schlicht zur Kenntnis genommen, sondern unter anderen Vorzeichen und mit diversen Mitteln aufgegriffen, wiederholt und variiert, um ihnen auf diesem Wege eine Konsistenz, eine eigene Dichte zu verleihen. Diese Arbeit der wiederholten Aufnahmen und Reprisen, davon sind wir überzeugt, ist unabdingbar, wenn es darum geht, unsere Vorschläge weiter zu präzisieren und sie im Zuge dessen zunehmend wirklicher werden zu lassen. Während Alices Erzählung mich dazu verpflichtet hat, in die Geschichten des präsymptomatischen Tests einzutauchen und mich mit verschiedenen Aspekten einer Geschichte der modernen Medizin auseinanderzusetzen, um das, was in der diagnostischen Situation auf dem Spiel steht, besser begreifen zu können, ist sie für Terranova und Marboeuf zur Gelegenheit geworden, ein neues Genre zu kultivieren: Die ›spekulative Erzählung‹. Die zentrale narrative Strategie dieses Genres besteht, so ließe es sich auf den Punkt bringen, darin, jene Bedingungen zu versammeln, derer es bedarf, um eine noch unverbürgte Idee wahr werden zu lassen. Und zwar nicht im Allgemeinen, sondern stets in Bezug auf ganz konkrete Konfliktsituationen. Spekulatives Erzählen zeichnet sich dadurch aus, prädeterminierten Verläufen alternative Versionen entgegenzusetzen, sie zu irritieren und zu beeinflussen.3 Anders als in den meisten Science-Fiction-Geschichten, liegt der Ausgangspunkt der marboeufschen Erzählung denn auch weder zeitlich noch situationell in der fernen Zukunft. Vielmehr nimmt er eine reale Erfahrung zum Ausganspunkt und spinnt diese an verschiedenen Stellen durch kleine Verschiebungen und vorsichtige Ergänzungen lediglich minimal, dabei aber doch entscheidend weiter. Zwischen der aktuellen und der erzählten Realität klafft also kein Abgrund, es werden keine unwahrscheinlichen oder unmöglichen Begebenheiten geschildert. Es handelt sich weder um den Entwurf einer Utopie (eines Unorts) oder Uchronie (einer Unzeit) noch um ein Gedankenexperiment, das die Effekte einer oder mehrerer kontrafaktischen Annahmen durchspielen würde.
Vielmehr fabuliert der Erzählkünstler Marboeuf alias Dr. Marboeuf vor laufender Kamera eine in der nahen Zukunft gelegene Situation, in der mehrere der aktuellen Realität entnommene Elemente – die Wut der Getesteten und ihrer Schwester, Reflexionen zum Recht auf Wissen und Nicht-Wissen, die Erfahrungen im Atlant-Institut – miteinander konspirieren. Durch ihr synergetisches Zusammenwirken wird es in dieser Wirklichkeit möglich geworden sein, ein Forschungslabor zu gründen, das es sich zur Aufgabe macht, neue Versionen der Huntington-Krankheit zu erforschen und zu implementieren. Schritt für Schritt zeichnet seine Erzählung den Weg nach, auf dem sich dieses Zusammentreffen ergeben haben könnte, und verfolgt so eine Taktik der narrativen Sensibilisierung, die trotz der Situierung in der Zukunft der bekannten, konfliktreichen Wirklichkeit radikal die Treue hält. Allerdings nicht ohne durch ebenso situiertes und konsequentes Weiterdenken am »Aufflackern eines anderen Lebens«4 der Huntington-Krankheit und ihrer Tests zu arbeiten.
Der Erzählkünstler hat seinen Bericht ausgehend von Elementen konstruiert, die ihm ›vorgegeben‹ waren – Marboeuf war mit der HD nie zuvor in Berührung gekommen und orientierte sich an dem Material, das wir ihm vorlegten. Dennoch ist es ihm improvisierend gelungen, auch seine Stichwortgeberinnen zu überraschen und ihren Reflexionen neue Dimensionen bzw. Zugriffe zu eröffnen. Dies ist vor allem mit Blick auf Marboeufs entscheidenden Vorschlag der Fall, der Schwester die so außergewöhnliche Forderung in den Mund zu legen, der zufolge der Mediziner zuzugeben lernen soll, dass er nicht wisse, was seiner Patientin zustoßen wird. Diese von Marboeuf erfundene Forderung, die das narrative Gravitationszentrum seiner Rede bildet, lässt mindestens drei Lektüren zu.
Die erste Lesart dreht sich um die Weigerung der beiden Schwestern, passive Opfer eines zur absoluten Wahrheit stilisierten medizinischen Wissens zu werden. Dr. Marboeuf soll nicht vorgeben, es handele sich bei dem prädiktiven Wissen, das er vermittelt, um »die sichere Antwort auf eine von aller Ewigkeit her gestellte Frage«. Die von der Schwester formulierte Forderung verpflichtet Dr. Marboeuf vielmehr dazu, die Diagnose »wie eine unsichere Antwort auf eine im Willen um provisorisches Wissen erfundene und hervorgerufene Frage«5 zu behandeln, die zwar richtungsweisend ist, nicht aber mit einer eindeutigen und abschließenden Erklärung verwechselt werden darf.
Auf einer zweiten, verwandten Ebene lässt sich das Drängen der Schwester als Erinnerung daran lesen, dass der Verlauf der HD von Person zu Person stark divergiert. Sie ermahnt Dr. Marboeuf wenigstens implizit dazu, das objektive Wissen über eine Krankheit nicht mit der subjektiven Erfahrung eines Lebens mit dieser Krankheit gleichzusetzen. Im Englischen bringt dies die etablierte Unterscheidung zwischen den Begriffen disease und illness auf den Punkt: Während disease eine medizinisch definierte Krankheitseinheit »im Gegensatz zu anderen Krankheiten« adressiert, verweist der illness-Begriff auf die je konkrete Patientenperspektive, darauf also, »was Patienten erleben und beschreiben«. Disease wird ärztlich diagnostiziert, illness ist »das subjektive Gefühl fehlender Gesundheit einer Person«.6 Nimmt man diese Differenzierung und damit zugleich die Vieldeutigkeit oder den multiperspektivischen Charakter jeder Krankheit ernst, zwingt dies zu einer Reihe von Veränderungen. Zunächst einmal macht die Anerkennung des Unterschieds es notwendig, eine Haltung zu etablieren, von der aus es gilt, auch solche Patienten ernst zu nehmen und therapeutisch zu begleiten, die an Symptomen – etwa an chronischen Schmerzen – leiden, ohne dass es gelingt, diese auf der disease-Ebene auf anerkannte, objektive, einer Kausallogik gehorchende Gründe zurückzuführen. Andererseits aber lässt die Unterscheidung von disease und illness auch solche Situationen denkbar werden und vielleicht sogar auslösen, in denen das Krankheitserleben weniger ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort von Isabelle Stengers
- Einleitung
- Erster Teil: Die vielen Leben eines Tests
- Zweiter Teil: Erkundungen
- Dritter Teil: Zukunftskünstler
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Danksagung