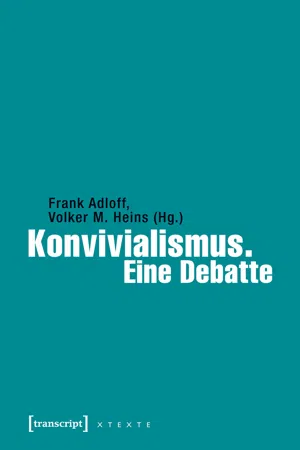![]() Ökonomie
Ökonomie![]()
Konvivialität und Degrowth
Zur Rolle von Technologie in der Gesellschaft
Andrea Vetter, Benjamin Best
PROBLEMAUFRISS
Welche Rolle spielen Technologien für eine konviviale Gesellschaft? An einer Stelle definiert das konvivialistische Manifest deutlich, welche Rolle es dem technischen Fortschritt zuweist:
»Da von den Ländern, die seit Jahrhunderten der Natur am meisten entnommen haben, und denen, die erst damit beginnen, nicht die gleiche ökologische Anstrengung verlangt werden kann, obliegt es den wohlhabendsten, dafür zu sorgen, dass ihre Naturentnahmen im Vergleich zu den Standards der 1970er Jahre regelmäßig sinken. Wenn sie ihre derzeitige Lebensqualität bewahren wollen, muss der technische Fortschritt vorrangig diesem Ziel gelten, um den Raubbau maßgeblich zu verringern. Absolute Priorität hat die Senkung des CO2-Ausstoßes und die Nutzung der erneuerbaren Energien anstelle der Kernkraft und der fossilen Energien.« (S. 67f.)
Das Manifest behandelt die Rolle von Technologien ansonsten nur marginal. Dabei sind Technologien mit ihren Pfadabhängigkeiten von entscheidender Bedeutung für eine sozial-ökologische Transformation.
Unsere These ist, dass das Technologiekonzept des Manifests letztlich implizit dem Effizienzgedanken und der Entkopplungsidee einer ›ökologischen Modernisierung‹ verhaftet bleibt. Das Manifest versäumt es, darüber nachzudenken, was es hieße, wenn Technologien selbst konvivial würden – und damit ein Perspektivwechsel hin zu sozio-technischen Systemen als konstitutiv für menschliches Zusammenleben stattfände. Es ist an der Zeit, das Nachdenken über konviviale Technik – Ausgangspunkt der ersten Diskussionswelle um Konvivialität in den 1970er Jahren – zu erneuern.
IVAN ILLICH UND DIE KONVIVIALITÄT
Ivan Illich hat den Begriff der Konvivialität in den 1970er Jahren mit seinem Buch »Tools for Conviviality« geprägt (Illich 1973). Im deutschen Vorwort zum Manifest wird er erwähnt (S. 11, 14), im Manifest selbst kommt er jedoch nur implizit vor. Im Gegensatz zu Alain Caillé und dem konvivialistischen Manifest spricht Illich jedoch nicht von »Konvivialismus«, sondern von »Konvivialiät«. Das macht einen großen Unterschied, denn was bei Illich eine Eigenschaftsbeschreibung ist – eine Gesellschaft oder Situation oder Institution kann »konvivial« sein – ist im Manifest zu einem Denksystem oder einer Totalität geronnen, die den Begriff eines seiner positiven Elemente beraubt: der Verweis auf das Unabgeschlossene und Unplanbare, das der Konvivialität als flüchtiger Eigenschaft zwischen Menschen oder von Menschen geschaffenen Artefakten und Beziehungssystemen innewohnt.
Das Manifest fällt in vielen Formulierungen in der Radikalität hinter Illich zurück: so heißt es, anzustreben sei, »[e]ine universalisierbare konviviale Gesellschaft aufzubauen, die das Ziel verfolgt, allen einen hinreichenden Wohlstand zu sichern, ohne ihn von einem unmöglich und gefährlich gewordenen stetigen starken Wachstum zu erwarten« (S. 71). Illich hingegen ging es gerade nicht um das Universalisierbare, sondern um die Pluralität und das Partikulare, welches miteinander in einen Dialog tritt; es ging ihm gerade nicht darum, »Wohlstand zu sichern«, sondern den Menschen ihre Befähigung nicht zu nehmen, sich selbst um ihre konkreten Anliegen zu kümmern; und es ging ihm auch darum, die industrielle Wachstumslogik in ihrer Ganzheit als problematisch abzulehnen, weil sie die Menschen in Abhängigkeiten von Institutionen treibt.
An anderer Stelle wird der Bezug auf Illich und die Denkrichtung des Post-Development jedoch wiederum sehr deutlich, wenn die Autor_innen davon sprechen, dass »die modernen politischen Ideologien als solche – Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus oder Anarchismus – […] die Menschen für bedürftige, nicht für begehrende Wesen« (S. 51) halten, und deshalb Wirtschaftswachstum als Lösung angesehen worden sei. Illich – und insbesondere Wolfgang Sachs u. A. – machen immer wieder das Problem deutlich, dass allen Menschen im Rahmen des Entwicklungsdiskurses der Nachkriegszeit ›Bedürfnisse‹ (im englischen: needs) unterstellt werden, die einen Großteil der Menschen zu ›Unterentwickelten‹ machen, weil bestimmte Bedürfnisse, die aber andere Menschen definieren, nicht erfüllt seien. Illich hingegen spricht von »konvivialer Armut«, also davon, dass mit weniger als einem Dollar täglich in einer Gesellschaft, in der Geld keine Rolle spielt, durchaus ein konviviales und würdiges Leben möglich ist; oder dass ein Mangel an formalisierter Schulbildung keineswegs problematisch sein muss, wenn Menschen ihr Bedürfnis nach persönlicher Entwicklung und Lernen befriedigen können.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was Illich mit »Werkzeugen« für die Konvivialität meint: »The crisis can be solved only if we learn to invert the present deep structure of tools; […] People need new tools to work with rather than tools that ›work‹ for them. They need technology to make the most of the energy and imagination each has, rather than more well-programmed energy slaves.« (Illich 1973: 10, unsere Hervorhebung)
Mit Werkzeug (tool) meinte Illich dabei sowohl eigentliche handwerkliche Werkzeuge als auch Geräte, Maschinen und ›Produktionsstätten‹ für materielle und immaterielle Güter. In diesem Aufsatz wird der Begriff der »konvivialen Technik« dagegen in einem engeren Sinne für technologische Artefakte und Infrastrukturen genutzt.
In den 1970er Jahren entstand rund um Illichs Diskussionsanstoß eine breite öffentliche Debatte um die Rolle von Technik in der Gesellschaft – Begriffe wie alternative, sanfte, radikale oder angepasste Technik wurden im deutschsprachigen Raum vor allem in der Zeitschrift »Technologie und Gesellschaft. Das Magazin zur Wachstumskrise« (erschienen 1975-1980 bei Rowohlt) diskutiert, deren Mitherausgeber Ivan Illich und André Gorz waren. Stoßrichtung der Diskussionen war neben der Ablehnung gefährlicher Großtechnologien, allen voran der Atomkraft, vor allem der Aufbau anderer Infrastrukturen und der Entwicklung neuer Technologien wie Windkraft oder Solarenergie. Doch während die aus der praktischen Anwendung dieser Diskussionen hervorgegangen Kollektivbetriebe und Kleinunternehmen im Laufe der 1980er und 90er Jahre zur Keimzelle der heute erfolgreichen grünen Technologien wurden, wurde vergessen, dass die »Tiefenstruktur der Werkzeuge« (Illich, s.o.) damit keineswegs umgekehrt wurde, sondern neue komplizierte Expertentechnik und ein neuer Markt geschaffen wurde, der zusätzlich zu den alten Strukturen auf Gewinnerzielung ausgerichtet war. Von der Begeisterung über die neue grüne Technik war es kein großer Schritt mehr zur Mainstream-These der ›ökologischen Modernisierung‹, die man auch aus dem Manifest herauslesen kann und die bekanntermaßen davon ausgeht, dass technische Innovationen das Problem der Verknappung der Energieressourcen lösen können. Damit war nicht die Tiefenstruktur der Werkzeuge, sondern Illichs intellektueller Impuls in sein Gegenteil verkehrt worden.
ENTKOPPLUNG DURCH TECHNISCHEN FORTSCHRITT – DAS GEGENTEIL VON KONVIVIALITÄT?
Ivan Illichs Kritik richtete sich gegen die Ökonomisierung der Gesellschaft, gegen soziale Ungerechtigkeit im globalen Maßstab, die Zumutung von Bedürfnissen und die Schwächung von individuellen und kollektiven Fähigkeiten. Diese Form der ganzheitlichen und kritischen Herangehensweise ist so gut wie ausgestorben, spielt allerdings z.B. in Ökodörfern, Transition Town-Initiativen und der Tiefenökologie wieder eine Rolle. Im heutigen Mainstream-Nachhaltigkeits- und Wissenschaftsbetrieb wird dagegen Wert darauf gelegt, sich nicht im Widerspruch zum gesellschaftlichen Mainstream und der Wachstumswirtschaft zu befinden. Das Manifest nimmt dieses Problem ins Visier und kritisiert:
»Hinzuzufügen ist noch, dass sie [die Standardwirtschaftswissenschaft] sich als ebenso unfähig erweist, der Endlichkeit der Natur Rechnung zu tragen, da sie voraussetzt, dass sich die erschöpften oder zerstörten natürlichen Ressourcen immer durch die von der Wissenschaft und der Technik erzeugten Ressourcen werden ersetzen lassen. Eine vorrangige intellektuelle und theoretische Aufgabe besteht also darin, die Wirtschaft und die Wirtschaftswissenschaft in ihre Schranken zu verweisen und insbesondere den Blick letzterer wieder auf all die Teile der Realität zu richten, die sie bewusst oder unbewusst vernachlässigt hatte.« (S. 56f.)
Es ist sicher eine gewaltige Aufgabe, der Endlichkeit der Natur Rechnung zu tragen und kreative wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln. Konvivialistische Denk- und Handlungsansätze sind aber dann zum Scheitern verurteilt, wenn sich im etablierten Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft und an der massiven Zuweisung finanzieller Mittel an eine einseitig technologisch ausgerichtete Forschung nicht grundlegend etwas ändert. Deren technologische und wirtschaftliche Lösungen wirken vielfach als Problemverstärker, da sie sich in alten Paradigmen bewegen, die gerade die Ursache für ökologische Probleme waren. Es herrscht heute ein fast beängstigender Technikoptimismus: die globalisierte Wachstumsökonomie soll weiterexistieren, entkoppelt von schädlichen Nebenwirkungen und ökologischer Abhängigkeit. Diese Idee zieht sich dabei wie ein roter Faden durch politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche (High-Tech-)Agenden.
Wird ökologische Verantwortung jedoch allein an Technologien delegiert, während die Steigerungs- und Wachstumslogik unangetastet bleibt, können sich selbst einstige Hoffnungsträger wie Elektromobilität und erneuerbare Energien in Monstrositäten verwandeln. Hybrid-SUVs, Vorort-Einfamilienhäuser mit PV- und Solarthermieanlagen und mit vielerlei elektronischen Gadgets ausgestattete Menschen – statt nachhaltiger Kultur, Konvivialismus und small is beautiful – diese Technologien stehen für eine fortgesetzte Industriemoderne unter anderen Vorzeichen. Neuere Studien zeigen, dass eine absolute Entkopplung auf diese Weise nicht erreicht werden kann (vgl. Madlener/Alcott 2011). Nach einigen Wissenschaftlern ist Entkopplung durch investive Maßnahmen nicht einmal theoretisch möglich (vgl. Paech 2012).
Um nicht missverstanden zu werden: aus unserer Sicht spricht das nicht gegen erneuerbare Energien und Öko-Effizienz. Jedoch kann deren Ausbau allein noch nicht zu einer Entkopplung führen, wenn sich nicht gleichzeitig eine starke kulturelle und emotionale Kopplung zwischen Menschen und zur natürlichen Mitwelt entwickelt. Diese alternative Kopplungsidee erkennen wir in der Idee einer konvivialen Gesellschaft.
Der Wandel zu einer starken Kopplung zwischen Menschen untereinander und mit der Natur kann dabei von Bezügen zu Konzepten anderer (vormoderner) Gesellschaftstypen profitieren. Die »Logik der Gabe« von Marcel Mauss ist hierfür ein hervorragendes Beispiel, das einen beziehungsstiftenden Typus des vormodernen Güterverkehrs adressiert. Dieser könnte in modernen Formen der Tausch- und Schenkökonomie und der Peer-to-Peer-Produktion wiederentdeckt werden. Das trifft sich mit einer zentralen Forderung der Wachstumskritik, für die eine Ökologisierung der Gesellschaft ohne eine teilweise Deökonomisierung und Demonetarisierung nicht denkbar ist. Dieser Ansatz unterscheidet sich jedoch radikal von den angesprochenen Lösungsvorschlägen der etablierten Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften, die eher auf Knappheitssignale, Kommodifizierung und die Zuweisung von Eigentumsrechten setzt.
Das Bild der Kopplung soll implizieren, dass Menschen eine Faser in einem umfassenden Netz des Lebens sind und wir unsere Verbundenheit mit der Natur zu einem Teil der lebendigen Erfahrung werden lassen können. So wissen wir zwar kognitiv, dass Menschen von einem funktionierenden Ökosystem abhängig sind; dass Menschen aber tatsächlich einatmen, was Bäume ausatmen, ist noch nicht Teil ihrer Alltagserfahrung. Wenn nun die Natur in die Städte zurückkehrt, die Stadt-Land Dichotomie abnimmt, könnten unmittelbare Naturerfahrungen zunehmen und die Menschen sich möglicherweise mehr als Teil der Natur begreifen. Damit könnte sich das Umweltbewusstsein in der Breite steigern und so auch der Naturschutz eine neue Grundlage bekommen, weil es bei dem Schutz von Bäumen, Flüssen und Bienen nicht mehr um die Bewahrung von etwas Externen geht, sondern um Selbstschutz der Menschen. Es ist dieser wichtige Schritt, der in der Unterscheidung von »Umwelt« und »Mitwelt« angedeutet wird.
Einsichten dieser Art würden folgenlos bleiben, wenn wir sie nur in moralische Appelle übersetzen würden. Daher stellen wir uns, im Anschluss an Ivan Illich die Frage, wie Technologien selbst konvivial gestaltet werden können.
KONVIVIALE TECHNIK — DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT EINE ANDERE RICHTUNG GEBEN
Was meint nun eine konviviale Technik heute ganz konkret? Das Manifest spart nicht mit positiven technischen Visionen, vor allem, was die Informationstechnologien angeht:
»Die Informations- und Kommunikationstechnologien vervielfachen die Möglichkeiten persönlicher Kreativität und Verwirklichung, ob im Bereich der Kunst, der Wissenschaft, der Erziehung, der Gesundheit, der Teilnahme an den Belangen des Gemeinwesens, des Sports oder der menschlichen Beziehungen überall in der Welt. Das Beispiel von Wikipedia oder Linux zeigt das Ausmaß dessen, was auf dem Gebiet der Erfindung und des Austauschs von Praktiken und Kenntnissen möglich ist.« (S. 43)
»Das Internet, die neuen Technologien und die Wissenschaft werden im Dienst der Errichtung dieser sowohl lokalen wie weltweiten, sowohl tief verwurzelten wie offenen Zivilgesellschaft stehen. Auf diese Weise zeichnet sich ein neuer Progressivismus ab, frei von jedem Ökonomismus und von jedem Szientismus sowie von der automatischen Annahme, dass ein ›Mehr‹ oder ›Neues‹ mit dem Besten identisch ist.« (S. 72)
Das Internet, die »neuen Technologien« und die »Wissenschaft« können diese ihnen zugedachte Rolle aber nur erfüllen, wenn sie selbst ihr Wesen ändern, ihre »Tiefenstruktur«, wie Illich das genannt hat. Konviviale Technik bezieht sich nicht auf die neueste »grüne Technologie«, die ja wie beispielsweise ein benzinsparendes Auto nur »grün« in Bezug auf den weniger effizienten Vorgänger ist, aber keine Lösung für die Frage bereit hält, wie ein Mensch sich auf konviviale Weise fortbewegen könnte. Deshalb muss bei der Betrachtung, was genau eine konviviale Technik sein könnte, Technik als sozio-technisches System zwischen Menschen, Artefakten und Organischem betrachtet werden, und Effizienz nur eine Unterkategorie unter vielen anderen werden.
Ein Vorschlag zur Bewertung der Konvivialität einer Technik ist der »Kompass der konvivialen Technik« (KKT). Er bewertet fünf verschiedene Dimensionen (Beziehungsqualität, Zugänglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Biointeraktion, Ressourcenintensität) auf verschiedenen Ebenen (Infrastruktur, Herstellung, Nutzung, Entsorgung/Wiederverwertung) für ein bestimmtes technisches Artefakt in einem ganz bestimmten zeitlichen und räumlichen Kontext. Fragen, die in diesem Rahmen an eine Technik gestellt werden können, sind beispielsweise:
Beziehungsqualität: Welche Art der Interaktion zwischen Menschen fördert es? Ist die Nutzung (kulturell, ökonomisch oder juristisch) verpflichtend oder steht die (Nicht-)Nutzung...