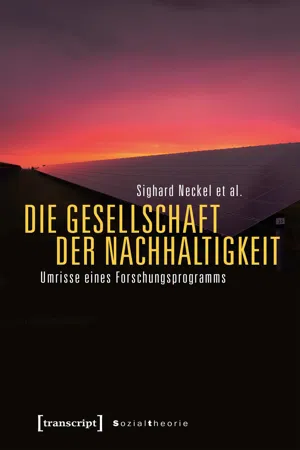Subjektivierung von Nachhaltigkeit
Sarah Miriam Pritz
Sozialer Wandel verändert nicht nur die Gesellschaft insgesamt, sondern wesentlich auch deren Mitglieder, insofern Gesellschaftsordnungen auch stets in Subjekten verankert sind und sich gesellschaftlicher Wandel in diesen selbst vollzieht. Soziale Transformationsprozesse sind also nicht nur Umwälzungen auf der ›Außenseite‹ der Gesellschaft, ihrer spezifischen sozialstrukturellen, institutionellen und kulturellen Bedingtheit und Charakteristik, sondern führen gleichzeitig zu Veränderungen und Verschiebungen auf der ›Innenseite‹ des Subjekts – in den jeweiligen Subjektentwürfen und -idealen, den Selbstverhältnissen und Steuerungsformen, kurz: den Modi der Subjektivierung.
Der gesellschaftliche Wandel hin zu Nachhaltigkeit subjektiviert sich dabei in zweifacher Weise: Zum einen sind Individuen sozialem Wandel nicht einfach nur ausgeliefert, sondern gestalten diesen aktiv mit und werden mitunter auf vielfältige Weise angehalten, dies zu tun. Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit als gesamtgesellschaftliches Entwicklungsziel, wie es sich beispielsweise im Brundtland-Bericht (WCED 1987) artikuliert, lassen sich vielfach Subjektivierungstendenzen in dem Sinne feststellen, dass Nachhaltigkeit verstärkt als Aufgabe und Verantwortung der Subjekte begriffen wird. »Ökologische Intelligenz« steht hoch im (Dis-)Kurs (z.B. Goleman 2012). Subjekte werden vor allem in ihrer Rolle als verantwortliche Konsumenten und Konsumentinnen angesprochen: Das gesamtgesellschaftliche Ziel der Nachhaltigkeit ist in diesem Sinne vor allem über den ›richtigen‹ Konsum bzw. den ›richtigen‹ Konsumverzicht – kurz: die ›richtige‹ Lebensweise zu erreichen. Zum anderen subjektiviert sich Nachhaltigkeit in der Weise, dass auch die Subjekte selbst zunehmend mit Problemen der ›Vernutzung‹ und Erschöpfung ihrer subjektiven Ressourcen zu kämpfen haben, die sich besonders nachdrücklich in Krisenerfahrungen wie Stress, Burnout oder Depression zeigen (vgl. Neckel/Wagner 2013a). Es scheint der »Zustand des Ausgelaugtseins« zu sein, »der Personen, soziale Schichten, den Wachstumskapitalismus und das Ökosystem krisenhaft miteinander verbindet« (Neckel/Wagner 2013b: 204).
Zugespitzt formuliert lässt sich also Folgendes konstatieren: Während das gesamtgesellschaftliche Entwicklungsziel Nachhaltigkeit wesentlich auch als ein auf der Ebene der Subjekte zu lösendes Problem verhandelt wird, wird subjektive Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund einer zunehmenden Vernutzung und Erschöpfung auch subjektiver Ressourcen gleichzeitig selbst zum Handlungsproblem und Leitprinzip für das Subjekt und sein Ressourcenmanagement. Der Handlungsmodus der Nachhaltigkeit verankert sich also in subjektiven Selbstverhältnissen und verändert die gesellschaftlichen Modi der Subjektivierung. Die damit verknüpften kulturellen Programme und Praktiken der Selbststeuerung drehen sich um Maximen wie Achtsamkeit, Empathie, Wellness, Work-Life-Balance oder Resilienz. Nachhaltigkeit verändert die Art(en) des Subjekt-Seins und bringt spezifische Subjekte hervor. Nachhaltigkeit subjektiviert sich, wirkt aber gleichzeitig auch subjektivierend und findet in öffentlich-medial kolportierten Sozialfiguren wie z.B. dem Loha – Lifestyle of Health and Sustainability (Ray/Anderson 2000) ihre typisierte Personifikation.
Um eine soziologische Perspektive auf Modi der Subjektivierung unter dem Vorzeichen einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit zu eröffnen, werde ich zunächst das Konzept der Subjektivierung kurz theoretisch skizzieren. Hiernach folgt die Darstellung von zwei verschiedenen Akzentuierungen der Subjektivierung von Nachhaltigkeit, die dann in einer Erörterung dreier kultureller Programme und Praktiken subjektiver Nachhaltigkeit vertieft werden. Ein Ausblick auf weiterführende Fragen zu Nachhaltigkeit als Subjektivierungsprogramm schließt meine Betrachtungen ab.
SUBJEKTIVIERUNG: ZEITDIAGNOSE UND SOZIALTHEORETISCHES KONZEPT
In den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften lassen sich grundlegend zwei Verwendungsweisen des Begriffs »Subjektivierung« unterscheiden: Einerseits wird Subjektivierung recht allgemein in einem eher zeitdiagnostischen Sinn zur Bezeichnung einer gesteigerten gesellschaftlichen Bedeutung des Subjekts und einer Subjektivierung gesellschaftlicher Verhältnisse verwendet. Insofern steht Subjektivierung dem Begriff der »Individualisierung« nahe, der seit den Anfängen der Soziologie als einer ihrer umkämpften und facettenreichen Kernbegriffe gelten kann (für einen Überblick vgl. Schroer 2008). Eine prominente Zeitdiagnose zur Subjektivierung findet sich in der Arbeits- und Industriesoziologie, wo unter dem Begriff der »Subjektivierung von Arbeit« im Sinne einer gesteigerten Bedeutung und In-Wert-Setzung des ›ganzen Menschen‹ inklusive seiner subjektiven Eigenschaften eine der wesentlichen Dimensionen des Wandels der gegenwärtigen Arbeitswelt verhandelt wird (z.B. Kocyba 2000; Moldaschl/Voß 2002; Lohr 2003; Arbeitsgruppe SubArO 2005). Andererseits bezeichnet Subjektivierung ein sozialtheoretisches Konzept, das die Entstehung von Subjektivität in sozialen Prozessen und Relationen beschreibt. Als solches lässt sich Subjektivierung als genuin soziologische Wendung des klassischen philosophischen Subjektbegriffs innerhalb (post-)strukturalistischer Theorieströmungen begreifen. Die Frage, wer oder was das Subjekt denn sei, wird im Rahmen der Subjektivierungstheorie umformuliert in die Frage, »wie es geworden ist« (Saar 2013: 17). Während in der traditionellen Subjektphilosophie das Subjekt essentialistisch und universalistisch als der Gesellschaft quasi vorsozial gegenüberstehend gedacht wurde, betont das Konzept der Subjektivierung den »permanenten Prozess, in dem Gesellschaften und Kulturen die Individuen in Subjekte umformen« (Reckwitz 2017: 125). Es gibt kein wie auch immer geartetes ›Außerhalb‹ des Prozesses der sozialen Subjekt-Werdung: In seiner lateinischen Doppelbedeutung als zugleich unterworfen wie auch autonom handelnd entsteht das subiectum im Spannungsfeld zwischen Fremd- und Selbstführung (vgl. ebd.: 126). Gesellschaft wirkt über die Repräsentation von Subjektpositionen in kulturellen Diskursen und Programmen subjektivierend; allerdings erst in deren Aneignung bringen sich Subjekte als solche handelnd hervor. Das Subjekt wird also einerseits durch die Gesellschaft konstituiert, insofern diese bestimmte historisch, sozialstrukturell und (sub-)kulturell spezifische Subjekttypen entwirft, und konstituiert sich zugleich im Versuch der praktischen Einnahme und Anverwandlung derselben selbst. Dieser Prozess des »doing subjects« (Reckwitz 2016) ist allerdings nicht kultur- oder diskursdeterministisch zu verstehen, da gerade in der Notwendigkeit der praktischen Aneignung von Subjektpositionen Möglichkeiten des Widerstands, des Scheiterns, der Um- oder Neudeutung enthalten sind.
Zentraler Dreh- und Angelpunkt von Praktiken der Subjektivierung ist der Körper; Subjektivierung bedeutet stets: Inkorporierung, Einverleibung und Verkörperung von Gesellschaft und ist in dieser Hinsicht wesentlich mit anderen Konzepten – wie beispielsweise dem des Habitus (Bourdieu) – verwandt, die von einer wechselseitigen Beeinflussung und Formung von Individuum und Gesellschaft im Kontext von Machtverhältnissen ausgehen.
Wenngleich eher allgemein zeitdiagnostische und systematisch sozialtheoretische Verwendungsweisen des Begriffes der Subjektivierung unterschieden werden können, schließen sich diese beiden Akzentuierungen keineswegs aus; vielmehr sind mit subjektivierten gesellschaftlichen Verhältnissen jeweils spezifische Modi der Subjektivierung verknüpft. Subjektivierung von Nachhaltigkeit bedeutet also zugleich immer auch Subjektivierung durch Nachhaltigkeit.
SUBJEKTIVIERUNG VON NACHHALTIGKEIT
Prozesse der Subjektivierung von Nachhaltigkeit lassen sich in zweifacher Hinsicht beobachten: Einerseits wird gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit zunehmend subjektiviert (auch) als Aufgabe und Verantwortung des Subjekts in seiner Lebensführung verstanden, andererseits wird subjektive Nachhaltigkeit verstärkt selbst zum Handlungsproblem für das Subjekt im Umgang mit seinen subjektiven Ressourcen.
Nachhaltigkeit als Aufgabe und Verantwortung des Subjekts in seiner Lebensführung
Seit der erstmaligen Beschreibung des Konzepts in der preußischen und sächsischen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts (Carlowitz 2000 [1713]) wird Nachhaltigkeit im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen der Umwelt als zentrale Aufgabe eines (selbst-)verantwortlichen Subjekts gesehen. Die Verantwortung bestand ursprünglich in dem einfachen Grundsatz, nur so viel Holz zu schlagen wie auch nachwachsen kann. Kriterien der Wirtschaftlichkeit standen dabei im Vordergrund, weshalb sich Nachhaltigkeit soziologisch durchaus als Rationalisierungsphänomen deuten lässt: »Nachhaltigkeit hieß, die Einnahmen auf Dauer zu stellen, sie berechenbar zu machen – und sie zu steigern.« (Kaufmann 2004: 174).
Spätestens als die Folgen der menschlichen Vernutzung und Zerstörung von Ressourcen im Zuge der sozialen Bewegungen seit den 1970er Jahren immer breitere gesellschaftliche Thematisierung erfuhren und der Wandel hin zu Nachhaltigkeit zunehmend zum gesellschaftlichen Leitmotiv avancierte, hat sich diese Aufgabe und Verantwortung des Subjekts ausdifferenziert und verallgemeinert. Subjekte werden in Gesellschaften der Gegenwart vielfach angerufen, sich ›nachhaltig‹ zu verhalten, womit ganz unterschiedliche Dinge gemeint sein können: weniger Auto zu fahren und dafür mehr den öffentlichen Verkehr oder das Fahrrad zu nutzen, wenn möglich lieber den Zug statt das Flugzeug zu nehmen, auf die Energieeffizienz von elektronischen Geräten oder die Wärmebilanz ganzer Häuser zu achten sowie ökologisch und sozial nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu konsumieren. Zahlreiche Instanzen der Zertifizierung und Prämierung von nachhaltigen Produkten und Unternehmen haben sich herausgebildet, die Nachhaltigkeitsentscheidungen im Alltag lenken und erleichtern sollen (siehe den Beitrag von Timo Wiegand).
Eine so verstandene subjektivierte Nachhaltigkeit drückt sich beispielsweise im Konzept des »ökologischen Fußabdrucks« (Rees/Wackernagel 1994) aus, mit welchem die Fläche der Erde berechnet werden kann, die notwendig ist, um den jeweiligen Lebensstil eines Individuums zu ermöglichen. Dieses Konzept, das »Nachhaltigkeitspostulate auf das Individuum herunterrechnet«, »hält in diesem Sinne dazu an, sich selbst zu regieren« und »sämtliche Aspekte seines Lebens zu prüfen« (Kaufmann 2004: 179). Es betrachtet Nachhaltigkeit als Aufgabe des Subjekts und seiner Lebensführung, subjektiviert Nachhaltigkeit also einerseits, während es andererseits auch wesentlich subjektivierende Wirkungen entfaltet, indem es Individuen anruft, ihr eigenes Leben dem Handlungsprinzip der Nachhaltigkeit folgend zu gestalten, die sich dadurch als ›nachhaltige‹ – also problembewusste und verantwortliche – Subjekte hervorbringen.
In ähnlicher, wenngleich anders akzentuierter Weise artikulieren sich in Daniel Golemans Modell der Ökologischen Intelligenz (2012) Tendenzen einer Subjektivierung von Nachhaltigkeit. Goleman, der durch seinen Bestseller Emotionale Intelligenz (1995) bekannt geworden ist, entdeckte ökologische Intelligenz vor allem in der »Empathie für alles, was lebt« (Goleman 2012: 50):
»Während soziale und emotionale Intelligenz auf der Fähigkeit gründen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, mit ihnen zu fühlen und unsere Sorge zum Ausdruck zu bringen, erweitert die ökologische Intelligenz diese Fähigkeit auf alle Natursysteme. Eine solche Empathie beweisen wir jedes Mal, wenn wir angesichts dessen, dass die Erde ›leidet‹, selbst leiden oder beschließen, etwas zum Besseren zu verändern.« (Ebd.)
Kollektiv wirksam werde die ökologische Intelligenz vor allem als »Schwarmintelligenz«, die durch die Befolgung von »Schwarmregeln« – »1. Erkenne die Folge deines Tuns. 2. Bemühe dich um Verbesserungen und 3. Teile deine Erkenntnisse mit anderen« (ebd.: 56) – ein höheres gemeinsames Ziel erreichen könne. Ähnlich wie sich dies für Golemans Modell emotionaler Intelligenz (zur Kritik vgl. Neckel 2005; Sieben 2007) konstatieren lässt, werden hier sozial erwünschte Kompetenzen und Verhaltensweisen zu einer Form der Inte...