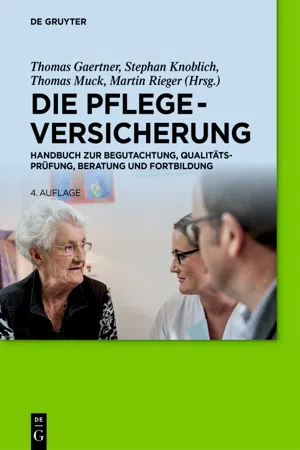1 Sozialgeschichtliche Aspekte und ordnungspolitische Reformen der Pflegeversicherung
Die soziale Pflegeversicherung ist Teil der in Etappen entstandenen deutschen Sozialversicherung. So wurde zunächst im Anschluss an vornehmlich im 18. und 19. Jahrhundert in England und Frankreich geleistete morbiditätsbezogene epidemiologische Untersuchungen und Entwicklungen eines paternalistischen Wohlfahrtsgedankens auch in Deutschland Krankheit als gesellschaftliches Problem medizinisch-wissenschaftlich betrachtet. In der Bewegung der „sozialen Medizin“ der Jahre 1848/49 fanden diese Erkenntnisse durch Vertreter wie Salomon Neumann (1819–1908) und Rudolf Virchow (1821–1902), von 1880–1893 Mitglied des Reichstags, politisch motivierten Ausdruck [1]: „die Medizin ist eine sociale Wissenschaft und die Politik ist weiter nichts, als Medicin im Grossen“ [2].
Zu Beginn des Jahres 1881 wurde dann ein erster Entwurf eines Sozialversicherungsgesetzes vorgelegt, in dem es hieß: „dass der Staat sich in höherem Maße als bisher seiner hilfsbedürftigen Mitglieder annehme, ist nicht bloß eine Pflicht der Humanität und des Christentums, von welchem die staatlichen Einrichtungen durchdrungen sein sollen, sondern auch eine Aufgabe staatserhaltender Politik“. Die sich daran anschließende Sozialgesetzgebung zur Absicherung der großen Lebensrisiken intendierte somit gerade auch die Herstellung des inneren Friedens. Zur Eröffnung des 5. Deutschen Reichstags am 17.11.1881 verlas dann der damalige Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck die sogenannte und wohl auch von ihm redigierte Kaiserliche Botschaft Wilhelms I. Sie leitete die eigentliche deutsche Sozialgesetzgebung ein und markierte insbesondere im Vergleich zu den sozialpolitischen Entwicklungen in Großbritannien und Frankreich, eine deutliche Akzentverschiebung sozialstaatlichen Verständnisses.1 Diesem staatlichen Fürsorgeprogramm zur institutionellen Absicherung der Arbeiter gegen die Risiken und Folgen von Betriebsunfällen, Krankheit sowie Alter oder Invalidität wird in der kritisch-historischen Geschichtsschreibung allerdings nicht unwidersprochen der Charakter einer sozial-politischen Magna Charta zugestanden [4].
Nach den Ankündigungen in der Kaiserlichen Botschaft nahm dann während der Jahre 1883 bis 1891 die soziale Gesetzgebung im Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, im Unfallversicherungsgesetz und im Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersabsicherung Gestalt an. Dies war auch für das Ausland vorbildlich. Im Verlauf von mehr als hundert wechselvollen Jahren führte die Gesetzgebung über die Zusammenfassung in der Reichsversicherungsordnung (RVO) vom Jahre 1911 zur Grundlage des gegenwärtigen Wohlfahrtsstaates. Das System der sozialen Sicherung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) basiert als Teil eines gesellschaftlichen Netzwerks auf
- –
dem Prinzip der Versicherung,
- –
dem Prinzip der Verknüpfung von staatlicher Rahmengesetzgebung und sozialer Selbstverwaltung und
- –
dem Prinzip der organisatorischen Vielfalt der Versicherungsarten und -träger.
Das deutsche Sozialversicherungssystem auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist so zu einem konstitutiven Element der bundesrepublikanischen Demokratie geworden. Seine Zweige sind selbstverwaltete Institutionen mit der Intention einer solidarisch organisierten Selbsthilfe. Produktiv und perspektivisch tragend wird in diesem Kontext ein modernes Verständnis von Institutionen. Demnach sind sie keine „Gußformen“ für das Handeln (Durkheim, 1895), „stahlharten Gehäuse“ und erst recht keine „Gehäuse der Hörigkeit“ (Max Weber, 1905), sondern ein Ort der „Dauerreflexion“ (Schelsky, 1957), ein Immunsystem der Gesellschaft (Luhmann, 1984), ausgehend von einem Leitproblem konstruktive Transmissionsmedien kreativen Werdens zur Zeitigung sozialer Effekte (Seyfert, 2011) [5–9]. Bereits im Jahr 1953 findet sich in dem Essay „Empirisme et subjectivité“ von Gille Deleuze: „Die Institution setzt keine Grenzen wie das Gesetz, sondern ist im Gegenteil ein Handlungsmodell … eine positive, auf indirekt wirkende Mittel aufbauende Erfindung … Das Soziale selbst ist schöpferisch, erfinderisch, positiv“ [10]. Neben den Sozialleistungsträgern der Kommunen ruht das System der sozialen Sicherung der BRD somit auf den folgenden historisch gewachsenen fünf Säulen:
- 1.
Gesetzliche Krankenversicherung (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB V vom 20.12.1988) 01.12.1884 Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15.06.1883.
- 2.
Gesetzliche Unfallversicherung (Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VII vom 07.08.1996) 01.10.1885 Unfallversicherungsgesetz vom 06.07.1884.
- 3.
Gesetzliche Rentenversicherung (Sechstes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VI vom 18.12.1989) 01.01.1891 Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 28.05.1889.
- 4.
Arbeitsförderung (Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III vom 24.03.1997)/Grundsicherung für Arbeitslose (Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II vom 24.12.2003) 16.07.1927 Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
- 5.
Soziale Pflegeversicherung (Elftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB XI vom 26.05.1994) 01.01.1995 Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit vom 26.05.1994.
Zur Etablierung einer Pflegeversicherung kam es erst nach einer mehr als zwei Jahrzehnte währenden politischen Auseinandersetzung [11]. Die gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit zu ihrer Einführung ergab sich letztendlich aufgrund der volkswirtschaftlichen Folgen des sozio-demographischen Wandels. Kennzeichen waren die Zunahme der Lebenserwartung mit konsekutivem Pflegebedarf, die Erosion der die häusliche Pflege tragenden familiengebundenen Strukturen, eine sich verschärfende Finanzierungsproblematik der stationären Pflege sowie nicht zuletzt die sozialrechtlich konfliktträchtige Abgrenzung von Leistungen der Sozialhilfe gegenüber den Leistungen der Krankenkassen bei Schwerpflegebedürftigkeit. Um „eine umfassende Lösung der Pflegeproblematik herbeizuführen“, legte die Regierungskoalition der CDU/CSU und der FDP in der 12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1990–1994) einen Gesetzentwurf zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz – PflegeVG) vor. Grundlegend war die Qualifizierung von Pflegebedürftigkeit als ein „unabhängig vom Lebensalter bestehendes allgemeines Lebensrisiko“, das zwar keiner „allgemeinen Versicherung“ wie bei der Krankenversicherung, jedoch einer Unterstützung bedurfte, um die „aus der Pflegebedürftigkeit entstehenden Belastungen zu mildern“ [BT-Drs. 12/5262].
Nach heftigen parlamentarischen Debatten und zähen Verhandlungen im Vermittlungsausschuss wurde das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz – PflegeVG) am 24.05.1994 verabschiedet. Gegenstand der Kontroversen war nicht zuletzt die Finanzierungsfrage. Konträre Positionen wurden vor allem im Hinblick auf die Lohnnebenkosten vertreten: Kapitaldeckungsverfahren versus Umlageverfahren, Privatversicherung versus Sozialversicherung, arbeitnehmerseitige versus paritätische Finanzierung. Ein Kompromiss wurde in einer umlagefinanzierten Sozialversicherung mit eingeschränkt paritätischer Finanzierung gefunden. So wurde als sozialgeschichtliches Novum in der BRD erstmals nach dem Grundsatz vom Umbau des Sozialstaates mittels Kompensation verfahren. Als Ausgleich für die aus den Arbeitgeberbeiträgen entstehenden Belastungen der Wirtschaft wurde seitens der Bundesländer mit dem Buß- und Bettag ein landesweiter gesetzlicher Feiertag aufgehoben, der stets auf einen Werktag fällt. Lediglich im Freistaat Sachsen wurde dieser Feiertag beibehalten; ausgleichend zahlen dort allerdings die Arbeitnehmer einen höheren Eigenanteil.
Mit Wirkung vom 01.01.1995 wurde die soziale Pflegeversicherung als vorerst letzte Säule der Sozialversicherung stufenweise etabliert [12]. Einige organisationsrechtliche Vorschriften wurden bereits am 01.06.1994 wirksam, wie die Vorschriften über die Anschubfinanzierung für die Pflegeeinrichtungen in den neuen Bundesländern (Art. 52 PflegeVG) und die Vorschriften über die Ermächtigung der Krankenkassen zu vorbereitenden Arbeiten (Art. 46 PflegeVG). Im weiteren Verlauf wurde über die Jahre die Pflegeversicherung weiterentwickelt sowie den sich verändernden Anforderungen und neuen Erkenntnissen angepasst. Zuletzt – in den drei Pflegestärkungsgesetzen (s. u.) aufgegriffen – bestimmten die Zunahme von Pflegebedürftigen mit dementiellen Erkrankungen, die Notwendigkeit zur Schaffung eines den gegenwärtigen Kenntnisstand berücksichtigenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Sicherstellung der Qualität in den Pflegeeinrichtungen den vordringlichen gesetzgeberischen Handlungsbedarf.
Das Pflege-Versicherungsgesetz regelt keine umfassende Versorgung im Sinne einer allgemeinen Versicherung („Vollversicherung“) gegen das Risiko individueller Hilfebedürftigkeit. Es soll allerdings wesentlich dazu beitragen, einen Teil des pflegebedingten Hilfebedarfs zu kompensieren (Einzelheiten s. Kapitel 3.3). Zudem sollen dadurch Privatpersonen wie kommunale Haushalte finanziell entlastet und die Beanspruchung von Sozialhilfe reduziert werden. In gemeinsamer Verantwortung zur Beteiligung leistet die Pflegeversicherung also nur einen ergänzenden Beitrag zur in gemeinsamer Verantwortung getragenen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der pflegerischen Versorgung der Versicherten2 (Teilabsicherung). Dazu gehört auch, dass durch die unterstützenden Leistungen des Pflege-Versicherungsgesetzes die Möglichkeiten zur häuslichen Pflege besser ausgeschöpft werden können.
Das Pflege-Versicherungsgesetz enthält als Artikel 1 das Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung. Es umfasst die Regelungen sowohl zur sozialen Pflegeversicherung als auch zur sogenannten privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV). In den Schutz der sozialen Pflegeversicherung sind kraft Gesetzes alle einbezogen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Wer gegen Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert ist, muss gemäß § 1 Abs. 2 SGB XI eine private Pflegeversicherung abschließen, daher die Bezeichnung private Pflege-Pflichtversicherung. Die Leistungen der PPV müssen denen der SPV gleichwertig sein. Allerdings tritt an die Stelle der Sachleistungen die Kostenerstattung.
Die Sachverständigentätigkeit im Sinne der sozialmedizinischen Begutachtung, Qualitätsprüfung, Beratung und Fortbildung im Auftrag der Leistungsträger übernehmen für die soziale Pflegeversicherung der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) und für die Knappschaft-Bahn-See (KBS) der Sozialmedizinische Dienst (SMD) sowie für die privaten Krankenversicherungen die MEDICPROOF GmbH.
Die frühzeitig einsetzenden Reformbestrebungen sowie vielfältigen und zum Teil substantiellen Gesetzesnovellierungen der Pflegeversicherung ü...