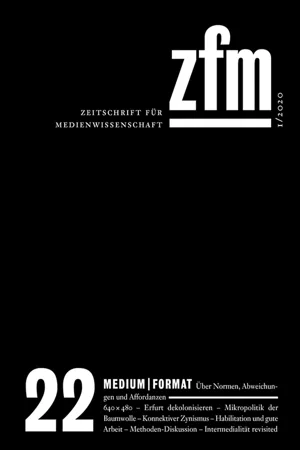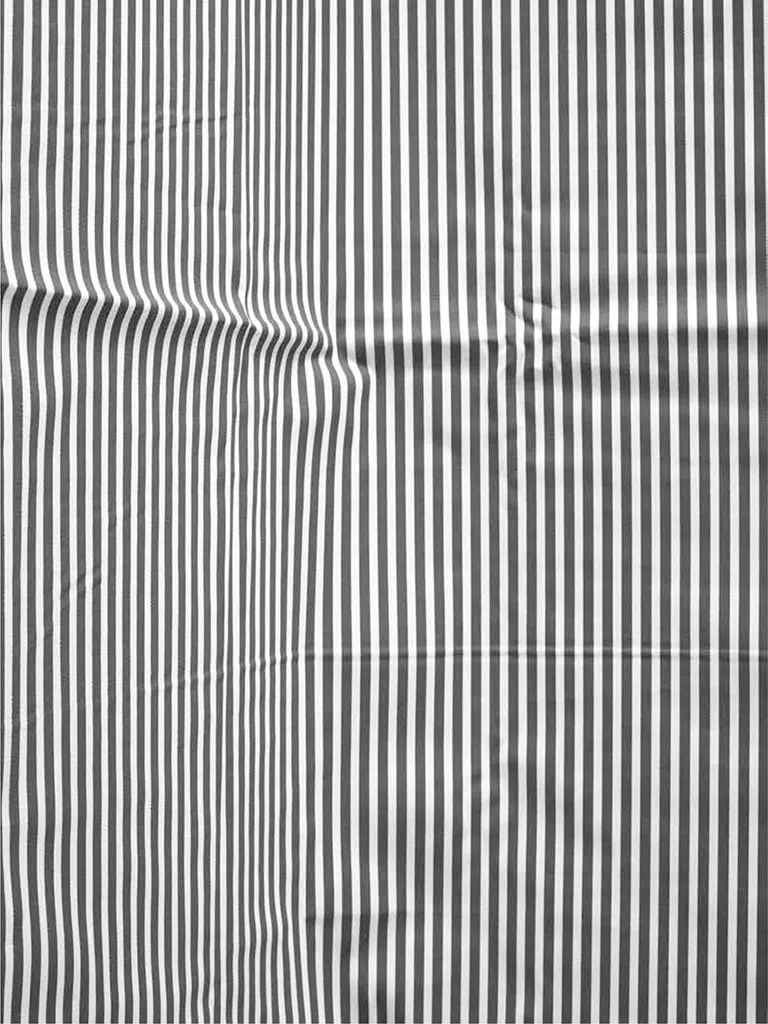MEDIUM|FORMAT
—
Einleitung in den Schwerpunkt
Spätestens seit Jonathan Sternes programmatischem Aufruf zur Entwicklung einer «format theory»1 lässt sich die Relevanz der Auseinandersetzung mit Formaten für eine medienwissenschaftliche Theoriebildung ermessen. Denn Sterne fordert eine solche «Formattheorie» als Bedingung von Medientheorie.2 Der Blick aufs Format würde der Möglichkeit zur ‹Maßstabsänderung› von Medienanalysen zuarbeiten und Medialität als skalierbare ‹Größe› in Bezug auf verschiedene Zeit- und Raumebenen ergründbar machen. Damit einher gehe der Anspruch an eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung, die sich nicht an generalisierende, subsumierende oder klassifizierende Überbegriffe, an die semiotischen wie die physischen ‹Schubladen› oder an die «boxes our media come in»,3 richtet.
Der vorliegende Schwerpunkt folgt Sternes Anwartschaft auf eine ‹Skalierung› der Betrachtung von Medialität, wie man es nennen könnte, die mit der Untersuchung von Formaten angesprochen ist. Den vom Format gebotenen Einsatz – das analytische Miteinbeziehen mikro- und makromedialer Register – möchten wir in einen Zusammenhang mit aktuellen Theorien medienwissenschaftlichen Forschens und Fragens stellen. Denn Formate sind in verschiedenste medien- und kulturwissenschaftliche Problemstellungen eingeschrieben, wie diese Einleitung beispielhaft anhand von drei für die Medienwissenschaft zentralen Konzepten – Transformation, Performativität und Information – explizieren möchte.
Transformation
Rosa Menkmans A Vernacular of File Formats (2010) kann als Bildatlas digitaler Prozessualität gelesen werden. Die niederländische Künstlerin trägt in Form eines Nachschlagewerks Kompressionsartefakte verschiedener digitaler Bildformate, z.B. unkomprimierter RAW-, BMP-, verlustfreier GIF- oder TIFF-Dateien, zusammen. Menkmans Screenshot-Sammlung ist eine Antwort auf die massenmediale Standardisierung der ‹Störfallästhetik›, die ja ursprünglich konventionelle Bild- und Sehanordnungen kritisch befragen sollte. Durch die Kategorisierung von Übertragungsfehlern und Kompressionsdefekten entwickelt Menkman eine Repräsentationskritik, die das Paradox der berechneten Fehlerhaftigkeit adressiert. Glitches, nicht vorhersehbare und daher schwer fassbare ‹Signalstörungen›, besitzen für die Künstlerin gerade in ihrer prozessualen Widerständigkeit expressive Qualitäten. Menkmans Kritik richtet sich nun gegen die schnelle und einfache Konsumierbarkeit von glitches, wenn diese als Filterästhetik benutzt und über Digitalbilder gelegt werden. Diese wertnormative Transformation mache Formatfehler kommerzialisierbar. Glitches fänden als «coffee table book» Eingang in die hyperkapitalistische «world of latte drinking designers and […] Kanye West».4 Ihre Kritik bringt Menkman nun nicht etwa in der Verwerfung der mit den glitches benannten Logik kultureller und ästhetischer Auf- und Abwertungsprozesse vor, sondern in deren Überstrapazieren. A Vernacular of File Formats gibt sich exzessiv der unkontrollierten und deswegen auch nicht vor Kontexten der schnellen Konsumierbarkeit haltmachenden Prozessualität digitaler Formate hin. Die künstlerische Arbeit bereitet den Dialekt einer Digitalkultur verständlich auf. Digitale Mundart ist, als vermeintlich herkömmliches Zeichensystem, dann immer schon ein Spektrum zwischen Inkommensurabilität und Kommunizierbarkeit, Slang und Jargon, Abweichung und Standardisierung.
Menkmans Arbeit ruft Charakteristiken auf, die sich bei der Beschäftigung mit Formaten ergeben. Formate materialisieren kulturelle, wertbezogene, aber auch zeitliche und räumliche Transformationsprozesse. Sie modifizieren Medien über den Gegensatz von Regelbruch und Normierung – philosophisch zugespitzt: von Chaos und Ordnung. Über die Kontexte, Wirkungen und Bedeutungen, die Formate in Medienkulturen zugesprochen bekommen, können Entscheidungsprozesse, die mit Formaten Ordnungen und Regeln festlegen, eine explosive, widerstreitende Dimension erreichen: ‹Formatkriege› stehen nicht nur auf der medienökonomischen Tagesordnung. Diese ‹Brennpunkte› zeigen ihr politisches Ausmaß auch jenseits von Betamax und VHS, dem in der westlichen Medienkulturgeschichte wohl bekanntesten Standardisierungskampf. Das soll im Folgenden anhand des Verhältnisses von Format und Performativität verdeutlicht werden. Zwei weitere Eckpunkte des medialen Spielfelds von Formaten werden hier manifest: Neben der Offenheit und Normierung umspielen Formate die Grenzen von repressiven Ein- und Ausschlüssen.
Was sich für eine Formattheorie zunächst festhalten lässt, ist ein Kurzschluss aus Formatierungsprozessen und medialen Transformationsprozessen, durch die beschriebene Oszillation zwischen Regel und Abweichung. Denn mediale Transformationserscheinungen werden durch eine Analyse von Formaten auf mikro- und makromedialer Ebene bestimmbar. Zu nennen sind hier z.B. die codierte Berechnung und Übertragung digitaler Inhalte oder deren softwarebasierte (Fehl-)Interpretationen, aber etwa auch Farbbeschichtungen von Zelluloidstreifen oder deren Granularität. Mikromediale Fragen, die medienarchäologisch motiviert sind oder dem New Materialism zugeschrieben werden können,5 lassen Medialität über die Entwicklungsstufen und Generationen von Formaten als feinabgestuftes Spektrum fassbar werden. Durch Formate können mediale Transformationen auch makromedial als Strukturmerkmal adressiert werden. Formate stehen dann für eine Sondierung relationaler Gefüge technischer Infrastrukturen oder medialer Ökologien und agieren z.B. über Papier-, Rahmen- oder Bildschirmgrößen, über IP-Pakete oder adaptive Bitraten an den Schnittstellen fluider Netzwerke oder atmosphärischer Medienumgebungen. Zu verstehen als «Grenzobjekte»,6 wie sie die Akteur-Netzwerk-Theorie oder die Science and Technology Studies interessieren, referieren Formate auf die Standards und Protokolle, die die Zirkulation von Wissen und Erfahrung ermöglichen, gleichzeitig aber auch reglementieren.
Performativität
Formate verweisen wie kein anderes mediales Phänomen auf ihre befragbare, ersetzbare und auch zu verwerfende oder herausfordernde Gemachtheit. Sie sind hervorgebrachte, meist unter funktionalen oder ökonomischen Vorgaben getroffene Entscheidungen, Absprachen oder Bestimmungen. Formate sind alles andere als neutral und widersprechen einer essenzialistischen bzw. ontologischen Vorstellung von Medialität und Technik. Ihre Rigidität verweist auf Prinzipien des Ein- und Ausschlusses; die mit Formaten verbundenen Praktiken und Ästhetiken stellen Kondensationen kultureller Aushandlungsprozesse – kultureller Performativitäten – dar.
Lorna Roth verfolgt das Verhältnis von soziokultureller Performanz und Formatierungsfragen z.B. anhand der sogenannten Shirley cards: Testbilder aus den 1940er und 50er Jahren, die film- und fernsehindustrielle Farbfilmemulsionen und Helligkeitsabstufungen von Kameratechnik formatieren. Davon ausgehend zeichnet Roth eine Entwicklung nach, a «socio-technical journey, which is not yet complete»,7 bei der die medientechnische und -historische Genese des Farbfilms an Kategorien von Gender und race gekoppelt ist. Die Shirley cards sind benannt nach dem weißen, weiblichen Modell, das sie abbilden, und dem festgeschriebenen, hartnäckigen «standard for most North American analogue photo labs».8 In ihrer Forschung legt Roth die Voreingenommenheit aller Medientechnologien über deren Formatierungen als internationale Standards offen. Fotolabortechniken, Farbbalanceverfahren und Filmentwicklungschemie haben dabei nicht nur die generalisierende Präferenz einer whiteness eingeschrieben, die als Barometer jede andere Hautfarbe zur verschlechternden Abweichung von der vorherrschenden Norm degradiert.9 In Interviews mit den formatkonzipierenden Techniker_innen und Wissenschaftler_innen stößt Roth zudem auf einen Technikessenzialismus, der die Rassismen über eine mediale bzw. (natur-)wissenschaftliche Neutralität und Unbefangenheit begründet: «[P]hysics was physics, chemistry was chemistry, and science was based on reasoned decisions without consideration of cultural or racial subtleties».10
Damit aufgerufen ist eine grundsätzliche Unbefangenheit gegenüber medientechnischen Standardvorgaben, die Ulrike Bergermann im Anschluss an die Shirley cards auch für Digitalformate und «rassistische Algorithmen» ausmacht.11 Digitaltechnische Möglichkeitsbedingungen, die z.B. in Hinblick auf Belichtungsstufen andere Spielräume und weniger Voreinstellungen offerieren als photochemische Emulsionswe...