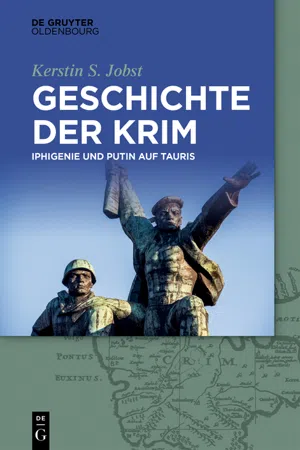1 Einleitung
„Versuche beim Generalstab die Gründe für die Invasion in Erfahrung zu bringen.“ „Das ist keine Invasion“, entgegnete Tschernok lächelnd. „Was dann?“ schrie Sabaschnikow, den der Humor im Stich ließ. „Schalt mal den Moskauer Kanal ein“, sagte Tschernok […]: „Wie bekannt…(wieso bekannt, wenn der Bevölkerung diesbezüglich nichts mitgeteilt wurde)…haben breite Bevölkerungsschichten des urrussischen Territoriums (…) der Östlichen Mittelmeerzone… (selbst in einer solchen Mitteilung wäre es zuviel, das verwunschene Wort ‚Krim‘ zu benutzen)…sich an den Obersten Sowjet der Sozialistischen Sowjetrepubliken gewandt mit der Bitte, in die Union aufgenommen zu werden…(wieder eine Lüge, wieder eine gemeine Unterstellung – nicht so ist es gewesen, nicht so hatte die Bitte geklungen.) Auf der gestrigen Sitzung des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR wurde dieser Bitte im Prinzip entsprochen. Sie bedarf jetzt nur noch der Bestätigung durch die Deputierten auf der nächsten Tagung des obersten Sowjets.“1
Bei einer flüchtigen Lektüre der obigen Zeilen und bei Ausblendung der (anachronistischen) Bezeichnungen wie „Oberster Sowjet der Sozialistischen Sowjetrepubliken“, welcher bekanntlich mitsamt der UdSSR 1991 aufhörte zu existieren, könnte man meinen, es handele sich um einen Dialog im Zusammenhang mit der sich zwischen Ende Februar und Ende März 2014 vollziehenden Machtübernahme der Russländischen Föderation in der zur Ukraine gehörenden Autonomen Republik Krim. In dieser Phase wurden nach den monatelangen Protesten des „Euromaidans“ und dem Rücktritt der ukrainischen Regierung Ende Januar 2014 bekanntlich aus Kreisen des Kremls vermehrt Verlautbarungen über das zukünftige Schicksal der Krim laut. Deren staatsrechtliche Zugehörigkeit zur Ukraine war von der Mehrheit der Bevölkerung der Russländischen Föderation und ihren politischen Vertretern stets als Stachel im Fleisch empfunden worden. Russische Militärs auf der Halbinsel versuchten, dortige Politiker zur Zusammenarbeit mit den russländischen Vertretern zu überzeugen; gleichzeitig begannen auf der Halbinsel stationierte Föderationstruppen, mehr oder minder verdeckt, strategisch wichtige Punkte einzunehmen. Zugleich erklärte der Präsident der Russländischen Föderation Vladimir V. Putin (*1952) am 23. Februar, dass Vorbereitungen zur „Rückholung der Krim zu Russland“ getroffen werden müssten, „um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.“2 Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen krimtatarischen und prorussischen DemonstrantInnen in Simferopol’ (russ./ukr.; krimtat. Aqmescit) und dem vermehrten Auftreten prorussischer, aber nicht gekennzeichneter KombattantInnen sprach sich das Krim-Parlament am 6. März für einen „Wiederanschluss“ an Russland aus. Zehn Tage später folgte eine (nach ukrainischem Recht illegale) Volksabstimmung, in der sich nach veröffentlichten, aber stark anzuzweifelnden Zahlen 96,77 Prozent der Wahlberechtigten für den Anschluss der Krim an die Russländische Föderation aussprachen. Einen Tag später wurde ein Beitrittsantrag an Moskau gestellt, der am 21. März 2014 durch den russländischen Föderationsrat ratifiziert wurde.
Soweit also die Realitäten des Jahres 2014, die der russisch-sowjetische Schriftsteller Vasilij P. Aksënov (1932‒2009) in seinem Anfang der 1980er Jahre erschienenen Roman „Die Insel Krim“, einem „hellsichtigen Krim-Roman“, wie es der Journalist Reinhard Veser 2015 zu Recht bemerkte,3 vorwegnahm. Der Autor ging von der Vorstellung aus,
„[w]as wäre, wenn die Krim wirklich eine Insel wäre? Was wäre, wenn die Weiße Armee 1920 wirklich die Krim vor den Roten zu verteidigen gewußt hätte? Was wäre, wenn die Krim eine zwar russische, aber doch immerhin westliche Demokratie neben dem totalitären Kontinent entwickelt hätte?“4
Die Krim – nicht als reale Halbinsel, sondern als fiktive Insel – ist in dem Werk eine Art hypermoderne slavische Variante Taiwans; eine zwar nicht prosowjetische, aber prorussische Vereinigung mit dem Namen „Union des Gemeinsamen Schicksals“ unter der Ägide des als eine Art russischen James Bond stilisierten Journalisten Andrej Lučnikov. Dieser hofft auf die Wiedervereinigung mit dem Mutterland und die daraus erwachsende Demokratisierung der Sowjetunion. Er und seine Anhänger werden getäuscht, denn statt einer friedlichen Verschmelzung „beschloß das Komitee für Körperkultur und Sport beim Ministerrat der UdSSR gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium der UdSSR […], im Schwarzmeersektor einen Feiertag des Militärsports unter der allgemeinen Bezeichnung ‚Frühling‘ durchzuführen.“5 Und dieser „Frühling“ war nichts anderes als die Krim-Invasion.
Im Roman beendet der sowjetische Einmarsch die Entwicklung einer übernationalen Krim-Identität. Deren Anhänger slavischer, tatarischer und sonstiger Herkunft nennen sich „Yaki“, was eine Verballhornung des turksprachigen Wortes yahşi („gut“) darstellt. In diesem satirischen Science-Fiction-Roman repräsentieren diese letztlich ein wenig erfolgreiches Konzept, da sie denjenigen unterliegen, die für den Anschluss an die Sowjetunion und damit für das Primat des Russischen plädieren.
Gegenwärtig und in der sogenannten Realität kann nicht abschließend beurteilt werden, wie zufrieden die BewohnerInnen der Krim mit der neuen „Wiedervereinigung der Krim mit Russland“, wie es zumeist heißt, sind. Nach neueren Umfragen ist zumindest bei der großen Mehrheit keine deutliche Identifikation mit der Russländischen Föderation feststellbar, bezeichnen doch 63 Prozent „den Ort, an dem ich lebe“ als ihre Heimat – und das ist die Krim, nicht Russland.6
Heimat – das war die Krim über die Jahrtausende für viele Völkerschaften: Die am nördlichen Ufer des Schwarzen Meeres gelegene Halbinsel Krim löste, so heißt es treffend bei dem britischen Journalisten Neal Ascherson (*1932), zu allen Zeiten ein „fast sexuelles Besitzverlangen“ aus7, also nicht nur im Jahr 2014 bei RussInnen. Sie war das klassische, mit der hellenistischen Sagenwelt auf das Engste verbundene Taurien sowie griechische und römische Kolonie. Sie wurde seit jeher von zahllosen Völkerschaften durchzogen, erobert und besiedelt: Frauen und Männer der Kimmerier, Skythen, Griechen, Ostgoten, Chasaren, Genuesen, Venezianern, Turko-Tataren und BewohnerInnen der Kiewer Rus’ bewohnten und beherrschten sie genauso wie RussInnen und UkrainerInnen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Sie alle und viele weitere prägten die Krim nachhaltig kulturell und in ihrer jeweiligen Zeit häufig auch politisch. Nicht zuletzt der seit ältesten Zeiten multikonfessionelle und ‐kulturelle Charakter der Halbinsel zwischen dem Schwarzen und dem Azovschen Meer macht sie bis heute zu einem faszinierenden Gebiet nicht nur für WissenschaftlerInnen, sondern auch für Reisende, Kulturinteressierte und PolitikerInnen.
Die Krim entzieht sich auch heute noch jedem exklusiven nationalen Besitzanspruch. Daran konnten auch die ethnischen Säuberungen des 20. Jahrhunderts nichts ändern, weder der von den Nationalsozialisten zwischen 1941 und 1944 auf der Halbinsel verübte Völkermord an großen Teilen der jüdischen Bevölkerung noch die von Josef Stalin (d.i. Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili; 1878‒1953) verfügten Deportationen der Krimdeutschen (1941) oder die der KrimtatarInnen, BulgarInnen und GriechInnen im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg.
Seit Frühjahr 2014 ist die Krim de facto Teil der Russländischen Föderation, völkerrechtlich aber immer noch der Ukraine zugehörig. Ungeachtet der über die Zeitläufte wechselnden Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen Akteuren und Imperien war und ist sie national heterogen. Dies liegt nicht zuletzt an der seit den 1990er Jahren aus dem zentralasiatischen Exil zurückströmenden krimtatarischen Bevölkerung, die ihren Anteil daran hat, dass die Halbinsel aus nördlicher (russischer und westeuropäischer) Perspektive als eine exotische, orientalische Gegend erscheint.8 Seit der zweiten russischen Annexion von 2014 – die erste war bekanntlich die 1783 von Katharina II. (1729‒1796) verfügte – mussten viele von ihnen der erst kürzlich wiedererlangten Heimat allerdings wieder den Rücken kehren.
Zur gefühlten Exotik der Krim trägt ohne Zweifel auch das im Vergleich zu den zentralrussischen und ‐ukrainischen Gebieten mediterrane Klima in der Bergregion und der touristisch bereits seit dem 19. Jahrhundert erschlossenen Südküste bei. Der Zarin Katharina II. (und in der Folge den BewohnerInnen sowohl des zarischen als auch des „roten“ Imperiums) galt dieses landschaftlich reizvolle Gebiet gar als die „Perle des Imperiums.“9
Mit ihren diversen kulturellen Schichten, den Hymnen zahlloser LiteratInnen über sie und ihrer wechselvollen Geschichte – immer auch im Zusammenhang mit Imperien stehend und als ewiger Transitraum – zog und zieht die Halbinsel eine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Sie birgt aber auch heutzutage eine besondere politische Brisanz: Durch die von JuristInnen mehrheitlich als völkerrechtswidrig eingeschätzte Einnahme der Krim durch die Russländische Föderation im März 2014 wurde sie ein innereuropäisches Krisengebiet, auch wenn glücklicherweise die russische Machtübernahme dort weit weniger Menschenleben gekostet hat als die immer noch andauernden Konflikte in der Ostukraine mit einem Blutzoll von mittlerweile (d. h. im Februar 2019) mehr als 12.000 Menschenleben. In jedem Fall liegt die Aktualität des Themas „Krim“ auf der Hand10; dies zumal hier ein bislang nicht gelöster und vermutlich für lange Zeit existierender Frozen Conflict – so steht zu befürchten – im östlichen Europa entstanden ist, welcher auch im Kontext globaler Krisen relevant ist, muss die Russländische Föderation doch von vielen AkteurInnen auf den Feldern globaler Sicherheit/Politik als wesentlicher, aber schwieriger Partner gesehen werden. Das seit einigen Jahren vermehrte Interesse an der Schwarzmeerregion im Allgemeinen und der Halbinsel Krim im Besonderen in Medien, Politik und Öffentlichkeit kann bislang nicht mit wissenschaftlich fundierter und zugleich lesbarer Literatur befriedigt werden. Hier setzt das vorliegende Buch an. Trotz wertvoller Einzelstudien11 liegt nämlich bislang in keiner Sprache eine Synthese der Geschichte der Krim seit den ‚mythischen Zeiten‘ bis in die Gegenwart vor.12
Für ein deutschsprachiges Publikum erschließt sich die Relevanz einer Überblicksdarstellung zur „Geschichte der Halbinsel Krim“ leicht: Nicht nur ehemalige BürgerInnen der DDR haben schon einmal den berühmten Krymskoe, den Krimsekt13, genossen oder zumindest von diesem gehört. Goethes und Glucks Umsetzungen des „Iphigenie auf Tauris“-Themas gehören zum deutschsprachigen Kanon und sind somit Vielen noch aus der Schule bekannt. Das von zahlreichen deutschsprachigen Reisenden seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert weithin popularisierte Aufspüren einer mittelalterlichen „deutschen Krim“ mit Bezug auf die ehemals dort ansässigen Krimgoten ist Vielen ebenfalls ein Begriff. Bekannter noch sind Adolf Hitlers (1889‒1945) auch daraus resultierenden Versuche der Umsetzung seiner bizarren „Gotenland“-Phantasien im Rahmen des verbrecherischen Ostfeldzugs im Zweiten Weltkrieg.14 Als nach dem Zerfall der Sowjetunion die Tourismusindustrie des ehemaligen „Allunions-Sanatoriums“ – eine Bezeichnung für die Krim, die auf Lenin selbst zurückgehen soll – eingebrochen war, verzeichnete man seit der Jahrtausendwende wieder einen ansteigenden Besucherstrom. Auch aus dem deutschsprachigen Raum kamen TouristInnen, wobei die seit 2005 EU-BürgerInnen einseitig von Kiew gewährte Visumsfreiheit hilfreich war; übrigens folgte erst im Jahr 2017 nach langen Verhandlungen ein vergleichbares Entgegenkommen durch die Europäische Union gegenüber der Ukraine. Die Halbinsel war in den sog. Nuller-Jahren eine Destination kommerzieller Reiseanbieter geworden und wurde nicht mehr nur von Spezialveranstaltern für Bildungsreisen angesteuert. Sowohl BürgerInnen der ehemaligen DDR als auch die große Zahl deutschstämmiger ehemaliger sowjetischer StaatsbürgerInnen hatten und haben eine ganz besondere Bindung an die Krim, war es doch das Traumziel von Millionen Menschen des Ostblocks. Viele von ihnen haben die Halbinsel z. B. im internationalen Pionierlager „Artek“ nahe des an der malerischen Südküste gelegenen Städtchens Gurzuf (ukr.: Hurzuf) bereits als jugendliche Pioniere kennen- und lieben gelernt.
Wenn man über die Faszination nachdenkt, welche die Krim im deutschsprachigen Raum geweckt hat, ist ein Name nicht zu vergessen: Joseph Beuys (1921‒1986), ein deutscher Künstler von Weltgeltung. Dieser erzählte gern, dass er 1944 als deutscher Soldat auf der Halbinsel in seinem Stuka von einer feindlichen Flakstellung abgeschossen und von Krimtataren gerettet worden sei, die seine Wunden mit Filz, Fett und Honig geheilt hätten; Materialien, die in seinem späteren Werk eine große Rolle spielen sollten.15 Der auch im deutschsprachigen Raum beachtliche buchhändlerische Erfolg des auf der Krim spielenden Romans „Medea und ihre Kinder“ von Ljudmila Ulickaja (*1943) oder die sich 2007/2008 als Publikumsmagnet erweisende Skythen-Ausstellung (Berlin, München, Hamburg) sind weitere Indikatoren für das Interesse an der Geschichte dieser Region. All dies (und weitere ungenannte) sind Versatzstücke, die mit dem Begriff „Krim“ assoziiert werden, sich aber vielfach nicht in einen größeren Kontext einordnen lassen. Diese – ausdrücklich auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügende und mit einem Anmerkungsapparat versehene – Monographie zum Thema soll die bislang existierende eklatante Lücke schließen. Auch von Seiten der Wissenschaften ist das Interesse an der Schwarzmeerregion und damit an der Krim mittlerweile ausgeprägt, wird doch vermehrt nach einer spezifischen Geschichtsregion „Schwarzmeerraum“ gefragt.16 In Analogie zu Fernand Braudels Konzeption einer Mittelmeerregion mit eigenen, in dieser Kombination einzigartigen Merkmalen ist auch in Zukunft eine verstärkte universitäre und wissenschaftliche Befassung mit der Region zu erwarten. Es versteht sich somit von selbst, dass die Krim nicht unabhängig von ihren Bezügen zum Schwarzen Meer und dem Hinterland zu verstehen und zu beschreiben ist.
Die auf den ukrainischen „Euromaidan“ ab November 2013 folgende Besetzung der Krim durch Russland und die sich daran anschließende Annexion im März 2014 wurde von ExpertInnen (die Verfasserin dieser Zeilen nimmt sich davon nicht aus) nicht vorhergesehen. Auch wenn Zukunftsprognosen glücklicherweise nicht zum Berufsbild der professionalisierten Geschichtswissenschaft gehören, so wurde nun doch deutlich, wie groß der Bedarf an fundierten Aussagen zur Geschichte der Krim und der Region ist.
Der Bogen dieser Überblicksdarstellung ist weit zu spannen. Sie geht im Wesentlichen, jedoch nicht strikt, chronologisch vor: Sie beginnt mit der Krim als Mythenraum, beschränkt sich dabei aber nicht auf die antike Sagenwelt, denn die Krim regte – und dafür ist Josef Beuys nur ein Beispiel – zu allen Zeiten die Phantasie ihrer Besucherinnen und Besucher an; die Krim als mythischer locus spielt selbst in kollektiven Narrationen von Nationalitäten eine Rolle, die man nicht unbedingt mit der Halbinsel assoziiert.
Ungeachtet ihres großen mythischen Potentials war die Krim zu allen Zeiten aus der Perspektive der jeweiligen Machtzentren Peripherie: Dies bereits im Altertum, in dem uns Herodot eine der ersten Beschreibungen der Tauris und der von ihm Skythen genannten Bevölkerung überlieferte. Die BewohnerInnen griechischer Kolonien an der Küste lebten in einer mal friedlichen, mal gewaltsamen Wechselseitigkeit mit (halb‐)mobilen Großgruppen, die aus dem nördlichen eurasischen Raum auf die Krim vordrangen. Der Kontakt zwischen diesen und den hellenistischen Kolonien bzw. Rom/Byzanz beförderte die sehr lange wirkungsmächtige Vorstellung über die Krim als ein Randgebiet, als Überlappungszone zwischen Zivilisation (oder der Oikumene, wie in der griechisch-römischen Antike die gesamte bewohnte bekannte Welt bezeichnet wurde) und Barbarei – ein Begriffspaar, welches selbstredend mit entsprechender Distanz zu verwenden ist, aber im Krim-Diskurs zeitübergreifend eine große Rolle gespielt hat. Die periphere Lage schloss nicht aus, dass auf der Krim nicht auch schon vor dem Krimkrieg (1853‒1856) oder der Konferenz von Jalta (1945) Weltgeschichte entschieden worden ist: Im letzten vorchristlichen Jahrhundert etwa geriet Mithridates VI., König von Pontus, durch seine Ambitionen, seinen Einflussbereich auf kleinasiatische Gebiete auszuweiten, in Konflikte mit Rom. Dieses wollte seine Macht am nördlichen Schwarzen Meer nicht aufgeben, was zu den sog. Mithridatischen Kriegen (89‒63. v. Chr.) führte. Dem byzantinischen Einfluss ist es schließlich zu verdanken, dass die Krim in späterer Zeit ein Ort des Frühchristentums wurde. Für Goten und Hunnen und viele weitere Völkerschaften, für die die Wissenschaft keine oder nur wenig präzise Namen gefunden hat, wurde sie Durchzugsgebiet oder (temporäre) Heimat. Seit dem 7. Jahrhundert schließlich wurden die Chasaren zu einer regionalen Ordnungsmacht, ehe im 10. Jahrhundert ein neuer Akteur immer wieder an die Ufer des Schwarzen Meeres und auch auf die Krim vorstieß, ohne sich allerdings dauerhaft festsetzen zu können: die Kiewer Rus’. Im 13. Jahrhundert etablierten die Seerepubliken Venedig und Genua entlang der Küste Handelskolonien, zwei Jahrhunderte später entstand das...