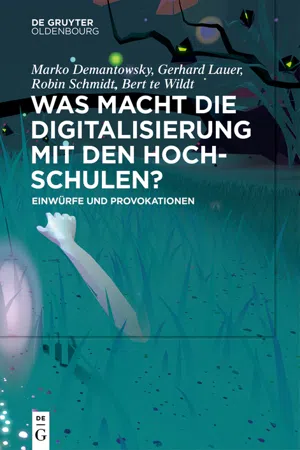
Was macht die Digitalisierung mit den Hochschulen?
Einwürfe und Provokationen
- 204 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Was macht die Digitalisierung mit den Hochschulen?
Einwürfe und Provokationen
Über dieses Buch
«Wir danken der Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf, https://www.gerda-henkel-stiftung.de/ ), dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (Essen, https://www.stifterverband.org/ ), der Artemed-Klinikgruppe (Tutzing, https://www.artemed.de/de/ ) und der Pädagogischen Hochschule FHNW (Basel/Brugg-Windisch, https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph ) für die großzügige Finanzierung der Dießener Klausur Mensch|Maschine|Zukunft 2019 und damit auch für die Ermöglichung dieses Buches.»
Die Digitalisierung von Schule und Hochschule ist keine Frage von digitalen Endgeräten, sondern von Wissen, Ideen und Infrastrukturen.
Der Band versammelt Essays von Expertinnen und Experten aus Schulen und Hochschulen, Politik, Journalismus und Computerwelt. Sie formulieren mit aufmerksamer Nachdenklichkeit Konzepte und Erwartungen an Lernen und Lehren der Zukunft, wenn alles digital wird.
Das Buch richtet sich an alle, denen die Zukunft der Schule eine Aufgabe und ein Anliegen ist.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Post-digitale Bildung
1 – Was heißt post-digital?
2 – Morgen vor 40 Jahren – was war das postmoderne Wissen?
- Hegemonie des informatisierbaren Wissens: Nur solches Wissen, das sich in „Informationsquantitäten“ übersetzen lässt, kann künftig Teil des Diskurses sein, und „all das, was vom überkommenen Wissen nicht in dieser Weise übersetzbar ist, [wird] vernachlässigt“ (30 f.).
- Verlust der Bildung als Selbstzweck: „Das alte Prinzip, wonach der Wissenserwerb unauflösbar mit der Bildung des Geistes und selbst der Person verbunden ist, verfällt mehr und mehr. […] [Wissen] hört auf, sein eigener Zweck zu sein, es verliert seinen ‚Gebrauchswert’“ (31). Die Ausbildung dient fortan im Wesentlichen der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Das Ausbildungssystem muss daher für das soziale System „die diesem […] unentbehrlichen Kompetenzen ausbilden“ (119). Die Universität muss künftig neben der Berufsqualifizierung auch die Umschulung und lebenslange Weiterbildung leisten. Ihr kommt zu, eine neue „Rolle im Rahmen der Verbesserungen der Leistungen des Systems zu spielen, und zwar jene des Recyclings oder der permanenten Ausbildung“ (122).
- Kommerzialisierung des Wissens: „Das Wissen ist und wird für seinen Verkauf geschaffen werden, und es wird für seine Verwertung in einer neuen Produktion konsumiert und konsumiert werden: in beiden Fällen, um getauscht zu werden“ (31). Das geht mit einer starken Veräusserlichung des Wissens gegenüber dem Wissenden einher. In der höheren Ausbildung gilt nicht mehr zu fragen: „Ist das wahr? sondern: Wozu dient es?“ (125)
- Multinationale Informations-Unternehmen stellen den Staat in Frage: Wenn multinationale Unternehmen wie IBM beispielsweise Kommunikationssatelliten installieren, wer definiert dann erlaubte und verbotene Daten und Kanäle, wer hat Zugriff auf die Daten und werden dann Staaten Kunden wie andere Kunden sein? Die Rechtsprobleme solcher Situationen seien völlig ungeklärt (33).
- Krieg um die Beherrschung von Informationen: Die Nationalstaaten werden um die Beherrschung von Informationen kämpfen, wie sie früher um Territorien, Verfügbarkeit von Rohstoffen oder billige Arbeitskräfte kämpften (32).
- Die Didaktik kann Maschinen anvertraut werden: Die reine Vermittlung von einem organisierbaren Bestand von Kenntnissen kann in der höheren Ausbildung an Maschinen übertragen werden: „Sofern die Kenntnisse in eine informatorische Sprache übersetzbar sind und der traditionelle Lehrende einem Speicher vergleichbar ist, kann die Didaktik Maschinen anvertraut werden, die klassische Speicher (Bibliotheken usw.) ebenso wie Datenbanken an intelligente Terminals anschließen, die den Studenten zur Verfügung gestellt werden.“ (124)
- Pädagogik muss Programmiersprachen wie Fremdsprachen lehren: Die Pädagogik müsse darunter nicht notwendig leiden, denn sie wird den Studenten etwas anderes lehren: „Nicht die Inhalte, sondern den Gebrauch von Terminals.“ – „In dieser Perspektive müsste eine Grundausbildung in Informatik und insbesondere in Telematik zwangsläufig Teil einer höheren Propädeutik sein, unter demselben Anspruch, wie zum Beispiel die Erlangung der fließenden Beherrschung einer Fremdsprache.“ (124)
- Wissenschaft wird zum Spiel mit vollständiger Information: Wenn grundsätzlich alle „hier und jetzt“ Zugriff auf das ganze Wissen haben, kann Wissenschaft als „Spiel mit vollständiger Information“ (126) gelten. Nur solange sie ein Spiel mit unvollständiger Information war, kam denen ein Vorteil zu, die über das Wissen verfügen und sich einen Zusatz an Informationen verschaffen konnten. Aus dem Besitz von Wissen allein erwächst dem Wissenden jetzt kein Vorteil mehr.
- Der Ära des Professors läuten die Grabesglocken: Wenn es somit kein wissenschaftliches Geheimnis mehr gibt, hängt der Zuwachs an Leistung der Wissenschaft nicht mehr an der Produktion des Wissens und dessen Erwerb, sondern ist davon abhängig, die Regeln des Spiels zu ändern oder einen neuen Spielzug durchzuführen, kurz: erfinderisch oder phantasiereich neue Verbindungen herzustellen. Daher wird Interdisziplinarität und Teamarbeit aufgewertet. „Was aber sicher scheint, ist, dass […] der Ära des Professors die Grabesglocken läuten: Er ist nicht kompetenter zur Übermittlung des etablierten Wissens als die Netze der Speicher, und er ist nicht kompetenter zur Erfindung neuer Spielzüge oder neuer Spiele als die interdisziplinären Forschungsteams“ (129).
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Einleitung
- Ist das Digitalisierung oder kann das weg?
- Einfach alles richtig machen: 14 leicht fassliche Ratschläge zur Zukunft der Hochschule
- Skalierte Kontingenz. Der disruptive Prozess der Digitalisierung und wie man (nicht) darüber sprechen sollte. Ein Plädoyer
- Post-digitale Bildung
- Zählen versus Erzählen? Gedanken zu Digitalisierung und Bildung
- Gibt es digitales Lernen?
- Vision als Prozess. Gedanken zur Zukunft der Hochschule im Spiegel der Trias Mensch – Maschine – Zukunft
- Wie Veränderung gelingt
- Überlegungen und zehn Thesen zur Bedeutung der Hochschulen im Zuge der digitalen Revolution
- Hochschule als tragende Säule von Gesellschaft
- Die Social Media-Hochschule
- Das Ende der Universität als Ort der Lehre?
- Zehn Thesen zu Bildung und Digitalisierung
- Was wir von Google Books über die Zukunft der Hochschulen lernen können
- Der Hunger nach Talent im Silicon Valley und die damit einhergehenden Gefahren für die unabhängige Hochschule in Deutschland
- Quo ante. Die natürliche Resilienz gegenüber radikalen Veränderungen und die digitale Transformation
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- Abbildungsverzeichnis