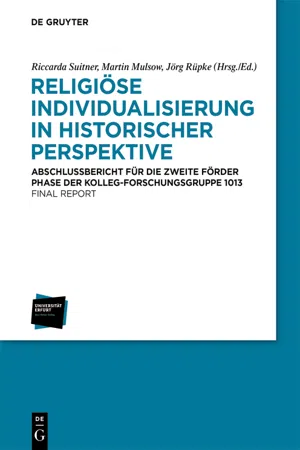
eBook - ePub
Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive / Religious Individualisation in Historical Perspective
Abschlussbericht für die zweite Förderphase der Kolleg-Forschungsgruppe 1013/Final Report of the Kolleg-Forschungsgruppe 1013 for the Second Funding Period 2013–2018
- 316 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive / Religious Individualisation in Historical Perspective
Abschlussbericht für die zweite Förderphase der Kolleg-Forschungsgruppe 1013/Final Report of the Kolleg-Forschungsgruppe 1013 for the Second Funding Period 2013–2018
Über dieses Buch
Dieser Band bietet einen Einblick in die Arbeit der Kolleg-Forschungsgruppe "Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive", erschließt bibliographisch ihre Ergebnisse und fasst sie zusammen: Individualisierung ist keine Folge der Modernisierung. Religion ist Motor, nicht Gegenspieler von Individualisierung. Religiöse Individualisierung ist außerhalb des "Westens" und vor verschiedenen "Modernen" ebenso zu finden wie in ihnen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive / Religious Individualisation in Historical Perspective von Riccarda Suitner, Martin Mulsow, Jörg Rüpke, Riccarda Suitner,Martin Mulsow,Jörg Rüpke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Martin Fuchs, Antje Linkenbach, Martin Mulsow, Bernd-Christian Otto, Rahul Bjørn Parson, Jörg Rüpke
1Religious individualisation in historical perspective
The work of the research group ‘Religious individualisation in historical perspective’, which started in 2008 at the Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Study at the University of Erfurt (Germany) and has been financed by a generous grant of the DFG (German Science Foundation) in the format of a Kolleg-Forschungsgruppe (KFG), has ended on December 31st, 2018, after a second period of funding (directed by Hans Joas and Jörg Rüpke in the first, and Martin Mulsow and Jörg Rüpke in the second period).
The KFG started by formulating a critique of modernisation theory that was to be bolstered by demonstrating that phenomena that might well be called ‘individualisation’ were existent and important in pre-modern and non-Western cultures. During the subsequent years we have pushed forward in at least three directions:
−With regard to modernisation theory, the independence of ‘individualisation’ from other crucial factors all too quickly bundled together as ‘modernisation’ has been sufficiently demonstrated. ‘Individualisation’ thus has been set free as an analytical term that is useful also beyond Western or even multiple ‘modernities’.
−With regard to the history of religion, hence, many phenomena and processes have come to the fore when we exchanged the lenses of collectivism by looking for anything comparable to ‘individualisation’. In particular, narratives of ancient and post-ancient (‘medieval’ or ‘early modern’ in terms of West-European epochs) circum-Mediterranean, European as well as West and South Asian religions have changed and gained new facets far beyond the work of the group itself. Concepts like ‘self’ and ‘agency’, ‘subject’ and ‘personhood’, ‘individuation’ and ‘personal identity’ were taken on board, and were at the same time critically perused, in our attempt to develop more fine-grained concepts and descriptions.
−Reflection has turned onto the very concepts we started with. How are concepts of ‘religion’ shaped by the aforementioned master narrative of ‘modern Western individualisation’? How is the normative character of the concept of the ‘individual’, whenever it is implied that one should be an individual, informed by such a narrative? How has the master narrative affected concepts of ‘history’ and ‘change’? The paradoxical consequences of securing individuality by processes of institutionalisation (e.g., through ritualisation, group formation, the establishment of textual canons and traditions, etc.) as well as backlashes into de- or non-individualisation have come into view. Looking more closely at the individual has also brought to light features of personhood that do not easily comply with linear and uni-directional individualisation narratives. Even in (early) modernity individualisation processes do not lead to a fully ‘bounded’ self-contained individual. The individual person always exhibits permeability, vulnerability and openness towards the outer and the social world in various degrees, as s/he is also capable of parting and pluralising him/herself in order to navigate multiple belongings, personalities and allegiances. Unravelling relational and partible aspects of the self has forced us to postulate a co-constitutive relation between what we call ‘dividuality’ and individuality.
All this has affected our view onto historical and contemporary societies and schools of thought, in a sociological and anthropological perspective as well as in terms of intellectual and ritual history. ‘Religious individualisation’, hence, understood as a polythetic umbrella term, has proved fruitful as a heuristic tool rather than a clearcut semantic signifier of specific social dynamics. A summary of the research results produced by the more than one hundred members of the research group − the longterm fellows from all over the world, the core team at Erfurt, but also the many shortterm fellows or participants in conferences −, is now published in open-access form, two volumes, co-edited by us, and focusing on transcending selves, dividual self, conventions and contentions and, authorities.3
The volume presented here will supplement our report on the first period of funding (2008–2012).4 It will start with a summary of our findings, followed by the contributions published in a special issue of the journal Religion 45.3 in 2015, co-edited by Martin Fuchs and Jörg Rüpke and reprinted with the consent of the authors. Reports on the numerous workshops and conferences organised and co-organised by the Kolleg-Forschungsgruppe and the ERC Advanced Grant project “Lived Ancient Religion: Questioning Cult and Polis-Religion” (directed by Jörg Rüpke and co-directed by Rubina Raja), which grew out of the KFG and was funded by the European Research Council (Grant no. 295555, 2012–17) ensue. The publications resulting from these meetings and discussions, but above all by all the fellows and members of the research group are listed in the final bibliography.
The report − as much as the whole research group − is bilingual (and more). The ‘executive summary’ will be presented in German and English at the beginning, followed by further pieces in either English or German. Without denying the usefulness of one shared language, the introduction and this report are pleading for a culture of multilingual search for adequate terms in the rich repertoire of different and entangled traditions of concepts and experiences.
We wish to thank Riccarda Suitner, who undertook the burden of collecting and organising texts and reports and working until August 2018 on editing the volume, for her time and dedication. Carefully as ever, Diana Püschel, managing director of the group from the very first moment, oversaw the final production. Heartfelt thanks for ten years of intensive, extensive, empathic and patient work must be extended to her.
Martin Fuchs, Antje Linkenbach, Martin Mulsow, Bernd-Christian Otto, Rahul Bjørn Parson, Jörg Rüpke
2Religiöse Individualisierung – und De-Individualisierung
Die Arbeit der Forschungsgruppe „Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive“, die 2008 am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt begann, ist endgültig beendet. Die Forschungsgruppe (oder Kolleg-Forschungsgruppe) wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) großzügig gefördert und war intellektuell in die lebendige und interdisziplinäre Atmosphäre und Diskussionskultur des Max-Weber-Kollegs eingebettet. Die Forschungsgruppe bestand aus mehr als hundert Mitgliedern, darunter das Kernteam in Erfurt, die langjährigen Fellows aus aller Welt, die ein oder mehrere Jahre bei uns waren, die vielen Kurzzeit-Stipendiaten, die Wochen oder Monate bei uns in Erfurt verbrachten, und die unzähligen Konferenzteilnehmer, die uns ihr Fachwissen für einige Tage zur Verfügung stellten.
In einem Abschlussband wurden wichtige Untersuchungslinien zusammengetragen, die die Forschungsgruppe in den letzten zehn Jahren von 2009 bis 2018 verfolgt hat. Über das Selbst hinaus, das geteilte Selbst, Konventionen und Infragestellungen und schließlich Autoritäten waren jene vier Perspektiven, die Prozesse der „religiösen Individualisierung“ unserer Arbeit beeinflussten und erforschten, die wir in Fuchs et al. 2019 als Überschriften gewählt haben und die hier helfen können, unsere Arbeit zusammenzufassen. Ausgehend von den Mechanismen der religiösen Individualisierung haben wir die Akteure, Merkmale, Muster und Dynamiken solcher Prozesse untersucht. Der Fokus lag auf menschlichen Akteuren, sowohl bei Selbstbildern als auch bei ihrer Konstruktion oder Konzeption in verschiedenen Epochen und Regionen, und wir haben untersucht, wie sie in gesellschaftlichen Netzwerken eingebettet waren und wie Agency behauptet, zugeschrieben oder abgelehnt wurde. Die Gruppe hat diskutiert, wie die Agency durch ihre verschiedenen Kontexte appropriiert und modifiziert und gleichzeitig gestaltet und produziert wurde. Wir haben uns mit den wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Bedingungen und Einschränkungen, aber auch mit kulturellen Praktiken und Alltagsdiskursen beschäftigt, mit den Expertendiskursen von Philosophen und Theologen sowie lokal verankerten Intellektuellen und ihren translokalen Kolleginnen und Kollegen. Überall war es uns wichtig, die Räume und Muster der Individualisierung und Deindividualisierung sowie die Spannungen, die im Zuge dieser Entwicklungen entstanden sind, die Machtverhältnisse sowie Protest- und Marginalisierungsprozesse und schließlich die Prozesse der De-, Re- und Neo-Traditionalisierung anzusprechen.
Der Inhalt der einzelnen historischen Studien, die die Forschungsgruppe im laufenden Prozess der Anwendung und Neugestaltung des Konzepts der ,Individualisierung‘ hervorgebracht hat, lässt sich weder hier noch im Abschlussband zusammenfassen, auch in seinen mehr als fünfzig Kapiteln nicht. Wenn man gezwungen ist, die Ergebnisse der Gruppe in Bezug auf den Begriff der ,Individualisierung‘ zusammenzufassen, kann man sagen, dass der Kern unserer Arbeit sowohl kritisch als auch revisionistisch ist. Es ist insofern ,kritisch‘, als er sich gegen die Monopolisierung des Begriffs ,Individualisierung‘ durch Befürworter der Modernisierungstheorie richtet, die den Alltag dominiert. Er ist ,revisionistisch‘, da wir uns oft gegen eine historiographische Perspektive ausgesprochen haben, die davon ausgeht, dass alle ,vormodernen‘ Kulturen im Wesentlichen kollektiv oder kollektivistisch sind (mit Ausnahme einiger ,großer Individuen‘). So werden wir kurz unseren Ausgangspunkt skizzieren und dann das weitere Feld der behandelten Forschungsfragen sowie wichtige Ergebnisse vorstellen.
2.1Meistererzählungen von Individualität und Individualisierung in der Religionsgeschichte
Im Gegensatz zu bestehenden Vorurteilen bietet die ,Individualisierung‘ nicht nur ein Fenster in gegenwärtige Gesellschaften, sondern auch in die Vergangenheit sowie in die Religionsgeschichte im Allgemeinen (siehe Rüpke 2016a, im Folgenden verwendet). Es könnte hilfreich sein, noch einmal auf die Ursprünge dieser etablierten Meistererzählung zurückzublicken, deren Befragung der analytische Ausgangspunkt der Forschungsgruppe war. Thomas Luckmann hatte bereits Anfang der 1960er Jahre bei der Untersuchung empirischer Daten auf das Wachstum der amerikanischen Religion hingewiesen und diese als Indikator für Individualisierung verstanden (Luckmann 1967, erweiterte Version: Luckmann 1991). Individualisierung wird jedoch im soziologischen Diskurs weit über den Bereich der Religion hinaus allgemein als ein Unterscheidungsmerkmal der Moderne und als eines ihrer dominanten Merkmale angesehen. Solche Ansichten verlieren in der Regel – wenn auch nicht in Luckmanns Fall – den zeitgleichen und im Blick auf Individualisierung paradoxen Aufstieg der Massenkultur als begleitenden Modus der Integration in modernen Gesellschaften aus den Augen. Auch wenn man bedenkt, dass sich die soziologischen Theorien der Moderne in dem Gewicht, das sie der Individualisierung beimessen, unterscheiden, hat die Individualisierung dennoch einen festen Platz in allen klassischen soziologischen Modernisierungskonten (wie bei Flavia Kippele [1998], Kron und Horáček [2009] und anderen). Aus dieser Perspektive erscheint Religion als negativ mit dem Prozess der Individualisierung verbunden. Mit Ausnahme einiger weniger Denker, wie Georg Simmel (1968) und später Luckmann selbst, wurde die Religion als Opfer der von Individualisierung geprägten Prozesse angesehen.
Aus religionsgeschichtlicher Perspektive lohnt es sich, die Narrative historischer Prozesse genauer zu betrachten, die als Grundlage für die Gleichsetzung von Individualisierung und Moderne gedacht waren. Diese Narrative nehmen ganz unterschiedliche Formen an. In seiner berühmten Studie über die italienische Renaissance behauptete Jacob Burckhardt (1860, 141), dass das Interesse an Subjektivität im europäischen Kontext seit Ende des 13. Jahrhunderts erheblich gestiegen sei. Spätere Studien zeigten, wie in dieser Zeit neue und bahnbrechende philosophische, ästhetische, philologische und religiöse Alternativen sowie neue Institutionen dazu beitrugen, Räume der Kritik und Distanz zu dem zu schaffen, was als ,traditionelle‘ Gesellschaft und Praxis angesehen wurde (z.B. Martin 2004). Mit dem Beginn der Renaissance wurde beispielsweise der Paganismus nicht nur zu einer ästhetischen Form, sondern auch zu einer religiösen Alternative (siehe Hanegraaff 2012; eine weitere Position siehe Stausberg 2009).
Die in diesen Kontexten zu identifizierenden Prozesse der religiösen Individualisierung wurden durch spätmittelalterliche Praktiken der religiösen Frömmigkeit inspiriert. Später, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, machte die Reformation die Religion zum Gegenstand individueller Wahl. Während die dominanten aristotelischen und scholastischen Paradigmen in den frühen Jahren der Renaissance auf den Prüfstand kamen, stellten die Reformatoren nun eine weitere dominante religiöse Tradition, den Katholizismus, erneut in Frage. In diesem Fall wurden die orthodoxen Interpretationen jedoch nicht nur durch intellektuelle und künstlerische Unternehmen verdrängt, sondern vielmehr offen bekämpft. Max Webers (1864–1920) Dissertation über die protestantische Ethik nach der Reformation ist ein besonders pointiertes Beispiel für diesen Trend, mit seinem Schwerpunkt auf der Hinwendung zur innerweltlichen Askese, der Verantwortung jedes Einzelnen für sein Leben und der „Rationalisierung des Lebensverhaltens“ − jetzt in der Welt und doch orientiert am Jenseits − als „Wirkung des Berufungskonzeptes des asketischen Protestantismus“ (Weber [1920] 2011, 157).
Die ersten Risse im westlichen Selbstbild einer primär, wenn nicht gar ausschließlich modernen westlichen Herkunft der (religiösen) Individualisierung werden im Kontext von Webers vergleichender Analyse eurasischer Weltreligionen und Zivilisationen sichtbar. Insbesondere in Bezug auf Indien sah Weber seine Intellektuellenreligionen oder Soteriologien als ein Repertoire der am stärksten ausgeprägten und am systematischsten entwickelten Einstellungen von Weltindifferenz und Weltabweisung für das kultivierte Individuum. Was Weber leugnete, war, dass sich diese individualisierende Haltung auf das Leben in der Welt auswirkte. Er glaubte auch nicht, dass diese Formen der Religiosität die Mehrheit der Laien oder die unteren Schichten der Gesellschaft (was er die „Massen“ nannte) erreichten. Weber sah die Entwicklungen in Indien und in allen anderen nicht-westlichen Zivilisationen als Sackgassen. Nur die protestantische Individualisierung ermöglichte für ihn den Durchbruch zur praktischen Individualisierung des Lebens in der Welt, der „Fähigkeit und Disposition des Menschen, bestimmte Arten von praktischem rationalem Verhalten anzunehmen“ (Weber 2004a, 109; siehe auch 1996, 250, 359/1958, 325; Fuchs 1988, 138ff. 277ff.; 2017, 227, 254).
Louis Dumont (1911–1998) entwickelte We...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Vorwort
- 1 Religious individualisation in historical perspective
- 2 Religiöse Individualisierung – und De-Individualisierung
- 3 Religious individualisation – and de-individualisation
- 4 Lived ancient religion: questioning cults and polis religion. A final report
- 5 Reports of fellows
- 6 ERC Advanced Grant “Lived Ancient Religion”
- 7 Article from the ERC project
- 8 Tagungsberichte/Report on conferences
- 9 Publications of fellows and staff