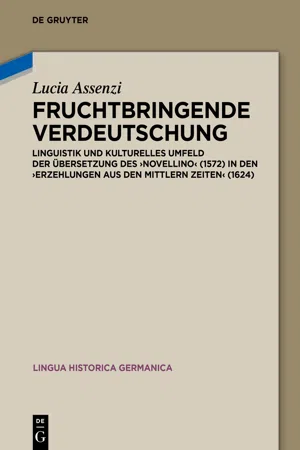1Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird die erste deutsche Übersetzung der italienischen Novellensammlung Novellino (1572) untersucht. Diese wurde ca. 1624 in Köthen von einer Gruppe bestehend aus einem Übersetzer und sieben Übersetzerinnen angefertigt und ist seit der kritischen Ausgabe von Seelbach (1985) unter dem Titel Die Erzehlungen aus den mittlern Zeiten bekannt.
Obwohl die Edition der Erzehlungen bereits seit mehr als 30 Jahren existiert, blieb der Text in der Forschung bisher weitestgehend unberücksichtigt. Weder seine Entstehung noch seine sprachlichen Eigenschaften wurden bis heute näher analysiert. Unbeachtet blieben ferner die Merkmale des Übersetzungsverfahrens von der italienischen Vorlage zur deutschen Übersetzung.
Die Untersuchung möchte einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücken leisten. Sie wird demnach sehr vielschichtig sein, denn hier sollen kulturelle, linguistische sowie übersetzerische Aspekte der Erzehlungen behandelt werden.
Im ersten Teil der Arbeit sollen die Erzehlungen zunächst in dem kulturellen Umfeld, in dem sie entstanden sind, besser verortet werden, als es bisher in der Literatur der Fall ist. Da alle Übersetzer der Erzehlungen mit Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen, dem Oberhaupt der Fruchtbringenden Gesellschaft (FG), verwandt waren, wird der Frage nachgegangen, ob ein Zusammenhang zwischen den linguistischen Merkmalen der Verdeutschung des Novellino und der theoretischen Sprachreflexion der FG hergestellt werden kann. In diesem Rahmen werden die Erzehlungen ferner ein konkretes Beispiel liefern, durch welches das Verhältnis zwischen der Grammatikschreibung und dem lebendigen Sprachgebrauch am Anfang des 17. Jh. erörtert werden kann.
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit ist einigen Aspekten der Übersetzungsstrategien der Erzehlungen gewidmet. Obwohl die zentrale Rolle der Übersetzungstätigkeit innerhalb der FG in der Literatur wiederholt unterstrichen wurde, fehlen nämlich bis heute Studien, die sich mit den konkret vorliegenden Merkmalen der ‚fruchtbringenden‘ Verdeutschungen befassen. Die Untersuchung der Wiedergabe des gerundio, einer besonders problematischen Verbform des Italienischen, soll wichtige Informationen darüber liefern, inwiefern die Übersetzer die italienische Vorlage verstanden haben, ob sie sie korrekt wiedergegeben haben und wie sie sich allgemein bei der Übersetzung verhielten.
Der Zweck des dritten Teils der vorliegenden Untersuchung besteht in der Beschreibung der Sprache der Erzehlungen. Diese wurde in der Literatur noch nie behandelt, in der hier untersuchten Übersetzung liegen allerdings morphologische und syntaktische Phänomene vor, die sich wegen ihres schwankenden bzw. unregelmäßigen Gebrauchs als besonders interessant erwiesen haben und die hier deshalb dargestellt werden sollen. Da nach wie vor nur wenige Studien der Prosasprache des 17. Jh. gewidmet sind, versteht sich dieser Teil der Arbeit außerdem als ein Beitrag zur Ergründung einiger morphologischer und syntaktischer Eigenschaften der literarischen Prosa der Barockzeit.
Die Darstellung der ausgewählten linguistischen Phänomene basiert auf einer eingehenden Untersuchung des Textes und auf einer genauen Quantifizierung ihrer Häufigkeit. Diese quantitative Analyse war ziemlich zeitberaubend, sie gestattet aber einen präzisen Einblick in den Gebrauch der hier besprochenen sprachlichen Elemente.
Diese Beschreibung sowie der Versuch, die Schwankungen in der Verwendung der hier analysierten Phänomene zu erklären, haben nicht wenige Schwierigkeiten geboten, denn leider sind die linguistischen Merkmale der literarischen Prosa des 17. Jh. wenig erforscht und deswegen noch nicht erschöpfend behandelt worden. Für die Analyse der hier ausgewählten morphologischen Phänomene habe ich selbstverständlich auf die Grammatiken des Frühneuhochdeutschen (bes. Ebert u. a. 1993 und Moser I, II, usw.) zurückgegriffen. Wie auch ein Großteil der Literatur zur Sprache des Frnhd. basieren diese jedoch weitestgehend auf den Texten des berühmten Bonner Korpus. Die Untersuchungen dieses Korpus geben wichtige Hinweise auf die allgemeine Entwicklung der Phänomene in den verschiedenen deutschen Sprachlandschaften von 1350 bis 1750, sie liefern aber nicht genügend Vergleichsdaten, wenn man sich für eine besondere Epoche und für einen besonderen Sprachraum interessiert: Das Bonner Korpus enthält lediglich einen Text pro Region und 50-Jahre-Abschnitt.
Neben diesen Nachschlagewerken über die Grammatik des Frnhd. habe ich die Ergebnisse aus meiner Untersuchung der Erzehlungen mit denen aus ähnlichen Forschungen von frnhd. Werken verglichen, etwa um zu verstehen, ob ein Phänomen nur für den hier analysierten Text typisch ist oder ob es doch im 17. Jh., im omd. Sprachraum bzw. in einer spezifischen Textgattung allgemein verbreitet war. Da nicht viele Studien über die Prosasprache dieser Epoche vorliegen, musste ich jedoch oft mit nicht vollständig kompatiblen Daten arbeiten, etwa mit Analysen von nicht-literarischen Texten oder von Werken aus einem etwas früheren bzw. späteren Zeitraum.
Auch die in der Literatur vorliegenden Studien zur frnhd. Syntax sind wenig und nur selten für eine Gegenüberstellung mit den Resultaten der Untersuchung der Erzehlungen geeignet. Die Literatur, die aus dem Bereich der Germanistik stammt, liefert bisweilen wichtige Daten über die Frequenz und die gattungsbedingte Verteilung der hier analysierten sprachlichen Merkmale. Ihre Funktion und die innersprachlichen Bedingungen, die sie verursachen oder ermöglichen, werden dagegen nur selten angesprochen. Deswegen wird in diesem zweiten Teil der Arbeit nicht nur auf die traditionelle germanistische Sprachgeschichte zurückgegriffen, sondern auch auf Analysen, die aus verschiedenen theoretischen Ansätzen zur formalen Linguistik stammen.
Im Folgenden werden demnach auch typologische Studien sowie Arbeiten aus dem minimalistischen Rahmen benutzt. Dabei besteht das Ziel meiner Studie immerhin nicht darin, die Natur des Sprachwandels oder die tieferen Gründe der Optionalität im Gebrauch syntaktischer Strukturen zu erklären, sondern meine Suche gilt dem jeweils geeignetsten Modell, das den Eigenschaften der im Folgenden analysierten syntaktischen Strukturen am besten Rechnung tragen kann.
Die eben dargestellten drei Teile der Arbeit sind in verschiedene Kapitel untergliedert. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Feinstruktur der Arbeit geboten.
Im zweiten Kapitel wird zunächst besprochen, wie sich die Sprachreflexion in den ersten Jahrzehnten seit der Gründung der FG (1617) gestaltete. Um die Entstehungsbedingungen der FG unter der Leitung des Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen zu verstehen sowie um zu erklären, wie die italienische Vorlage der Erzehlungen überhaupt in Köthen landete, werden zu Beginn des Kapitels die kulturellen Beziehungen zwischen Fürst Ludwig und Italien erläutert. Die Anregung, die FG zu instituieren, erhielt Fürst Ludwig nämlich während seines Aufenthalts in Florenz (1599–1601), wo er das zweite ausländische Mitglied der 1583 begründeten und bis heute bestehenden Sprachakademie Accademia della Crusca wurde. Da die Accademia della Crusca unter verschiedenen Gesichtspunkten als Vorbild für die FG galt, werden ihre Entstehung, ihre Zwecke und ihre Stellungnahme im italienischen Sprachenstreit, der die intellektuelle Diskussion im Italien des 16. Jh. prägte, in Anlehnung an Marazzini (2002) erklärt.
Danach wird auf die FG eingegangen, und zwar spezifisch auf ihre Vorstellungen hinsichtlich der Natur und Gestalt der idealen und reinen deutschen Sprache, die im Briefwechsel und in den Statuten der Gesellschaft nachzulesen sind. Kurz thematisiert wird in diesem Zusammenhang ebenfalls die spätere Diskussion zwischen den Anomalisten (Christian Gueintz, Fürst Ludwig) und den Analogisten (etwa Schottelius). Zweck dieser Darstellung ist es, die Hauptpunkte und Differenzen der ersten Versuche zur Normierung der deutschen Sprache deutlich zu machen. Im Anschluss wird die Bedeutung der Übersetzung in der FG erörtert. Auf ihre Rolle als Mittel zur Aneignung fremder kultureller Vorbilder sowie zur Aufwertung und Verbesserung der deutschen Sprache wird eingegangen.
Dieses Kapitel wird sich ausschließlich mit den wesentlichen Informationen und Hintergründen beschäftigen, denn hier muss sich meine Arbeit auf eine Zusammenfassung der wichtigen und erschöpfenden Ergebnisse der Literatur beschränken. Den Studien über die barocke Sprachreflexion, den Sprachpurismus und -patriotismus in Jones (1995), Gardt (1994; 1999b), Hundt (2000) und Stukenbrock (2005) ist kaum etwas hinzuzufügen. Ebenso wissen wir bereits über die barocken Akademien dank der unentbehrlichen Arbeit von Conermann (1978; 1985; 1988; 1989; 2008; 2013), Dünnhaupt (1978; 1979; 1988) und Ball (2008; 2010; 2012), aber auch von Lange (2002), Schmidt (2001) usw., sehr viel.
Das dritte Kapitel kann dagegen denjenigen Lesern, die mit der älteren italienischen Literatur nicht vertraut sind, einige neue Informationen bieten. Der sogenannte Novellino zählt sicher nicht zu den bekanntesten italienischen Texten, deswegen schien es mir nötig, ihn kurz vorzustellen. Die komplizierte philologische Geschichte des Novellino, der am Ende des 13. Jh. von einem anonymen Kompilator verfasst wurde und der sich bis ins 16. Jh. hinein ständig weiterentwickelte, wird hauptsächlich anhand der grundlegenden Untersuchungen und Editionen von Battaglia Ricci (1982; 2013), Conte (2001; 2013), Pozzi (1988; 2005) und Segre (1959) rekonstruiert.
In Kapitel 4 wird die Handschrift der Erzehlungen näher beschrieben. Ausgehend von den wichtigen Informationen aus Seelbach (1985) wird die Hypothese der Entstehung des Manuskripts in Köthen um 1624 untermauert. Außerdem wird ein detailliertes biographisches Profil der Übersetzer gegeben, das z. T. auf den in der Literatur vorliegenden Hinweisen (Conermann 1988, Ball 2010; Ball 2012; Ball 2014; Ball 2016; Da Köthen I.1. usw.) basiert, das aber durch Angaben aus unedierten Briefen und Dokumenten der Übersetzer und Übersetzerinnen der Erzehlungen ergänzt worden ist, die ich im Landesarchiv Sachsen-Anhalt während eines von der Universität Padua finanziell unterstützten Aufenthalts in Dessau im Juni 2016 nachschlagen konnte. Im Kapitel werden des Weiteren einige Fragen über die Erzehlungen gestellt, die in der Literatur noch nicht behandelt wurden. Insbesondere wird untersucht, ob die Übersetzer nachweislich ein lexikographisches Werk benutzt haben. Bereits in Seelbach (1985) wird außerdem bemerkt, dass die Handschrift von einem Redaktor korrigiert wurde; die Beschaffenheit und die Typologie dieser Verbesserungen werden hier zum ersten Mal untersucht. Schließlich wird gezeigt, dass die im Kapitel gesammelten Elemente über die formale Gestalt und die lexikalischen und graphischen Eigenschaften der Erzehlungen es erlauben, diese Verdeutschung mit Sicherheit in einen Zusammenhang mit der Sprachreflexion der FG zu setzen.
Im folgenden Teil der Arbeit soll auf die Übersetzungstechnik der Erzehlungen eingegangen werden. Zu diesem Zweck wurde ein besonders problematisches Phänomen der italienischen Sprache, das gerundio, gewählt. Diese hervorstechende infinite Verbalform, die eine nur kontextuelle und jeweils zu bestimmende adverbiale Beziehung zum übergeordneten Satz ausdrückt, wird in Kapitel 5. zunächst in typologischer Sicht mit Hilfe des Begriffs des ‚Konverbs‘ erklärt (s. Haspelmath & König 1995). Danach wird auf die Schwierigkeiten eingegangen, die die Verdeutschung des gerundio bereiten. Um am deutlichsten darstellen zu können, ob die Übersetzer der Erzehlungen die unterschiedlichen semantischen Werte des gerundio erkennen und wie sie diese wiedergeben, werden die gerundi der italienischen Vorlage nach der semantischen Beziehung geteilt, die sie ihrem Matrixsatz gegenüber ausdrücken. Erst danach werden die verschiedenen Wiedergabemöglichkeiten besprochen.
Da ein gerundio nur in einem breiteren Kontext und Kotext verstanden werden kann, impliziert die Untersuchung von dessen Wiedergabe die Gegenüberstellung längerer Textstellen des Ausgangs- und des Zieltextes. Dabei wird es möglich sein, allgemeinere Merkmale der Übersetzungstechnik der Erzehlungen zu beobachten.
Der dritte Teil der Arbeit, der der Sprache der Erzehlungen gewidmet ist, ist grundsätzlich beschreibend. Einige morphologische und syntaktische Phänomene, die sich durch Schwankungen und durch die Koexistenz von gleichberechtigten Varianten auszeichnen, wurden hier ausgewählt. Diese werden in den jeweiligen Kapiteln zunächst in ihre sprachgeschichtliche Entwicklung eingeordnet; danach wird ihr Gebrauch in den Erzehlungen dargestellt.
Im sechsten Kapitel wird auf den präteritalen Ablaut der starken Verben der mhd. AR III und der Verben mit Rückumlaut eingegangen. Kapitel 7. ist der Flexion der Adjektive gewidmet, während Kapitel 8. die Rektion einiger Präpositionen mit Akk. und Dat. behandelt. Dabei wird versucht zu erklären, ob die Schwankungen im Gebrauch dieser linguistischen Elemente etwa sprachlandschaftlich bedingt sind oder ob sie mit den persönlichen Präferenzen der jeweiligen Übersetzer zusammenhängen. Auch die Frage, ob sie mit gattungsspezifischen Tendenzen in Verbindung stehen, wird oft gestellt.
Für die in Kapiteln 6.–8. gewählten Phänomene wird es ferner möglich sein, ihre konkrete Verwendung in den Erzehlungen mit den Äußerungen zu vergleichen, die sich in der Grammatikschreibung des 17. Jh. finden. Das einzige grammatische Werk, das vor der Entstehung der Erzehlungen erschien und das im kulturellen Umfeld rund um Fürst Ludwig und die FG produziert wurde, ist jedoch die 1619 in Köthen gedruckte Allgemeine SprachLehr des Pädagogen Wolfgang Ratke. Diese ist sehr knapp und gibt kaum Angaben über die hier ausgesuchten und analysierten Phänomene. Deswegen werden ebenso die 1630 von Ratke verfasste WortschickungsLehr Der Christlichen Schule sowie der Deutscher Sprachlehre Entwurf (1641) des Christian Gueintz herangezogen. Diese Texte wurden deswegen gewählt, weil sie bzw. ihre Autoren in direktem Kontakt mit Fürst Ludwig bzw. mit der FG standen: Ratke hielt sich bis 1618 in Köthen auf und arbeitete mit Fürst Ludwig an der Reform des Köthener Schulwesens. Christian Gueintz gilt dagegen als offizieller Grammatikschreiber der FG: Sein Entwurf wurde von Fürst Ludwig tiefgreifend revidiert und drückte dessen Sprachauffassung aus.
Natürlich kannten die Übersetzer der Erzehlungen, die spätestens im März 1624 angefertigt wurden, diese Werke nicht. Die Frage, auf die hier eingegangen wird, kann also nicht diejenige sein, ob man in der konkreten Schreibpraxis die Regeln der Grammatikschreibung befolgte, sondern umgekehrt: Inwiefern spiegelt die Grammatikschreibung die Vielfalt der lebendig benutzten Sprache wider?
Die darauffolgenden Kapitel beschäftigen sich mit einigen Elementen der Syntax der Erzehlungen. Dabei ist ein Vergleich mit der barocken Grammatikschreibung nicht möglich, denn diese konzentrierte sich fast ausschließlich auf Rechtschreibung und Morphologie, während sie die Syntax normalerweise unerwähnt lässt.
Als erster syntaktischer Aspekt der Erzehlungen wird in Kapitel 9. die Reihenfolge der Verbalformen in Verbletzt-Nebensätzen mit einem mehrgliedrigen Prädikat besprochen. Dabei wird das Auftreten der unterschiedlichen Verbstellungsmöglichkeiten in den Erzehlungen quantifiziert und mit den Daten aus Härd (1981), Takada (1994) und Sapp (2001) verglichen, die sich mit der Stellung der Prädikatsteile im Nebensatz im Frnhd. beschäftigt haben. Die selteneren Verbstellungsmöglichkeiten werden nicht nur beschrieben, sondern als Resultat des Einflusses v...