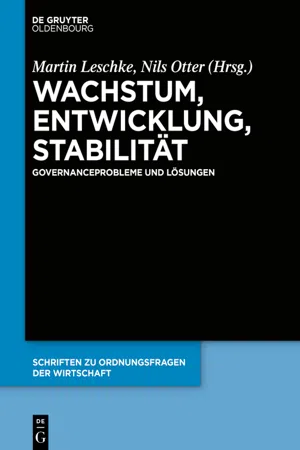
eBook - ePub
Wachstum, Entwicklung, Stabilität
Governanceprobleme und Lösungen
- 325 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Wachstum, Entwicklung, Stabilität
Governanceprobleme und Lösungen
Über dieses Buch
Der vorliegende Band enthält die Beiträge des 52. Forschungsseminars Radein. Der Sammelband untersucht, welche Rolle globale Instabilitäten auf volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Staaten bzw. Regionen haben und welche neuen wirtschaftspolitischen Konzepte gefragt sind, um die Probleme in Griff zu bekommen oder gar zu lösen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Wachstum, Entwicklung, Stabilität von Martin Leschke, Nils Otter, Martin Leschke,Nils Otter im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Volkswirtschaftslehre & Makroökonomie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil III Ausgewählte Entwicklungsprobleme und Konzepte
Wachstum und ökologischer Fußabdruck – Zielkonflikt, mögliche Lösungskonzepte und ordnungspolitische Schlussfolgerungen
Thomas Döring
1 Einführung und Problemstellung
Das weltweit vorherrschende Entwicklungsmodell in Form eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums steht wegen seiner ökologisch negativen Auswirkungen in der Kritik. Diese Kritik am Wachstumsparadigma ist jedoch keineswegs neu, vielmehr gibt es sie fast schon so lange wie das Wirtschaftswachstum selbst.1 Mit Blick auf die zurückliegenden 50 Jahre führte vor allem der erste Bericht an den Club of Rome (vgl. Meadows et al. 1972) zu einer breiteren gesellschaftlichen Diskussion um die „Grenzen des Wachstums“ auf einem Planeten mit endlichen natürlichen Ressourcen. Die wachstumskritischen Beiträge der jüngeren Vergangenheit knüpfen daran an, erweitern die frühe Diskussion unter Schlagworten wie „Post-Wachstum“, „Green Growth“ oder „De-Growth“ jedoch zugleich um neue Perspektiven der Kritik, aber auch denkbare Lösungen des Konflikts zwischen Wachstum und Umweltschutz (vgl. Bergh und Kallis 2012; Bardi 2013; Klingholz 2014; Jackson 2017). Zwar sind Zielkonflikte und damit einhergehende Opportunitätskosten als solches aus ökonomischer Sicht keine Besonderheit. Die Brisanz des Konflikts zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch kann jedoch in der mittlerweile erreichten Eingriffsintensität ökonomischen Handelns in die natürlichen Regelkreisläufe gesehen werden, die den Fortbestand der menschlichen Zivilisation selbst gefährden könnte.
Der Atmosphärenforscher und Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen hat in diesem Zusammenhang den Begriff des „Anthropozäns“ – der Epoche des Menschen – geprägt, um sowohl auf die Dringlichkeit als auch die Offenheit der Lösung des Konflikts zwischen Ökologie und Wirtschaftswachstum zu verweisen. Damit soll der Sachverhalt beschrieben werden, dass „erdgeschichtlich erstmals der Mensch zu einem zentralen Einflussfaktor auf relevante geoökologische Prozesse geworden ist“ (Schneidewind 2018, 132). Danach hängt nicht nur die Existenz der Menschheit immer stärker von der Umwelt ab, sondern auch die Umwelt immer massiver vom menschlichen Verhalten, wobei sie erhalten, verändert oder auch dauerhaft zerstört werden kann.2 Von den drei genannten Optionen spricht aktuell viel für die Realisierung der dritten Variante, d. h. einer zunehmenden irreversiblen Schädigung vorhandener Umweltgüter. So wurden von einer Gruppe von (Natur‑)Wissenschaftlern neun grundlegende ökologische Prozesse untersucht und darauf bezogen planetare Belastungsgrenzen („Planetary Boundaries“) festgelegt, bei deren Überschreitung eine Gefährdung der ökologischen Funktionsweise des Planeten droht (vgl. Rockström et al. 2009; Foley et al. 2010).3 Danach sei bereits heute bei drei dieser Prozesse (Biodiversität, Stickstoffkreislauf, Klima) eine solche Überschreitung gegeben. Als verursachender Faktor für die Entwicklung wird die heutige Wirtschaftsweise angesehen, welche die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört und dadurch den Wohlstand zukünftiger Generation untergräbt. Die großflächige Abholzung von Wäldern, die Überfischung der Meere oder der Verlust fruchtbarer Böden gelten als prägnante Beispiele für diese Entwicklung. Allein die globalen Folgen des Klimawandels sowie des Verlusts an biologischer Vielfalt werden vom Umweltbundesamt für das Jahr 2050 auf rund 25 Prozent des weltweiten BIPs geschätzt (vgl. UBA 2018).
Die voranschreitende Umweltzerstörung zeigt sich auch bei der Messung des sogennanten Ökologischen Fußabdrucks. Es handelt sich dabei um ein vom Global Footprint Network (GFN) berechnetes Kennzahlensystem, mit dessen Hilfe quantifiziert werden soll, wie viele Ressourcen der Menschheit zur Verfügung stehen, und wie viele sie verbraucht (siehe auch Wackernagel und Beyers 2016). Der Ökologische Fußabdruck kann folglich als eine Art Buchhaltungssystem für natürliche Ressourcen verstanden werden, das Auskunft darüber gibt, in welchem Umfang einzelne Länder, aber auch die Menschheit insgesamt, natürliche Ressourcen verbrauchen relativ zum gegebenen Bestand. Ein Ergebnis dieser Berechnung ist der „Ecological Debt Day“ beziehungsweise „Earth Overshoot Day“. Dieser gibt für jedes Jahr den Kalendertag an, ab welchem das Ausmaß der durch die Menschheit genutzten Ressourcen die Kapazität der Erde im Sinne ihrer natürlichen Selbstregenerationsfähigkeit übersteigt. Im Jahre 2019 war dieser Tag bereits am 29. Juli erreicht und damit sehr viel früher als noch vor 40 Jahren, als dieses Datum erstmals berechnet wurde und auf den 19. Dezember fiel. Über die Zeit zeigt sich ein zunehmender Verzehr an natürlichen Ressourcen, der vor allem in den Industrie- und Schwellenländern besonders ausgeprägt ist (vgl. Global Footprint Network 2020).
Nicht allein die Messwerte des Ökologischen Fußabdrucks stimmen unter der Annahme unveränderter wirtschaftlicher Verhaltensmuster wenig optimistisch mit Blick auf den zukünftigen Bestand an Umweltgütern. Vielmehr befeuern auch andere Studien eine eher pessimistische Zukunftserwartung unter Fortschreibung der Status-quo-Bedingungen. So werden etwa im jüngsten Bericht an den Club of Rome, der eine globale Entwicklungsprognose für den Zeitraum bis 2052 enthält, weiterhin steigende (negative) Beeinträchtigungen von Klima und Natur aufgrund wirtschaftlichen Handelns prognostiziert, ohne dass diese vollständig oder auch nur zu größeren Teilen in die Wirtschaftsrechnung von Unternehmen einfließen. Zudem wird – trotz einer immer effizienteren Nutzung von Energie – ein wachsender Energieverbrauch erwartet (vgl. Randers 2012). Aufgrund von wachsenden Umweltschäden und zunehmend knapper werdenden natürlichen Ressourcen sowie einer daraus resultierenden Verringerung des Produktivitätszuwachses wird allerdings auch von einem deutlich langsameren Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung ausgegangen.4
Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Ausführungen geht der vorliegende Beitrag zunächst der Frage nach, wie sich der Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt(‑schutz) aus ökonomischer Sicht sowohl inhaltlich, institutionell als auch zeitlich näher bestimmen lässt (Kapitel 2). Daran anschließend werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die unterschiedliche Reformmaßnahmen zur „Entschärfung“ der Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch zum Gegenstand haben (Kapitel 3). Diese lassen sich grob danach differenzieren, ob (1) der Zielkonflikt als unlösbar eingestuft wird (De-Growth- beziehungsweise Post-Wachstums-Ansätze), (2) ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen durch eine ethische Neuausrichtung der Marktwirtschaft realisiert werden soll (Ansatz der Gemeinwohlökonomie) oder (3) von der Möglichkeit einer weitgehenden Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch (Ansätze des „Green Growth“) ausgegangen wird. Der Beitrag endet mit der Ableitung ordnungspolitischer Schlussfolgerungen, die als wichtige Bausteine einer Lösung des Zielkonflikts zwischen Wachstum und Umwelt zu verstehen sind (Kapitel 4).
2 Zentrale Elemente des Zielkonflikts zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz
Umweltschäden werden in aller Regel als das Ergebnis einer wirtschaftlichen Nutzung natürlicher Ressourcen angesehen. Sie werden durch Produktion und Konsum sowie die Aufnahme von Schadstoffen innerhalb der bestehenden Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden) verursacht.5 Unter der Annahme eines gegebenen Standes der Technik bezogen auf Produktion und Entsorgung, induziert die wirtschaftliche Nutzung der Umwelt einen Zielkonflikt zwischen einer quantitativen Zunahme der Menge an Gütern und Dienstleistungen und der bestehenden Umweltqualität. Dem liegt die ökonomische Vorstellung einer Produktionsmöglichkeitskurve zugrunde, aus der sich ableiten lässt, wieviel maximal an Gütern und Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt hergestellt werden kann und wieviel Schadstoffe dabei in Kauf zu nehmen sind. Mit steigender Produktion werden dabei mehr Schadstoffe erzeugt (Siebert 1985, 386). Diese Kopplung und der daraus sich ergebende Zielkonflikt hinsichtlich der Nutzung von Umweltgütern und natürlichen Ressourcen unter der Bedingung wirtschaftlichen Wachstums hat eine inhaltliche, institutionelle und zeitliche Dimension.
2.1 Die inhaltliche Dimension: Nutzungskonkurrenz und Wachstumszwang
Aus ökonomischer Sicht sind der beschriebene Kopplungseffekt und der damit einhergehende Zielkonflikt zunächst nichts ungewöhnliches, da Wirtschaftswachstum ebenso wie Umweltschutz jeweils mit Opportunitätskosten einhergehen: Ein Wachstum der Menge an Gütern und Dienstleistungen führt bei gegebenem technischem Wissen dazu, dass andere Aktivitäten wie etwa ein schonenderer Umgang mit der Umwelt nicht weiter verfolgt werden können. Soll demgegenüber die Umweltqualität gesteigert werden, so geht dies unter gegebenen Bedingungen nur durch einen Verzicht auf andere Güter beziehungsweise deren quantitativen Vermehrung. Solange Umweltgüter überreichlich vorhanden und damit ihr Umfang und ihre Assimilationskapazitäten sehr groß waren, stellte deren wirtschaftliche Nutzung kein Problem dar. Zu Problemen kommt es erst dann, wenn Umweltgüter knapp werden und es zu einer Nutzungskonkurrenz im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten in Form von Produktions-, Konsum- und Deponiefunktion kommt (vgl. Siebert 1985: 387).
Erst angesichts einer zunehmenden Nutzungskonkurrenz macht die Interpretation von Wachstum und Umwelt als einem konfliktbehafteten Verhältnis einen inhaltlichen Sinn. Die Konfliktthese besagt, dass (quantitatives) Wirtschaftswachstum durch den hiermit verbundenen steigenden Energie- und Rohstoffverbrauch sowie Schadstoffemissionen zu einer steigenden Umweltbelastung führt. Im Gegenzug wird befürchtet, dass ein vermehrter Umweltschutz das wirtschaftliche Wachstum insofern negativ beeinträchtigt, wie Maßnahmen zum Erhalt oder zur Steigerung der Umweltqualität zu Lasten anderer möglicher Investitionen gehen können, die das Produktionspotenzial steigern (vgl. Sprenger 1994: 537 ff.). Allokationstheoretisch bedarf es insofern einer Abwägung aller Vor- und Nachteile von Umweltschutzmaßnahmen – nicht zuletzt auch in Bezug auf das Wachstumsziel. Dabei sind jedoch zwei Aspekte besonders zu berücksichtigen: So bilden zum einen gemäß dem Postulat einer nachhaltigen Entwicklung nicht nur die Bedürfnisse der jeweils gegenwärtigen Generation den Maßstab für einen angemessenen Umgang mit dem Konflikt zwischen Wachstum und Umweltschutz. Darüber hinaus ist auch die Beeinträchtigung der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen bei der Bestimmung von Umweltschäden und der daraus resultierenden Opportunitätskosten wirtschaftlichen Wachstums mit zu berücksichtigen. Der Nachhaltigkeitsgrundsatz stellt zudem nicht allein auf die unmittelbaren Umweltwirkungen auf den Menschen ab, sondern bezieht auch all jene Schädigungen von Tieren und Pflanzen in die Betrachtung mit ein, die auf den Menschen zurückwirken können (vgl. Rogall 2012a: 41 ff.).
Zum anderen ist für die inhaltliche Dimension des Zielkonflikts von Bedeutung, dass wirtschaftliches Wachstum durch eine starke Eigendynamik gekennzeichnet...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Vorwort
- Entwicklung und kollektives Handeln: Marktwirtschaft, Demokratie, Governance
- Teil I Grundlegende Zusammenhänge
- Teil II Wachstums- und Stabilitätsprobleme in den Industriestaaten
- Teil III Ausgewählte Entwicklungsprobleme und Konzepte
- Teilnehmerliste Radein 2019