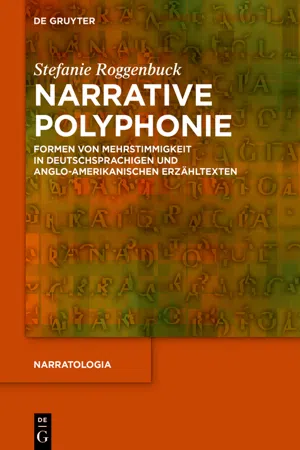Im Folgenden sollen nun literaturtheoretische Ansätze besprochen werden, welche sich auf verschiedene Weise dem Problem potenzieller Mehrstimmigkeit2 in Erzähltexten nähern. Um den Stimmbegriff Genettes weiterzuentwickeln, stehen hierbei zunächst die extradiegetische Erzählinstanz3 und die Frage im Vordergrund, ob sich der jeweilige theoretische Zugriff auf eine bestimmte, innerhalb der Narratologie bisher vernachlässigte Variante der Mehrstimmigkeit anwenden lässt, die durch ein Nebeneinander zweier (oder mehrerer) ‚Stimmen‘ innerhalb einer Erzählinstanz konstituiert wird und welche an dieser Stelle als narrative Polyphonie bezeichnet werden soll.
Eine erste hilfreiche Ergänzung zu dem sehr schematischen Konzept Genettes könnte der Zugriff Michail Bachtins bieten, der sich über seine Konzepte der Dialogizität und des polyphonen Romans der Frage nach Stimme(n) in fiktionalen Texten aus literaturtheoretischer Sicht nähert. Anschließend wird der Terminus des unzuverlässigen Erzählers nach Wayne C. Booth diskutiert, welcher die bisher vernachlässigte Frage aufwirft, ob sich die narrative Instanz innerhalb eines Textes sowohl zuverlässig als auch unzuverlässig äußern kann, und wenn ja, wie bzw. ob diese Form einer doppelten ‚Stimme‘ mittels einer Analyse der in dem Text angelegten Voraussetzungen4 erschlossen werden kann. Als nächster Ansatz wird die erlebte Rede in Erzähltexten beleuchtet und untersucht, ob und inwiefern der Einfluss der Stimme einer Figur auf die Erzählerstimme tatsächlich als ein gleichwertiges ‚Stimmen‘-Pendant auf der Ebene der narrativen Instanz gewertet werden kann. Im Anschluss wird das aus der russischen Literaturtheorie stammende Skaz-Konzept fokussiert, welches – nicht unähnlich dem Ansatz von Bachtin – von einer zugleich expliziten und impliziten Botschaft der Erzählinstanz ausgeht, so dass es zu überlegen gilt, ob hier eine Variante von Mehrstimmigkeit innerhalb einer Erzählebene vorliegt. Abschließend wird der literaturtheoretische Terminus der Intertextualität erläutert und mit Rückgriff auf das Begriffsverständnis Gérard Genettes für eine narratologische Kategorisierung fruchtbar gemacht.
1.1 Die narratologische Kategorie der ‚Stimme‘ in fiktionalen Erzähltexten
Um die narrative Instanz literarischer Texte erschließen zu können, gibt Genette an, dass diese zunächst „im Hinblick auf die Spuren, die sie in dem narrativen Diskurs, den sie angeblich hervorgebracht hat, (angeblich) hinterlassen hat“,5 zu untersuchen sei. Die „Produktionsinstanz des narrativen Diskurses“6 wird also als außertextuell verstanden und Genette schlägt drei verschiedene Kriterien für die ‚Spurensuche‘ nach ihr vor: Die Zeit der Narration, die narrative Ebene und die Kategorie der Person, worunter das Verhältnis des Erzählers zum Erzählten und gegebenenfalls auch die Relation des narrativen Adressaten zur erzählten Geschichte fallen.7
Die Zeit der Narration betrifft das Verhältnis der narrativen Instanz zur erzählten Geschichte. Genette differenziert hier zwischen vier verschiedenen Narrationstypen: Die spätere Narration, die frühere Narration, die gleichzeitige Narration und die eingeschobene Narration.8 Während sich die ersten drei Möglichkeiten vergleichsweise unkompliziert gestalten, wird die letztgenannte Variante als die diffizilste Form des Erzählens hervorgehoben, „da es sich um eine Narration mit mehreren Instanzen handelt und da sich die Geschichte und die Narration hier dergestalt verwickeln können, dass letztere auf erstere reagiert“.9 Als Beispiel hierfür wird nun der Briefroman angeführt, dessen besonderer Reiz nach Genette in der Diskrepanz zwischen erlebendem und erzählendem Ich besteht, so dass der Sprecher10 zwar durchaus noch von dem Erlebten geprägt sein kann, zugleich aber das eigene Handeln aus einer gewissen – zumindest zeitlichen – Distanz heraus betrachtet.11
Als nächste Kategorie für eine nähere Bestimmung der narrativen Instanz wird die narrative Ebene genannt. Grundlegender Gedanke hierbei ist, dass innerhalb einer Erzählung eine oder mehrere Geschichten erzählt werden können, welche dann aber im Verhältnis zur Rahmengeschichte auf einer anderen Ebene positioniert sind. Genette definiert hier folgendermaßen: „Jedes Ereignis, von dem in einer Erzählung erzählt wird, liegt auf der nächsthöheren diegetischen Ebene zu der, auf der der hervorbringende narrative Akt dieser Erzählung angesiedelt ist“.12 Entscheidend für die Benennung der narrativen Ebene einer (Binnen-)Erzählung ist also, dass diese stets in einem relationalen Verhältnis zu der narrativen Instanz einer ersten Erzählung steht, welche „per definitionem extradiegetisch [ist]“,13 so dass sich für eine Erzählinstanz zweiter Stufe die Bezeichnungen diegetisch,14 für eine Erzählinstanz dritter Stufe metadiegetisch, für eine Erzählinstanz vierter Stufe meta-metadiegetisch usw. ergeben.
Die Möglichkeit eines Wechsels zwischen narrativen Ebenen wird klar definiert:
Der Übergang von einer narrativen Ebene zur anderen kann prinzipiell nur von der Narration bewerkstelligt werden, einem Akt, der genau darin besteht, in einer bestimmten Situation erzählend – durch einen Diskurs – eine andere Situation zu vergegenwärtigen. Jede andere Übergangsform ist, wenn nicht überhaupt unmöglich, so doch zumindest eine Art Transgression. […] Jedes Eindringen des extradiegetischen Erzählers oder narrativen Adressaten ins diegetische Universum (bzw. diegetischer Figuren in ein metadiegetisches Universum usw.) […] zeitigt eine bizarre Wirkung, die mal komisch ist, […] mal phantastisch. Wir wollen den Ausdruck narrative Metalepse so weit fassen, daß er alle diese Transgressionen abdeckt.15
Hieraus ergibt sich, dass die narrative Metalepse nach Genettes Definition aufgrund ihrer „bizzare[n] Wirkung“ (s. o.) niemals unbemerkt bleiben kann, sondern die Erzählstruktur des Textes auf irritierende Weise in den Vordergrund gerückt wird.
Für die Kategorie der ‚Person‘ benennt Genette zunächst zwei Möglichkeiten, die sich dem Verfasser eines Textes für die Gestaltung der Erzählsituation bieten: „Er kann die Geschichte von einer ihrer ‚Personen‘ […] erzählen lassen oder von einem Erzähler, der selbst in dieser Geschichte nicht vorkommt“.16 Den erstgenannten Typus bezeichnet er als homodiegetisch, den zweiten als heterodiegetisch. Den Sonderfall des homodiegetischen Erzählers stellt der autodiegetische Erzähler dar, der nicht nur Teil der erzählten Geschichte ist, sondern auch deren Hauptfigur darstellt. Zugleich definiert Genette den pragmatischen Status der jeweiligen Narrations- bzw. Kommunikationstypen, indem den einzelnen Sprechern auch ein narrativer Adressat zugeordnet wird:
Zum intradiegetischen Erzähler gehört ein intradiegetischer narrativer Adressat, […] der extradiegetische Erzähler hingegen kann nur auf einen extradiegetischen narrativen Adressaten zielen, der hier mit dem virtuellen Leser zusammenfällt, mit dem sich dann jeder reale Leser identifizieren kann.17
Das von Genette entworfene Analysemodell zur ‚Stimme‘ ist jedoch bekanntermaßen umstritten und provoziert Widerspruch. Vor allem die eingangs zitierte Kopplung von ‚Stimme‘ und ‚Person‘ bildet die Grundlage einer Diskussion, in welcher Genette in erster Linie von Vertretern des Poststrukturalismus und der Linguistik18 angegriffen worden ist. Im Vordergrund steht hier die Kritik aus poststrukturalistischer Sicht, zur Personifizierung eines „dominanten Aussagesubjekts im Text beizutragen und so ein zentralistisches Textverständnis zu befördern“,19 wie Andrew Gibson bemängelt:
For Genette, what matters most is the idea of voice as the ‘final instance’ governing narrative […]. In Gennetian narratology, voice is actually the ultimate ‘fixed point’ to which other aspects of narrative can be referred.20
Von Seiten der Linguisten wird der Vorwurf erhoben, dass es sich bei fiktionalen Erzähltexten grundsätzlich nicht um einen Kommunikationskontext handele. So argumentiert Ann Banfield:
For it is in the language of narrative fiction that literature departs most from ordinary discourse and from those of its functions which narrative reveals as separable from language itself. In narration, language attains the fullest exploitation of its possibilities and reaches their limits. […] All this comes down to the fact that in narrative, subjectivity or the expressive function of language emerges free of communication and confronts its other in the form a sentence empty of all subjectivity.21
Als Konsequenz, so lässt sich schlussfolgern, könnte aus linguistischer Sicht die Kategorie der ‚Stimme‘ gänzlich getilgt werden – denn wo weder ein Aussagesubjekt noch ein Kommunikationskontext vorhanden sind, kann es aus logischer Sicht keine – wie auch immer geartete – Form der ‚Stimme‘ geben.22
Doch auch aus dem Blickwinkel einer an Textstrukturen orientierten Erzähltheorie, innerhalb welcher Genettes Kategorie der ‚Stimme‘ ja bekanntlich auf breite Akzeptanz gestoßen ist, ergibt sich ein weiteres wichtiges Problem, welches bisher noch nicht im Fokus der Kritik stand: Die Absenz einer als mehrstimmig gedachten narrativen Instanz innerhalb seines Modells, für die mindestens eine zweite, potenziell aber auch n-fache sich zu dem erzählten Geschehen äußernde ‚Stimme‘ konstitutiv ist. Dieser Punkt hängt maßgeblich mit der Genetteschen Anbindung des Stimmbegriffs an die Vorstellung von einer Person zusammen, wie im Folgenden noch gezeigt werden wird.
Für die narratologische Analyse einer Reihe fiktionaler Erzähltexte gestaltet sich diese Einschränkung des Genetteschen Beschreibungsvokabulars auf den ersten Blick folgenlos. Das gilt auch in den Fällen, in denen sich eine vermeintliche Mehrstimmigkeit als interne Fokalisierung herausstellt: Hierbei handelt es sich nicht um eine Variante narrativer Polyphonie, sondern um die Verquickung der Erzählerstimme mit der Perspektive einer...