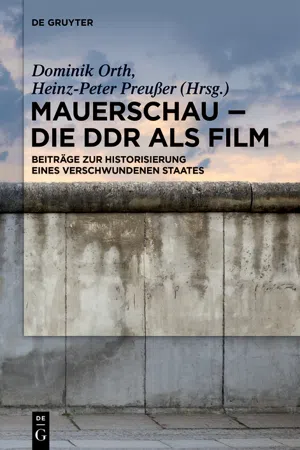
Mauerschau - Die DDR als Film
Beiträge zur Historisierung eines verschwundenen Staates
- 318 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Mauerschau - Die DDR als Film
Beiträge zur Historisierung eines verschwundenen Staates
Über dieses Buch
30 Jahre nach dem Mauerfall gilt es kulturwissenschaftlich aufzuarbeiten, in welcher Form Filme aus der und über die DDR unsere Vorstellung von diesem inzwischen verschwundenen Staat prägen.
Im Kontext kollektiver Erinnerungsprozesse übernehmen Fiktionen, die Zeitgeschichte narrativ aufgreifen, wichtige kulturelle Funktionen, auch und sogar dann, wenn realweltliches Geschehen im Zuge einer Aufbereitung für breite Zuschauerinnen- und Zuschauerkreise verdichtet und zugespitzt wird. Fiktionale Bildmedien bieten dabei eine spezifische Form der Aufarbeitung. Die Prägekraft von (Spiel-)Filmhandlungen übersteigt den Gehalt der Nachrichten, die mit dem Tagesgeschäft verschwinden, um ein Vielfaches, ja sie verdrängt sogar die eigene Erfahrung. Die von entsprechenden Erzählungen tradierten Motive und Themen sind oftmals diskursbestimmend, wenn über die ehemalige Deutsche Demokratische Republik gesprochen und geschrieben wird – unabhängig davon, wie nah oder fern sie sich tatsächlich an der Historie messen lassen können.
Der Band stellt sich daher der Aufgabe, wirksame Bilder aus und über die DDR in Einzelanalysen von DEFA-Klassikern sowie BRD- und Hollywood-Produktionen vor und nach 1989 nachzuzeichnen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1 Frühgeschichte – Genese des ‚antifaschistischen Schutzwalls‘
Wie anfangen? ‚Vergangenheitsbewältigung‘ und ‚Neubeginn‘ nach 1945 in Die Mörder sind unter uns (1946)
Die ‚Stunde Null‘ der deutschen Filmproduktion
Unabhängig davon, ob die Begriffsbildungen von der ‚Stunde Null‘ und dem ‚Untergang‘ zeitgenössische sind, wird man davon ausgehen dürfen, dass beide Metaphern Wahrnehmungen bezeichnen, die im Zeitraum zwischen Kriegsende und Gründung beider deutscher Staaten Aktualität besaßen. Wenn das so ist, dann wird unmittelbar einsichtig, vor welchen Schwierigkeiten die Kultur steht, wenn es darum geht, konsensfähige – was hier vor allem meint: erträgliche – Selbstbilder zu entwerfen, die in einer Phase ohne rechten Anknüpfungspunkt und ohne Perspektive eben dies doch zu geben vermögen: Orientierung über die Herkunft und Aussicht auf eine Zukunft.(Pabst 2012, S. 26)
Nach der Viermächte-Deklaration vom 5. Juni 1945 lag die Vollzugsgewalt in dem in vier Sektoren aufgeteilten Deutschland bei den jeweiligen Besatzungsmächten.2 Neben der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, der Inhaftierung der Verantwortlichen für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Entnazifizierung lag ein wesentlicher Schwerpunkt der Bemühungen um den Aufbau der Nachkriegsgesellschaft darauf, die ideologische Neuorientierung der deutschen Bevölkerung im Sinne einer „reeducation“ zu gewährleisten. Großes Augenmerk lag dabei auch auf der Produktion und Distribution entsprechender Kinofilme.(Ebd., S. 26)
Die Filmgesellschaft DEFA hat wichtige Aufgaben zu lösen. Die größte von ihnen ist der Kampf für den demokratischen Aufbau Deutschlands, das Ringen um die Erziehung des deutschen Volkes, insbesondere der Jugend, im Sinne der echten Demokratie und Humanität, um damit Achtung zu wecken für andere Völker und Länder. Der Film als Massenkunst muß eine scharfe und mächtige Waffe werden gegen die Reaktion und für die in der Tiefe wachsende Demokratie, gegen den Krieg und den Militarismus und für Frieden und Freundschaft aller Völker der ganzen Welt.(Film in der DDR – zit. n. ebd., S. 27)
Die semiotische Dimension: Filmischer Weltentwurf und narrative Prozesse
Die filmische Ausgangssituation
Berlin 1945. Susanne Wallner, eine junge Fotografin, kehrt aus dem Konzentrationslager zurück, doch ihre Wohnung ist besetzt. Hier lebt seit kurzem der aus dem Krieg heimgekommene Chirurg Mertens, der seine furchtbaren Erinnerungen mit übermäßigem Alkoholgenuss zu verdrängen sucht. Die beiden arrangieren sich, und mit Susannes Hilfe findet Dr. Mertens langsam wieder zu sich selbst. Da begegnet ihm sein ehemaliger Hauptmann Brückner, nun ein aalglatter Geschäftsmann, dem es egal ist, ob er aus Stahlhelmen Kochtöpfe macht oder umgekehrt. Mertens[’] Gewissen rebelliert, und am Weihnachtsabend 1945 will er Sühne fordern für ein von Brückner drei Jahre zuvor im Osten befohlenes Massaker an Frauen, Kindern und Männern.3
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Mauerschau – Die DDR als Film: Eine Einleitung
- 1 Frühgeschichte – Genese des ‚antifaschistischen Schutzwalls‘
- 2 Leben in der ‚entwickelten sozialistischen Gesellschaft‘
- 3 Nach der ‚Mauer‘, nach der ‚Wende‘