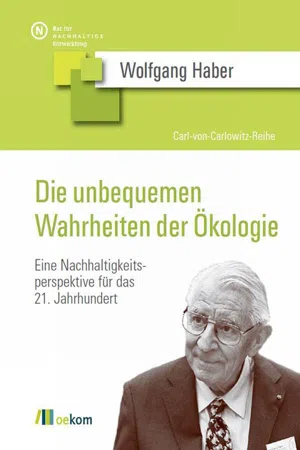
eBook - ePub
Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie
Eine Nachhaltigkeitsperspektive für das 21. Jahrhundert
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie
Eine Nachhaltigkeitsperspektive für das 21. Jahrhundert
Über dieses Buch
"Nachhaltigkeit kann nur gelingen, wenn wir die Ökologie nicht verklären." Diese Ansicht vertrat Wolfgang Haber in der ersten Carl-von-Carlowitz-Vorlesung. Der Doyen der wissenschaftlichen Ökologie erteilt mystifizierenden Bildern vom Wesen des Menschen und der Natur eine klare Absage: Der Weg in eine nachhaltige Zukunft könne nur gelingen, wenn wir uns auf die Wirklichkeit besinnen und unseren Blick auf die Schlüsselprobleme des 21. Jahrhunderts richten – auf die Endlichkeit der Ressourcen und das immense Bevölkerungswachstum. Dies als äußere Bedingung menschlichen Handelns zu begreifen und zu akzeptieren, ist Teil der human-ökologischen Perspektive, mit der Wolfgang Haber an die Einsichten von Carl von Carlowitz anknüpft.
Der Band ist Auftakt einer Vorlesungsreihe des Rates für Nachhaltige Entwicklung, in der herausragende Wissenschaftler(innen) verschiedener Fachrichtungen ihre Gedanken und Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung vortragen. Pate der Reihe ist Carl von Carlowitz; er lebte von 1645 bis 1714 in Sachsen – einem Gebiet, in dem drastischer Raubbau an Wäldern betrieben wurde. Carlowitz empfiehlt eine "nachhaltende Nutzung" des Holzes mit dem Ziel, die Ressourcenzerstörung zu beenden – und gilt seither als Vater des Nachhaltigkeitsbegriffs.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie von Wolfgang Haber im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Biological Sciences & Science General. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kapitel 1
Carl von Carlowitz – gestern und heute

Der Schöpfer des Begriffs »Nachhaltigkeit«
Die »Carl-von-Carlowitz-Vorlesungen«, die der Rat für Nachhaltige Entwicklung als Vortragsreihe geschaffen hat, sind der Erinnerung an den Oberberghauptmann des Königreichs Sachsen gewidmet. Er hat in seinem 1713 in Leipzig erschienenen Buch »Sylvicultura oeconomica« die zu seiner Zeit vorhandenen Vorstellungen einer vernünftigen, dauerhafte Erträge sichernden Forstwirtschaft zusammengefasst und dafür das Wort »nachhaltend« benutzt. Daher gilt Carlowitz als der Schöpfer des Begriffs »Nachhaltigkeit«, der sich als deutsche Wiedergabe des englischen Worts »sustainability« bzw. »sustainable development« eingebürgert hat – seit der gleichnamigen internationalen Konvention von 1992 das politische Leitbild der Zukunft.
Der Innentitel des 432-seitigen Buches (zuzüglich 22 Seiten Schlagwortverzeichnis) erläutert seine Überschrift ausführlich, unter anderem mit den Angaben: »Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, nebst gründlicher Darstellung, wie zuförderst durch Göttliches Benedeyen dem allenthalben und insgemein einreissenden Grossen Holtz-Mangel vermittelst Säe-, Pflanz- und Versetzung vielerhand Bäume zu prospiciren … Alles zu nothdürfftiger Versorgung des Hauß-, Bau-, Brau-, Berg- und Schmeltz-Wesens«.
Für Natur- und Klimaschützer weniger erfreulich ist ein eigenes, bereits auf dem Innentitel vermerktes Buchkapitel, in dem zur Nutzung und »nützlichen Verkohlung« des in den Mooren des Erzgebirges lagernden Torfes aufgerufen wird. Sehr überraschend ist sodann, dass das Wort »nachhaltend« im Text des Buches nur ein einziges Mal vorkommt, und zwar auf Seite 105 unten, wo Carlowitz »eine continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung« fordert. Dennoch ist das Werk, das 1732 in einer zweiten, ergänzten Auflage erschien, für die Entwicklung der Forst- und Holzwirtschaft im deutschsprachigen Raum maßgebend gewesen, denn damals war ein geregelter Waldbau noch weithin unbekannt.

Abbildung 1
Professor Wolfgang Haber mit einem Originalexemplar des
Buches »Sylvicultura oeconomica« von 1713.
Carlowitz empfiehlt darin die »nachhaltende Nutzung« der Ressource Holz
Carlowitz’ Motivation, Grundgedanken und Erfolg
Was aber hat Carlowitz als »sächsischer Bergbauminister« – so würde man ihn heute nennen – zu seinem Buch veranlasst? Der Bergbau hatte in Sachsen als einem an Eisen- und Edelmetallerzen reichen Land (am Fuß des Erzgebirges!) eine große wirtschaftliche Bedeutung, erst recht zu jener Zeit, als sich die Wirtschaft von den Folgen des 30-jährigen Krieges wieder erholte. Bergbau und Erzverarbeitung brauchten damals sehr viel Holz: Ein einziger Hochofen zur Eisenherstellung benötigte pro Arbeitstag über zwei Tonnen Holzkohle, pro Jahr also über 500 Tonnen, und das heißt Fällung von rund 20 Hektar Wald pro Jahr. Zusätzlich wurde noch Stammholz zur Abstützung der Grubengänge im Untertagebergbau benötigt. Auch wenn Europa von Natur ein Waldland ist, konnte ein solcher Holzbedarf nicht gedeckt werden. Viele Wälder waren zur Gewinnung von Acker- und Siedlungsland beseitigt worden, die verbleibenden durch mangelnde Kontrolle der Waldweide-, Brenn-, Werk- und Bauholznutzung oft degradiert – oder als herrschaftliche Jagdwälder jeder Nutzung entzogen. Vor allem gab es, von wenigen Ansätzen abgesehen, noch keinen geregelten Waldbau mit Verjüngung und Pflege. Diese Holzmangelsituation ließ nur zwei Auswege: einmal die Erhöhung der energetischen Effizienz der Erzverarbeitung – und tatsächlich konnte der Holzkohlenverbrauch je Einheit hergestellten Eisens bis ca. 1850 auf die Hälfte gesenkt werden; zum andern die Einführung eines geregelten, »nachhaltenden« Waldbaus. Dieser kann aber auch nur so viel Holz liefern, wie im biologischen Wachstumstempo der Bäume auf einer gegebenen, begrenzten Waldfläche pro Jahr verfügbar wird.
»Nachhaltigkeit« enthält also immer Begrenzungen, nämlich einen Nutzungsverzicht in der Gegenwart zur Sicherstellung der zukünftigen Nutzung der Ressource. Psychologisch erzeugt dies eher Abneigung; denn der politisch auf »Freiheit« ausgerichtete moderne Mensch schätzt Einschränkungen nicht. Dies erklärt, warum »nachhaltige Entwicklung«, ein Begriff, der nicht sogleich an Grenzen denken lässt, so schnell beliebt wurde; doch seine Umsetzung in die Lebenspraxis gelingt nicht ohne Begrenzungen.
Was aber hat Carlowitz letztlich erreicht? Sehr nüchtern und vereinfacht ausgedrückt, hat er die Nutzbarkeit der einen, erneuerbaren Ressource (Holz) erhalten und gesichert, um die andere, nicht erneuerbare Ressource (Erze) um so schneller abzubauen und zu nutzen. Der Erzbergbau in Sachsen hat in den heutigen Tagen kaum noch Bedeutung, weil keine den Abbau lohnenden Erze mehr vorhanden sind. Carlowitz’ Lösungsidee zur Nutzung von Wald und Holz hat sich im Übrigen noch im gleichen Jahrhundert auf andere Weise erledigt, als nämlich die Funktion von Holz und Holzkohle bei der Verhüttung durch einen »neuen« Brennstoff mit größerer Wirkung, nämlich Steinkohle, ersetzt wurde, also durch den »unterirdischen Wald« (wie ihn Rolf Peter Sieferle nennt), den man aber, wie wir heute erkennen, nicht nachhaltig machen kann. Doch bleibt Carlowitz’ richtungsweisende Idee ungeschmälert.
Kein Gegenstück in der Landwirtschaft
Es ist eigenartig, dass in dem anderen großen und lebenswichtigen Landnutzungsbereich, der Landwirtschaft, keine der forstlichen Nachhaltigkeit entsprechende Leitidee aufkam und nicht einmal von dieser in die Landwirtschaft übertragen wurde. Vielleicht liegt dies an der Flächenkonkurrenz von Land- und Forstwirtschaft, aber wohl auch an den grundsätzlichen Unterschieden zwischen dem langlebigen Wald, der sich auch selbst verjüngen kann, und den kurzlebigen Ackerkulturen, die jährlich durch »Kahlschlag« geerntet und dann künstlich immer neu begründet werden müssen. Aber auch in der Landwirtschaft gab es Persönlichkeiten, deren Bedeutung und Wirkung mit Carlowitz vergleichbar ist. Genannt seien Friedrich der Große mit Einführung der Kartoffel, Albrecht Thaer als Entdecker der Bedeutung des Humus, Thomas Malthus, der bereits auf die Diskrepanz zwischen Bevölkerungs- und agrarischem Produktionswachstum hinwies, oder Justus von Liebig, der die mineralische Ernährung und Düngung in die landwirtschaftliche Praxis einführte (und damit Malthus' Sorgen zunächst zerstreute).
Thaer hatte die Landwirtschaft immerhin als ein »Gewerbe« bezeichnet, »welches zum Zweck hat, durch Produktion … vegetabilischer und tierischer Substanzen Gewinn zu erzeugen oder Geld zu erwerben. Je höher dieser Gewinn nachhaltig ist, desto vollständiger wird dieser Zweck erfüllt. Die vollkommenste Landwirtschaft ist also die, welche den möglichst hohen, nachhaltigen Gewinn, nach Verhältnis des Vermögens, der Kräfte und der Umstände, aus dem Betriebe zieht.« (Hervorhebungen W.H.). Er bezog also das Wort »Nachhaltigkeit« nur auf den Gewinn, nicht aber auf das ganze Produktionssystem, das sich, wie uns erst jetzt klar wird, eher ins Gegenteil entwickelte.
Carlowitz in der Welt von heute
Würde Carlowitz, der 1714 starb, heute, nach 200 Jahren, ins Leben zurückkehren, er würde die Welt nicht wiedererkennen, so tief greifend hat sie sich verändert und eine Entwicklung durchlaufen, auf die sein Wort »nachhaltend« nicht passen würde. Aber er wäre über dessen Popularität bestimmt überrascht. Auf seine Fragen würden wir ihm erklären, wie diese Entwicklung durch Forschungen in Physik und Chemie, dann auch Biologie, und vor allem ihrer technischen Anwendungen – mithilfe der so reichlich verfügbaren fossilen Energieträger – gefördert und davon auch abhängig geworden ist. Damit wurden unbestreitbare wirtschaftliche, soziale, kulturelle und zivilisatorische Verbesserungen, zusammengefasst im Wort »Wohlstand«, erzielt. Doch schon seit über 100 Jahren zeigen sich wachsende Nachteile und Schäden dieses Fortschritts, sowie seine ungleiche Verteilung sowohl innerhalb einzelner Länder als auch weltweit.
Vielleicht hätte Carlowitz aber auch mit Interesse wahrgenommen, dass in dieser Wohlstandswelt neue naturwissenschaftliche Denkweisen aufgekommen sind, die diesen Fortschritt immer kritischer hinterfragen. Aus meiner Sicht bezeichne ich sie mit den zwei Worten »Evolution« und »Ökologie«, die als zwei grundsätzliche Merkmale des Phänomens »Leben« erkannt wurden. Ökologie war zunächst definiert als Beziehung von Lebewesen zu oder Abhängigkeit von ihrer »Außenwelt«, die sie jeweils als »Umwelt« umgibt. Evolution zeigte, dass das Phänomen Leben von winzigen Einzellern ausgehend immer mehr Vielfalt, Masse und Größe – vom Bakterium bis zum Tyrannosaurus oder Blauwal – erreichte. Es besteht in der Verknüpfung einer einheitlichen, sich selbst erhaltenden Grundstruktur (der Desoxiribonukleinsäure und Ribonukleinsäure, DNA/RNA) mit immer wieder neu daraus entstehenden und sich ändernden Organismen. Im Zusammenwirken von Evolution und Ökologie ist Leben als eine Organisationsform entstanden, die als »Biosphäre« den Planeten Erde sozusagen bekleidet, ihn zugleich als ihre Umwelt nutzt, sich ihm anpasst, ihn verändert, aber (bisher) auch in einem »lebenstauglichen« Zustand erhalten hat – und das seit über drei Milliarden Jahren. Gerade darin hätte Carlowitz das Wirken seines Nachhaltigkeitsprinzips erkennen können.
Die Ökonomie der Natur – Nachhaltigkeit der Entwicklung des Lebens
Es kommt darin zum Ausdruck, dass das Leben seine einziga...
Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Die Modernität der Bestandserhaltung von Günther Bachmann, RNE
- Kapitel 1: Carl von Carlowitz – gestern und heute
- Kapitel 2: Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie
- Kapitel 3: Nachhaltige Entwicklung unter humanökologischen Perspektiven
- Ausblick
- Bildquellen
- Über den Autor und den Herausgeber