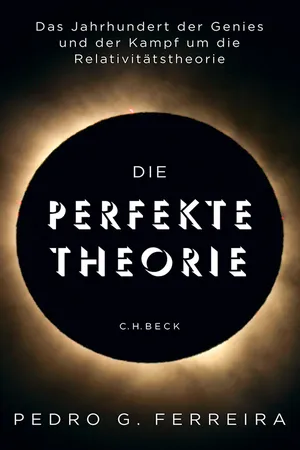![]()
Kapitel 1
Wenn sich eine Person im freien Fall befindet
Im Herbst 1907 arbeitete Albert Einstein unter großem Druck. Man hatte ihn gebeten, für das Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik eine maßgebliche Zusammenfassung seiner Relativitätstheorie zu erstellen – keine leichte Aufgabe, denn die Frist war kurz und Einstein konnte sich nur in seiner Freizeit damit beschäftigen. Von Montag bis Freitag arbeitete er von 8.00 bis 18.00 Uhr im Schweizer Patentamt in Bern, im neu erbauten Post- und Telegrafengebäude, wo er Konstruktionszeichnungen neuartiger elektrischer Gerätschaften auf ihre Tauglichkeit prüfte. Sein Vorgesetzter hatte ihm eingeschärft: «Wenn Sie ein Gesuch zur Hand nehmen, dann denken Sie, es sei alles falsch, was der Erfinder sagt»,[1] und er nahm sich diesen Rat zu Herzen. Den größten Teil des Tages verbannte er die Notizen und Berechnungen für seine eigenen Theorien und Entdeckungen in sein «Büro für theoretische Physik», wie er die zweite Schublade seines Schreibtischs nannte.
Einsteins Text war als Rekapitulation seiner triumphalen Vermählung der klassischen Mechanik von Galileo Galilei und Isaac Newton mit den neuen Lehren der Elektrizität und des Magnetismus von Michael Faraday und James Clerk Maxwell gedacht. Sein Ziel war, eine Reihe merkwürdiger Auswirkungen der Theorie zu erläutern, die ihm im Lauf der Jahre aufgefallen waren – wie Uhren, die langsamer gehen, wenn sie bewegt werden, oder Gegenstände, die bei hoher Geschwindigkeit schrumpfen. Darüber hinaus erklärte der Text die seltsame, magische Gleichung, der zufolge Masse und Energie austauschbar sind, sowie die Tatsache, dass sich nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Nach dieser Abhandlung sollte sich fast die gesamte Physik durch ein neues, allgemeines Regelwerk beherrschen lassen.
Im Jahr 1905 hatte Einstein innerhalb weniger Monate eine Reihe von Publikationen verfasst, die in kurzer Zeit die Physik veränderten. Teil dieses kreativen Ausbruchs war die Erkenntnis, dass sich Licht – ähnlich wie Materiepartikel – wie Energiebündel verhielt. Das chaotische Zittern von Pollen und Staubteilchen in einer Schale voll Wasser hatte er mit der heftigen Bewegung schwingender und aneinanderstoßender Wassermoleküle erklärt. Und er war ein Problem angegangen, das Physiker beinahe ein halbes Jahrhundert geplagt hatte: Warum verhielten sich die physikalischen Gesetze verschieden, je nachdem, wie man sie betrachtete? Mit dem Relativitätsprinzip hatte er sie miteinander in Einklang gebracht.
All diese erstaunlichen Entdeckungen hatte er gemacht, während er als technischer Experte dritter Klasse im Schweizer Patentamt in Bern wissenschaftliche und technische Neuerungen prüfte. Im Jahr 1907 hatte er den ersehnten Sprung in die akademische Karriere noch immer nicht geschafft, und für jemanden, der gerade wichtige Grundregeln der Physik umgeschrieben hatte, wirkte Einstein ziemlich mittelmäßig. Beim Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich war er allenfalls dadurch aufgefallen, dass er Vorlesungen, die ihn nicht interessierten, schwänzte und gelegentlich genau die Menschen gegen sich aufbrachte, die seine Begabung hätten fördern können. Ein Professor erklärte ihm: «Sie sind ein sehr gescheiter Junge, Einstein, ein ganz gescheiter Junge. Aber Sie haben einen großen Fehler: Sie lassen sich nichts sagen!»[2] Als sein Diplomvater die Betreuung eines selbst gewählten Themas verweigerte, lieferte Einstein eine lustlos zusammengeschriebene Arbeit ab, deren Note seine Aussicht auf eine Assistentenstelle am Polytechnikum oder an anderen Universitäten, bei denen er sich beworben hatte, zunichtemachte.
Vom Abschluss des Diploms 1900 bis zur Anstellung am Patentamt 1902 erlebte er beruflich eine Serie von Fehlschlägen. Zu allem Übel wurde seine 1901 an der Universität Zürich eingereichte Dissertation im folgenden Jahr abgelehnt. In dieser Arbeit hatte er sich zum Ziel gesetzt, einige von dem großen theoretischen Physiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts Ludwig Boltzmann vorgebrachte Gedanken zu widerlegen, aber Einsteins Bilderstürmerei wurde nicht gut aufgenommen. Erst im Jahr 1905 erlangte er mit seiner wegweisenden Arbeit über Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen den Doktorgrad. «Er [der Doktortitel] erleichtert den Verkehr mit den Menschen nicht unwesentlich nach meiner Erfahrung»,[3] wie ein neuerdings diplomatischer Einstein bemerkte.
Während sich Einstein weiterhin schwertat, kam sein Freund Marcel Grossman auf dem Weg zur Professorenwürde rasch voran. Er war zuverlässig, fleißig und bei seinen Lehrern beliebt und half Einstein mit seinen präzisen Vorlesungsmitschriften mehr als einmal aus der Patsche. Einstein, seine zukünftige Ehefrau Mileva Marić und Grossman schlossen beim gemeinsamen Studium in Zürich Freundschaft. Anders als Einstein machte Grossman anschließend rasch Karriere. Er wurde Hochschulassistent in Zürich und schloss 1902 seine Promotion ab. Nach einer kurzen Phase als Gymnasiallehrer wurde er Professor für darstellende Geometrie an der ETH. Einstein hatte nicht einmal eine Lehrerstelle bekommen. Erst durch Grossmans Vater, der ihn dem mit ihm befreundeten Leiter des Berner Patentamts empfahl, kam Einstein schließlich als Sachverständiger unter.
Die Anstellung im Patentamt war ein Segen. Nach Jahren der finanziellen Abhängigkeit vom Vater konnte er nun endlich Mileva heiraten und in Bern eine Familie gründen. Die monotone Arbeit im Patentamt mit ihren klar definierten Pflichten und wenigen Ablenkungsmöglichkeiten bot Einstein einen fast idealen Rahmen, um seinen Gedanken nachzugehen. Dazu hatte er genügend Zeit, denn die täglichen Pflichten ließen sich in wenigen Stunden erledigen. So saß er mit einigen Büchern und den Notizen aus dem «Büro für theoretische Physik» an seinem kleinen Schreibtisch und konstruierte Experimente im Kopf. In diesen Gedankenexperimenten stellte er sich Situationen und Apparaturen vor, mit denen sich physikalische Gesetze untersuchen ließen, um herauszufinden, was sie in der realen Welt wohl anstellen würden. Da er nicht über ein Labor verfügte, spielte er alles sorgfältig in Gedanken durch und inszenierte Vorgänge, die er dann wieder peinlich genau untersuchte. Seine mathematischen Kenntnisse reichten gerade aus, um die Ergebnisse zu Papier zu bringen, wobei präzise ausgearbeitete wissenschaftliche Kleinode entstanden, die der Physik eine neue Richtung geben sollten.
Im Patentamt war man mit seiner Arbeit zufrieden und beförderte ihn bald zum technischen Experten zweiter Klasse. Niemand ahnte etwas von seinem wachsenden Ruhm. Er arbeitete sich noch immer täglich durch sein Pensum an Patentanträgen, als der deutsche Physiker Johannes Stark ihm 1907 den Auftrag für einen Essay Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen erteilte. In zwei Monaten sollte die Arbeit vorliegen. Während dieser Zeit gelangte Einstein zu der Einsicht, dass sein Relativitätsprinzip noch unvollständig war. Er musste es noch einmal völlig überarbeiten, wenn es wirklich allgemein gültig sein sollte.
Der Aufsatz im Jahrbuch war als Zusammenfassung von Einsteins ursprünglichem Relativitätsprinzip gedacht. Diesem zufolge sollten die Gesetze der Physik in jedem Inertialsystem in gleicher Weise gelten. Die Grundidee dazu war nicht neu, sondern schon seit Jahrhunderten bekannt.
Die Gesetze der Physik und der Mechanik beschreiben, wie sich Dinge unter Einwirkung von Kräften bewegen, wie sie beschleunigt oder abgebremst werden. Im 17. Jahrhundert formulierte der englische Physiker und Mathematiker Isaac Newton hierzu eine Reihe von Gleichungen. Seine Bewegungsgesetze beschreiben, was geschieht, wenn zwei Billardkugeln zusammenstoßen, eine Kugel aus einem Gewehr abgefeuert oder ein Ball in die Luft geworfen wird.
Ein Inertialsystem ist ein Bezugssystem, das sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt. Wenn Sie dieses Buch an einem festen Ort lesen – einem gemütlichen Stuhl in Ihrem Arbeitszimmer beispielsweise oder am Tisch in einem Café –, dann befinden Sie sich in einem Inertialsystem. Ein anderes klassisches Beispiel ist ein gleichmäßig schnell fahrender Zug ohne Sicht nach draußen. Wenn Sie in einem solchen sitzen und er seine Reisegeschwindigkeit erreicht hat, lässt sich nicht mehr feststellen, ob Sie sich bewegen. Grundsätzlich sollte sich zwischen zwei Inertialsystemen nicht unterscheiden lassen, selbst wenn sich das eine mit hoher Geschwindigkeit bewegt und das andere stillsteht. Misst man in einem Inertialsystem die Kräfte, die auf einen Gegenstand wirken, dann sollte sich dasselbe Ergebnis ergeben wie in jedem anderen Inertialsystem. Die physikalischen Gesetze haben ihre Gültigkeit unabhängig vom Bezugssystem.
Im 19. Jahrhundert kam eine völlig neue Gruppe von Gleichungen hinzu, die zwei andere Naturkräfte zusammenbrachten – die Elektrizität und den Magnetismus. Zunächst erscheinen die beiden als völlig eigenständige Phänomene. Elektrizität kennen wir von der Beleuchtung zu Hause oder von den Blitzen am Himmel. Magnetismus dagegen lässt Magnete am Kühlschrank haften oder zieht die Kompassnadel nach Norden. Der schottische Physiker James Clerk Maxwell konnte jedoch zeigen, dass beide Kräfte als unterschiedliche Ausprägung einer einzigen Kraft – Elektromagnetismus – gesehen werden können. Wie sich diese Kraft darstellt, hängt davon ab, wie sich der Beobachter bewegt. Ein Mensch, der neben einem Stabmagneten sitzt, kann Magnetismus wahrnehmen, aber keine Elektrizität. Saust die Person aber mit hoher Geschwindigkeit vorbei, dann nimmt sie nicht nur Magnetismus, sondern auch ein bisschen Elektrizität wahr. Maxwell vereinte beide Naturkräfte zu einer einzigen, die unabhängig von der Position oder Geschwindigkeit des Beobachters denselben Wert annimmt.
Versucht man allerdings, Newtons Bewegungsgesetze und die maxwellschen Gleichungen für Elektromagnetismus zu kombinieren, dann ergeben sich Schwierigkeiten. Folgt die Welt tatsächlich beiden Gesetzen, dann müsste es prinzipiell möglich sein, aus Magneten, Drähten und Umlenkrollen eine Maschine zu bauen, die in einem Inertialsystem keine Kraft registriert, in einem anderen Inertialsystem hingegen wohl – ein klarer Verstoß gegen die Regel, dass Inertialsysteme nicht voneinander unterscheidbar sein sollten. Newtons Bewegungsgesetze und die maxwellschen Regeln sind also scheinbar nicht vereinbar. Einsteins Ziel war es, diese «Asymmetrien» in den physikalischen Gesetzen zu beheben.[4]
In den Jahren vor der Veröffentlichung von 1905 entwickelte Einstein das kurz gefasste Relativitätsprinzip mit Hilfe einer Reihe von Gedankenexperimenten, die dieses Problem lösen sollten. Er gelangte dabei zu zwei Postulaten. Das erste war im Grunde nur eine Neuformulierung des Prinzips, dass die Gesetze der Physik in jedem Inertialsystem dieselbe Form haben müssen. Das zweite Postulat war bereits radikaler: In jedem Inertialsystem hat die Lichtgeschwindigkeit denselben Betrag von 299 792 Kilometern pro Sekunde. Mit diesen Postulaten ließen sich Newtons Bewegungsgesetze so anpassen und mit den maxwellschen Gleichungen für Elektromagnetismus kombinieren, dass Inertialsysteme nicht mehr zu unterscheiden waren. Damit hatte Einsteins neues Relativitätsprinzip verblüffende Resultate erbracht.
Für das zweite Postulat mussten die newtonschen Gesetze etwas verändert werden. Im klassisch-newtonschen Universum gilt bei Geschwindigkeiten das Additionsprinzip. Das Licht, das ein fahrender Zug nach vorn ausstrahlt, bewegt sich schneller als das einer stationären Quelle. In Einsteins Universum ist das nicht mehr der Fall. Stattdessen gilt eine kosmische Geschwindigkeitsbeschränkung von 299 792 Kilometern pro Sekunde. Selbst die stärkste Rakete kann diese Schranke nicht durch brechen. Dies hat erstaunliche Auswirkungen. So wird jemand, der sich annähernd mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, langsamer altern, wenn er von jemandem beobachtet wird, der am Bahnsteig sitzt und den Zug vorüberfahren sieht. Und der fahrende Zug wird kürzer aussehen als der stehende. Die Zeit dehnt sich, der Raum zieht sich zusammen. Solche Effekte sind Anzeichen für etwas sehr Grundlegendes: In der Welt der Relativität sind Zeit und Raum miteinander verknüpft und wechselseitig austauschbar.
Es scheint, als habe Einstein die Physik mit seinem Relativitätsprinzip vereinfacht, allerdings mit kuriosen Auswirkungen. Als er sich im Herbst 1907 ans Schreiben machte, musste er sich jedoch eingestehen, dass seine Theorie zwar brauchbar war, aber nicht vollständig. So wie er sich die Relativitätstheorie vorstellte, passte Newtons Gravitationstheorie nicht hinein.
Vor Einstein war Isaac Newton in der Physik fast wie ein Gott verehrt worden. Sein Werk galt als höchste Ausprägung des menschlichen Geistes. Ende des 17. Jahrhunderts hatte er die auf sehr kleine wie auf sehr große Dinge wirkende Schwerkraft in einer einzigen einfachen Gleichung zusammengefasst. Damit ließ sich das Weltall genauso gut erklären wie Vorgänge im Alltagsleben.
Newtons Gesetz der allgemein wirkenden Schwerkraft oder das «(Quadrat-)Abstandsgesetz» könnte einfacher kaum sein. Es besagt, dass die Anziehungskraft zwischen zwei Objekten proportional zu der Masse jedes Objektes und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes ist. Wird also die Masse eines Objekts verdoppelt, so verdoppelt sich auch die Anziehungskraft. Verdoppelt sich dagegen der Abstand der beiden Objekte, dann beträgt die Anziehungskraft nur noch ein Viertel. Mehr als zwei Jahrhunderte lang lieferte Newtons Gesetz zuverlässig Erklärungen für unzählige physikalische Phänomene. Besonders spektakulär war neben der Beschreibung der Umlaufbahnen der bekannten Planeten insbesondere die Vorhersage neuer Himmelskörper.
Seit Ende des 18. Jahrhunderts war an der Umlaufbahn von Uranus eine seltsame Unwucht aufgefallen. Die Astronomen hatten immer mehr Beobachtungsdaten gesammelt und die Bahn des Planeten im Raum immer genauer bestimmt. Dabei war die Vorhersage von Uranus’ Umlaufbahn keineswegs leicht. Man ging zwar von Newtons Gravitationsgesetz aus, musste aber den Einfluss der anderen Planeten auf seine Bewegung berücksichtigen, hier und da Korrekturen anbringen, wobei der Orbit immer komplizierter wurde. Die Astronomen und Mathematiker veröffentlichten ihre Bahnberechnungen in Form von Tabellen, aus denen für bestimmte Tage und Jahre abzulesen war, wo am Himmel Uranus zu sehen sein musste. Verglichen sie ihre Vorhersagen mit tatsächlichen Himmelsbeobachtungen, dann blieb allerdings immer eine gewisse Abweichung, die sie nicht erklären konnten.
Der französische Astronom und Mathematiker Urbain Le Verrier besaß besonderes Geschick bei der Bestimmung und Berechnung der Umlaufbahnen der verschiedenen Planeten des Sonnensystems. Als er sich den Planeten Uranus vornahm, ging er aufgrund seiner Erfahrung mit anderen Planeten davon aus, dass Newtons Theorie vollkommen war. Wenn das der Fall war, dann musste da etwas anderes sein, das noch nicht berücksichtigt worden war. Und so wagte es Le Verrier, die Existenz eines bisher unbekannten Planeten vorherzusagen, für den er eine eigene astronomische Tabelle anfertigte. Zu seiner großen Freude richtete der deutsche Astronom Gottfried Galle sein Fernrohr auf die in Le Verriers Tabelle angegebene Stelle und entdeckte einen großen, unbekannten Planeten, der in seinem Gesichtsfeld schimmerte. In seinem Brief an Le Verrier schrieb er: «Monsieur, der Planet, dessen Position Sie bestimmt haben, existiert tatsächlich.»
Le Verrier war mit Newtons Theorie einen Schritt weiter gegangen und dafür belohnt worden, denn jahrzehntelang war Neptun nur als «Le Verriers Planet» bekannt. Marcel Proust erwähnte Le Verriers Entdeckung in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Beispiel für das Aufdecken von Korruption,[5] und Charles Dickens verdeutlichte an ihr in seiner Kurzgeschichte The Detective Police die Mühen der Kriminalarbeit.[6] Es war zweifellos eine besonders gelungene Nutzung der Regeln wissenschaftlicher Deduktion. Le Verrier sonnte sich in seinem Erfolg und wandte sich dann Merkur zu – auch dieser folgte offenbar einer merkwürdigen, unerwarteten Umlaufbahn.
Der newtonschen Schwerkraft zufolge kreist ein einzelner Planet in einem einfachen, geschlossenen und etwas verformten Kreis um die Sonne, in einer sogenannten Ellipse. Er kreist und kreist stets auf derselben Bahn und kommt der Sonne dabei abwechselnd näher und entfernt sich wieder. Der sonnennächste Punkt der Umlaufbahn – das Perihel – bleibt über die Zeit konstant. Manche Planeten, beispielsweise die Erde, haben fast kreisförmige Umlaufbahnen, und die Ellipse des Orbits ist kaum verformt. Andere Planeten, wie der Merkur, haben deutlich elliptischere Umlaufbahnen.
Obwohl Le Verrier den Einfluss aller anderen Planeten auf die Bahn des Merkur rechnerisch berücksichtigt hatte, hielt sie sich nicht an das newtonschen Gravitationsgesetz: Das Perihel wanderte um etwa 40 Bogensekunden pro Jahrhundert. (Eine Bogensekunde ist eine Einheit der Winkelmessung; der gesamte Himmelskreis misst etwa 1,3 Millionen Bogensekunden oder 360 Grad.) Diese als Präzession des Merkurperihels bekannte Anomalie konnte nicht mit Newtons klassischer Mechanik erklärt werden. Es musste noch etwas anderes im Spiel sein.
Wieder nahm Le Verrier an, dass Newton recht haben musste, und ging davon aus, dass es sehr nahe an der Sonne noch einen weiteren Planeten etwa von der Größe Merkurs geben musste: Vulcan. Dies war eine kühne, sehr unwahrscheinliche Mutmaßung, über die Le Verrier selbst sagte: «Wie könnte ein äußerst heller und immer in Sonnennähe befindlicher Planet während einer totalen Sonnenfinsternis übersehen worden sein?»[7]
Le Verriers Vermutung war das Startsignal zu einem Wettrennen um die Entdeckung des neuen Planeten Vulcan. In den folgenden Jahrzehnten gab es immer wieder Meldungen über in Sonnennähe gesichtete Objekte, aber keine Beobachtung erwies sich als stichhaltig. Die Suche nach Vulcan endete nicht mit Le Verriers Tod und die Präzession des Merkurperihels blieb den Astronomen im Gedächtnis. Statt eines unsichtbaren Planeten musste sich eine andere Erklärung für die Abweichung von 40 Bogensekunden finden lassen.
Bei den Gedanken, die sich Einstein 1907 über die Schwerkraft machte, ging es darum, Newtons Theorie mit seinem eigenen Relativitätsprinzip in Einklang zu bringen. Dass damit auch die Erklärung des Merkurorbits anstand, war zumindest ein Hintergedanke – was die Sache nicht einfacher machte.
Newtons Erklärung der Schwerkraft verstieß gegen beide Postulate von Einsteins Relativitätsprinzip. Zum einen ist die Wirkung der Schwerkraft nach Newton unmittelbar. Befinden sich zwei Objekte plötzlich nahe beieinander, dann wirkt die Anziehungskraft sofort zwischen ihnen – sie muss nicht erst von einem Objekt zum anderen wandern. Aber wie ist das möglich, wenn sich nach dem Relativitätsprinzip nichts, weder ein Signal noch eine Wirkung, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann? Ebenso bedeutsam wie irritierend war die Ta...