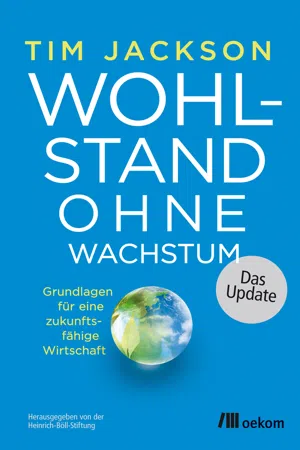
eBook - ePub
Wohlstand ohne Wachstum – das Update
Grundlagen für eine zukunftsfähige Wirtschaft
- 368 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Als Tim Jacksons Buch »Wohlstand ohne Wachstum« vor sieben Jahren erstmals erschien, avancierte es schnell zum Standardwerk. »Unsere gesamte Wirtschaftsordnung baut auf ewigem Wachstum auf – aber nun brauchen wir einen anderen Motor«, lautete die kurze wie brisante Diagnose des renommierten britischen Ökonomen – und daran hat sich nichts geändert. Die Notwendigkeit umzusteuern ist dringlicher denn je, und so kommt die komplett überarbeitete Neuauflage der »Bibel der Wachstumskritik« gerade zur rechten Zeit.
Das Buch bietet eine fundierte Analyse der Auswirkungen der Finanzkrisen, legt den Fokus auf die ganze Welt und schildert die Herausforderungen und Chancen einer Postwachstumsgesellschaft, welche die öko-logischen Grenzen unseres Planeten nicht überschreitet und trotzdem in Wohlstand lebt.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Wohlstand ohne Wachstum – das Update von Tim Jackson im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Die Grenzen des Wachstums
»Wer glaubt, exponentielles Wachstum könnte in einer endlichen Welt unendlich weitergehen, ist entweder ein Wahnsinniger oder Wirtschaftswissenschaftler.«
Kenneth Boulding, 19731
Wohlstand ist wichtig. Wohlstand bedeutet Erfolg und Wohlbefinden. Wohlstand bedeutet, dass es uns und den Menschen, die uns wichtig sind, gut geht. »Wie geht’s?«, fragen wir unsere Freunde und Bekannten. »Wie steht’s?« In solchen kleinen Alltagsgesprächen geht es um mehr als nur belanglose Grüße. Sie offenbaren ein wechselseitiges Interesse für das Wohlbefinden des anderen. Dass die Dinge gut laufen, ist ein allgemein menschliches Anliegen.
Was das für »Dinge« sind, die gut laufen sollen, wird im Einzelnen oft gar nicht erklärt. »Gut. Und wie geht es dir?« antworten wir instinktiv. Wir agieren nach einem bekannten Drehbuch. Wenn der andere nicht lockerlässt, reden wir vielleicht über unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Arbeit. Oft gibt man mit Erfolgen an. Gelegentlich gesteht man auch Enttäuschungen ein. Gegenüber Freunden, denen wir vertrauen, lassen wir uns vielleicht verführen, unsere Träume und Zukunftshoffnungen offen zu legen.
Selbstverständlich gehört zu dem Gefühl, dass die Dinge gut laufen, auch die Erwartung dazu, dass das ebenso für die Zukunft gilt. Man wird wohl kaum sein Leben mit Zufriedenheit betrachten, wenn man weiß, dass morgen alles in die Brüche geht. »Ja, es geht mir gut, danke. Morgen melde ich Konkurs an.« Das würde keinen Sinn machen. Die Zukunft ist enorm relevant. Wir machen uns natürlich Gedanken darüber, was die Zukunft bringen wird.
Der Wohlstand des Einzelnen wird aber auch, wie wir wissen, durch gesellschaftliche Missstände beeinträchtigt. Dass es mir persönlich noch gut geht, ist ein geringer Trost, wenn Familie, Freunde und Gesellschaft sich allesamt in ernsten Notlagen befinden. Mein eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen der Menschen um mich herum sind miteinander verwoben, manchmal sogar unauflöslich.
Zugespitzt formuliert lässt sich diese Sorge füreinander als eine Vision menschlichen Fortschritts verstehen. Wohlstand verspricht das Ausmerzen von Hunger und Obdachlosigkeit, das Ende von Armut und Ungerechtigkeit, die Hoffnung auf eine sichere und friedvolle Welt. Und diese Vision ist nicht nur aus altruistischen Gründen von Bedeutung; sie ist oft auch eine Bestätigung dafür, dass unser eigenes Leben einen Sinn hat.
Die Tatsache, dass gesellschaftlicher Fortschritt möglich ist, gibt uns das tröstliche Gefühl, dass alles immer besser wird – wenn nicht immer für uns selbst, dann doch wenigstens für die, die nach uns kommen. Eine bessere Gesellschaft für unsere Kinder. Eine gerechtere Welt. Eine Welt, in der auch die weniger vom Glück Begünstigten eines Tages aufblühen können. Wenn ich nicht an eine solche Perspektive glauben kann, woran soll ich dann glauben? Welchen Sinn kann ich dann in meinem Leben erkennen?2 In diesem Sinne ist Wohlstand eine Vision, die wir alle gemeinsam haben. Sie spiegelt sich in unseren täglichen Ritualen. Entsprechende Überlegungen beeinflussen auch die Welt der Politik und Gesellschaft. Die Hoffnung auf einen Wohlstand dieser Art liegt im Zentrum unseres Lebens.
So weit so gut. Wie aber kann Wohlstand erreicht werden? Wenn es keine gangbare Möglichkeit gibt, Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen, dann bleibt Wohlstand eine Illusion. Worauf es ankommt, sind überzeugende, belastbare Mechanismen, mit denen sich Wohlstand herstellen lässt. Und dabei geht es aber um mehr als eine reine Mechanik des Wohlergehens. Dass die Mittel, mit denen wir unser gutes Leben gestalten, vertretbar sind, ist Teil des Kitts, der die Gesellschaft zusammenhält. Geht die Hoffnung verloren, erlischt auch jede Art von Gemeinschaftsgefühl. Gute Sitten geraten in Gefahr. Hier den richtigen Mechanismus zu finden, ist essenziell.
Es gehört zu den wesentlichen Aussagen des Buches, dass wir bislang bei dieser Aufgabe scheitern. Unsere Technologien, unsere Wirtschaftsform und unsere sozialen Ziele sind allesamt schlecht auf eine sinnvolle Ausformung von Wohlstand abgestimmt.
Die Vorstellung von gesellschaftlichem Fortschritt, die uns antreibt – basierend auf der ständigen Ausweitung materieller Bedürfnisse – lässt sich ganz grundsätzlich nicht halten. Und das Scheitern bedeutet nicht nur, dass es uns nicht gelingt, unsere Utopien zu verwirklichen. Es geht viel tiefer: Während wir es uns heute gut gehen lassen, untergraben wir systematisch die Grundlage für das Wohlergehen morgen. Während wir uns um unser eigenes Wohlergehen kümmern, gefährden wir die Chancen für andere. Wir laufen tatsächlich Gefahr, jegliche Hoffnung auf dauerhaften Wohlstand für alle zu verspielen.
Dieses Buch soll aber keineswegs als Tirade wider das Versagen der Moderne verstanden werden. Und genauso wenig als Klage über die Hinfälligkeit der conditio humana. Zweifellos gibt es einige Rahmenbedingungen, die der Aussicht auf dauerhaften Wohlstand im Wege stehen. Dazu könnten die Existenz ökologischer Grenzen und die Einschränkungen in Bezug auf Ressourcen gehören, vielleicht auch bestimmte Aspekte der menschlichen Natur. Es ist ein zentrales Anliegen der vorliegenden Untersuchung, Bedingungen dieser Art Rechnung zu tragen.
Vorrangiges Ziel des Buches ist es, brauchbare Auswege aus der größten Zwickmühle unserer Zeit zu finden: wie wir nämlich die Hoffnung auf ein gutes Leben mit den Grenzen und Zwängen eines endlichen Planeten in Einklang bringen können. Die folgende Analyse konzentriert sich vor allem darauf, eine glaubwürdige Vorstellung davon zu entwickeln, was ein gutes Leben für die menschliche Gesellschaft in diesem Kontext bedeutet; und die Dimensionen einer belastbaren Wirtschaftswissenschaft zu etablieren, die sich diesem Ziel verschrieben hat.
Wohlstand als Wachstum
Im Mittelpunkt dieses Buches steht eine sehr einfache Frage: Wie kann Wohlstand in einer endlichen Welt aussehen, deren Ressourcen begrenzt sind und deren Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte voraussichtlich zehn Milliarden Menschen überschreiten wird?3 Haben wir eine angemessene Vorstellung von Wohlstand für eine solche Welt entwickelt? Ist diese Vorstellung glaubwürdig angesichts dessen, was wir bisher schon über ökologische Grenzen wissen? Was können wir tun, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen?
Die übliche Antwort auf diese Fragen besteht darin, Wohlstand in ökonomischen Begriffen zu definieren und ständig steigende Einkommen zu fordern, damit dieser Wohlstand erreicht wird. Höhere Einkommen bedeuten wachsende Möglichkeiten, reicheres Leben, eine verbesserte Lebensqualität für diejenigen, die davon profitieren. So jedenfalls hört man das überall.
Diese Formel setzt Wohlstand (fast buchstäblich) in eine Steigerung dessen um, was Ökonomen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf nennen, also das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Person. Vereinfacht gesagt ist das BIP ein Maß für die gesamte »Wirtschaftstätigkeit« einer Volkswirtschaft; oder genauer, des Geldwerts der Güter und Dienstleistungen, die innerhalb einer bestimmten Nation oder Region produziert und konsumiert werden. Wirtschaftliches Wachstum findet dann statt, wenn das BIP im gesamten Wirtschaftsbereich steigt – normalerweise mit einer bestimmten »Wachstumsrate«.4
Man sollte anmerken, dass ein steigendes BIP nur dann zu steigendem Einkommen (also BIP pro Kopf) führen wird, wenn die Wirtschaft stärker als die Bevölkerung wächst. Wenn die Bevölkerung expandiert, jedoch das BIP konstant bleibt, wird das Einkommensniveau sinken. Umgekehrt werden die Einkommen, wenn das BIP steigt, aber die Bevölkerung gleich bleibt (oder sinkt), noch schneller steigen. Generell muss das BIP mindestens so schnell wie die Bevölkerung steigen, um nur das Durchschnittsniveau der Haushaltseinkommen zu halten.
Wie wir später sehen werden, gibt es gute Gründe, zu hinterfragen, ob ein solch grober Maßstab wie das BIP pro Kopf tatsächlich ausreicht, um wirklichen Wohlstand widerzuspiegeln. Zunächst einmal bildet es aber ganz gut ab, was man normalerweise darunter versteht. Grob gesagt betrachtet man steigenden Wohlstand als mehr oder weniger gleichbedeutend mit steigenden Einkommen, die nach üblichen Vorstellungen durch anhaltendes Wirtschaftswachstum erreicht werden.
Dies ist natürlich einer der Gründe, warum fast das ganze letzte Jahrhundert über Wirtschaftswachstum das mit Abstand wichtigste politische Ziel war, und zwar auf der ganzen Welt. Und für die ärmsten Nationen der Welt ist dieses Rezept natürlich nach wie vor sehr attraktiv. Will man das Thema Wohlstand wirklich sinnvoll angehen, muss man auf jeden Fall die Not der weltweit mehr als drei Milliarden Menschen berücksichtigen, die immer noch von weniger als fünf Dollar am Tag leben.5
Greift aber dieselbe Logik auch bei den reicheren Nationen, dort, wo die Grundbedürfnisse im Wesentlichen gedeckt sind und der Überfluss der Konsumgüter den materiellen Wohlstand kaum noch steigert und möglicherweise sogar das gesellschaftliche Wohlergehen beeinträchtigt? Wie kommt es, dass wir, obwohl wir schon so viel haben, immer noch hungrig sind nach mehr? Wäre es nicht vielleicht besser, in den entwickelten Volkswirtschaften das rücksichtslose Wachstumsstreben zu stoppen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, die verfügbaren Ressourcen gerechter zu verteilen?
Sind in einer Welt mit endlichen Ressourcen und engen ökologischen Grenzen, in einer Welt, die immer noch gekennzeichnet ist durch »Inseln des Wohlstands« inmitten von »Ozeanen der Armut«6, für die bereits reichen Länder stetig steigende Einnahmen wirklich nach wie vor legitime Ziele aller Hoffnungen und Erwartungen? Oder gibt es nicht vielleicht einen anderen Weg hin zu einer nachhaltigeren, gerechteren Form des Wohlstands?
Auf diese Frage werden wir immer wieder zurückkommen und sie dabei aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Es soll aber hier schon in aller Deutlichkeit festgestellt werden, wie das auch Bouldings Bemerkung zu Beginn des Kapitels andeutet, dass für die meisten Ökonomen schon allein die Vorstellung von Wohlstand ohne Wachstum ein rotes Tuch ist. Wachstum des BIP gilt als derart selbstverständlich, dass Unmengen von Papier vollgeschrieben worden ist über die Frage, worauf dieses Wachstum beruht, wer es am besten befördert und was zu tun ist, sollte es nicht mehr erfolgen.
Sehr viel weniger wurde darüber geschrieben, warum wir es überhaupt brauchen. Aber das unablässige Streben nach mehr, das hinter den traditionellen Vorstellungen von Wohlstand steckt, besitzt durchaus so etwas wie einen intellektuellen Unterbau.
Zusammengefasst geht die Argumentation etwa folgendermaßen: Das BIP beziffert den wirtschaftlichen Wert der auf dem Markt gehandelten Güter und Dienstleistungen. Wenn wir nun immer mehr Geld für immer mehr Waren ausgeben, dann deshalb, weil wir ihnen Wert beimessen. Wir würden ihnen keinen Wert beimessen, würden sie nicht gleichzeitig unsere Lebensqualität verbessern. Deshalb kann es gar nicht anders sein, als dass eine stetige Zunahme des Pro-Kopf-BIP die Lebensqualität verbessert und den Wohlstand steigert.
Diese Schlussfolgerung ist genau deshalb verkehrt, weil Wohlstand nicht von vornherein gleichbedeutend ist mit Einkommen und Reichtum. Steigender Wohlstand ist nicht automatisch das Gleiche wie wirtschaftliches Wachstum. Mehr muss nicht immer besser sein. Aber zumindest findet sich hier eine Erklärung dafür, warum wir derart hartnäckig an der »Kleinen großen Zahl« festhalten: dem BIP.7
Es klingt vielleicht seltsam, aber der Begriff Wohlstand (prosperity) wird noch gar nicht so lang primär über Geld definiert. In seiner ursprünglichen Bedeutung hatte er mehr damit zu tun, dass sich das Leben gut entwickelte: in Übereinstimmung mit (lateinisch pro-) den Hoffnungen und Erwartungen (speres). Wohlstand bedeutete ganz einfach das Gegenteil von Not oder Elend.8 Die Gleichsetzung von steigendem Wohlstand mit Wirtschaftswachstum ist ein Kurzschluss und eine vergleichsweise moderne Deutung, eine Deutung, die mittlerweile heftig unter Beschuss geraten ist.
Einer der Vorwürfe gegen das Wachstum lautet, dass es seine Wohltaten im besten Falle ungleich verteilt. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung verdient weniger als sieben Prozent des Gesamteinkommens. Das eine Prozent an der Spitze verdient dagegen etwa 20 Prozent des Welteinkommens und besitzt fast die Hälfte des globalen Reichtums. Riesige Ungleichheiten – eine reale Wohlstandsdifferenz, ganz gleich, welche Maßstäbe man anlegt – charakterisieren den Unterschied zwischen Arm und Reich. Ein solches Missverhältnis ist furchtbar, schon aus ganz grundsätzlich humanitärer Sicht. Es produziert überdies wachsende soziale Spannungen: reales Elend in den am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, die sich auf die Gesellschaft als Ganzes negativ auswirken.9
Merkwürdigerweise scheint dieses Missverhältnis sich immer mehr zu verschärfen. Nach dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist die Ungleichheit bei den Einkommen heute größer als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Im Lauf von weniger als einem halben Jahrhundert hat das reichste eine Prozent der Bevölkerung seinen Teil am Einkommen mehr als verdoppelt. In den Entwicklungsländern wuchs die Einkommensungleichheit in den letzten zwei Jahrzehnten um elf Prozent. Selbst innerhalb der hochentwickelten Volkswirtschaften ist die Ungleichheit um neun Prozent höher als noch vor 20 Jahren.10
Während die Reichen immer reicher wurden, stagnierten die Realeinkommen der Mittelschicht in den westlichen Ländern bereits lange vor der Finanzkrise. Es ist auch durchaus schon die These vertreten worden, dass steigende Ungleichheit einer der Gründe für die Krise gewesen sei. Wachstum hat den Lebensstandard der besonders Bedürftigen keineswegs gehoben, ganz im Gegenteil; es hat in den letzten fünf Jahrzehnten einen großen Teil der Weltbevölkerung seinem Schicksal überlassen. Vor allem in den letzten Jahren ist der Reichtum zu den wenigen Glücklichen hinaufgesickert.11
Fairness (beziehungsweise das Fehlen von Fairness) ist nur einer der Gründe, warum man die herkömmliche Wohlstandsdefinition hinterfragen sollte. Ein anderer ist, dass – zumindest ab einem bestimmten Punkt – das ständige Streben nach wirtschaftlichem Wachstum das Glück der Menschen nicht mehr steigern kann und vielleicht sogar beeinträchtigt. So paradox diese Behauptung auch scheinen mag, so kann sie sich doch auf eine lange Ideengeschichte in Philosophie, Religion, Literatur und Kunst berufen. Und im letzten Jahrzehnt hat sie eine überraschende politische Wiedergeburt erlebt.
Selbst vor der Finanzkrise, als es noch so aussah, als trage uns die Wirtschaft alle zusammen in eine immer lichtere Zukunft, gab es verstörende Hinweise auf eine wachsende »soziale Rezession« in den hochentwickelten Volkswirtschaften. Eine neue Politik des Glücks oder Wohlbefindens begann konventionelle Ansichten von gesellschaftlichem Fortschritt in Frage zu stellen, in armen wie in re...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Liste der Abbildungen
- Dank
- Vorwort der Herausgeber
- Geleitwort zur Neuauflage
- 1 Die Grenzen des Wachstums
- 2 Der verlorene Wohlstand
- 3 Wohlstand neu definieren
- 4 Das Wachstumsdilemma
- 5 Der Mythos Entkopplung
- 6 Das »stahlharte Gehäuse« des Konsumismus
- 7 Gedeihen – in Grenzen
- 8 Grundlagen für die Wirtschaft von morgen
- 9 Auf dem Weg zu einer »Postwachstums«-Makroökonomie
- 10 Der progressive Staat
- 11 Bleibender Wohlstand
- Anmerkungen
- Literatur