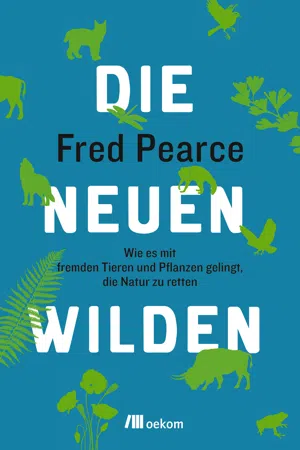
eBook - ePub
Die neuen Wilden
Wie es mit fremden Tieren und Pflanzen gelingt, die Natur zu retten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Lange Zeit war Fred Pearces Meinung zu invasiven, gebietsfremden Arten eindeutig: Bärenklau, Waschbär und Co. gehören nicht nach Mitteleuropa und bedrohen unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt. Doch was, wenn unsere traditionelle Sicht auf die Natur falsch ist? Was, wenn echter Naturschutz gerade darin besteht, die Eindringlinge willkommen zu heißen?
Sein aktuelles Buch ist eine scharfe Kritik an einem rückwärtsgewandten Naturschutz, der invasive Arten zu Sündenböcken stempelt. Denn gerade in Zeiten des Klimawandels brauchen wir widerstandsfähige Arten, die unsere Natur bereichern und heilen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die neuen Wilden von Fred Pearce im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Wissenschaftliche Forschung & Methodik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
TEIL I
Die Hoheitsgebiete
der Fremden
Weltweit haben sich fremde Arten aufgemacht, nicht selten mit unserer Hilfe. Doch meistens dringen sie nur in Gebiete ein, die vom Menschen übernutzt wurden. Oft helfen sie dabei, diese Schäden wieder zu reparieren.
Kapitel 1
Der grüne Berg
Am Gipfel des erloschenen Vulkans auf der tropischen Insel Ascension im Südatlantik kommt man sich vor wie am Ende der Welt. Als ich sah, wie das britische Militärflugzeug, das mich hier irgendwo in der Mitte zwischen Brasilien und Afrika abgesetzt hatte, zurück nach Süden zu den Falkland-Inseln flog, fühlte ich mich ziemlich einsam. Unter mir in der glühenden Sonne erstreckte sich eine raue schwarze Mondlandschaft aus vulkanischer Brockenlava, und dahinter in alle Himmelsrichtungen gute tausend Kilometer Ozean. Hier oben in der kühleren Bergluft umgab mich allerdings üppiges Grün. Gegen Mittag bildete sich über der Kuppe eine einsame Wolke, die sich plötzlich absenkte und mich und den Gipfel in Nebel hüllte.
Die Bewohner der Insel – britische Vertragsarbeiter, amerikanisches Dienstpersonal und Familien von St. Helena, einer weiteren abgeschiedenen Insel – nennen diese Oase Green Mountain, den grünen Berg. Hier oben steht das Haus des britischen Inselverwalters, gemeinsam mit den dazugehörigen zwei alten, auf das Meer gerichteten Kanonen. Doch abgesehen von seinem Rasen, auf dem ich später am Nachmittag meinen Tee trank, wirkten der Berg und die Wolke auf mich irgendwie urzeitlich: Diese Szenerie mussten auch schon die ersten Seeleute vorgefunden haben, als sie vor fünf Jahrhunderten auf die Insel kamen.
Ich hätte mich jedoch kaum mehr täuschen können, denn alles, was hier wuchs, war weit jüngeren Datums. Als Charles Darwin während seiner langen Reise auf der Beagle 1836 auf Ascension Halt machte, klagte er über ihre »nackte Abscheulichkeit«. Der Berg war »bar aller Bäume«. Henry Webster, ein anderer Gast jener Tage, nannte die Insel »eine grässliche Wüstenei inmitten der Einsamkeit eines Weltmeeres«. Im Nebel auf dem Berg erklärte mir mein freundlicher Führer Stedson Strout, der Waldaufseher: »Von dem, was Sie sehen, ist nichts hier heimisch. Abgesehen von ein paar Farnen wurde alles in den letzten 200 Jahren auf die Insel gebracht.« Der Nebelwald auf dem Green Mountain ist ein komplett von Menschen geschaffenes Ökosystem, ein Mischmasch fremder Arten, die zu Beginn und in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf Geheiß viktorianischer Botaniker eingeführt wurden. Jedes vorbeifahrende Schiff hatte für die dort stationierten Soldaten neue Bäume dabei.
Auf unserem Anstieg hatte ich Bermuda-Wacholder, Steineiben aus Südafrika, Persischen Flieder, Guaven aus Brasilien, ein Geflecht chinesischen Ingwers, neuseeländischen Flachs, Taro aus Madeira, europäische Brombeeren, japanische Kirschbäume und australische Schraubenpalmen gesehen, die hier höher wuchsen als auf ihren heimischen Inseln im Pazifik. Der Gipfel selbst war von einem unwahrscheinlichen Dickicht aus Bambus bedeckt, und der scharfe Passatwind, der sich plötzlich erhob und den Nebel vertrieb, erzeugte darin Töne wie ein Windspiel.
Ich war nach Ascension gekommmen, weil dieser Wald im Zentrum einer heftigen Kontroverse stand. Er ist mehr als ein Flecken Land mit Bäumen, auch mehr als ein botanischer Garten. Wie in keinem anderen tropischen Gehölz finden sich in ihm Vertreter von Arten aus der ganzen Welt, und es heißt, er sei der einzige, der gänzlich von Menschen geschaffen wurde. Wissenschaftler, die ihn kennen, loben das funktionierende Ökosystem dieser vor gerade etwas mehr als einem Jahrhundert willkürlich von der ganzen Erde zusammengetragenen Sammlung. Vegetation, Insekten und andere Spezies interagieren auf unterschiedlichstem Wege und leisten sich gegenseitig lebenserhaltende Dienste. Dabei ging man davon aus, dass das Ökosystem eines Waldes nicht auf diese Weise entstehen kann. Nach Ansicht der konventionellen Ökologie entwickelt sich eine derart komplexe Interaktion nur im Zuge der langfristigen Evolution der Arten. In einem gemeinsam mit David Catling von der University of Washington verfassten Artikel schildert Stroud jedoch, die Spezies von Green Mountain »haben sich nicht an die gängige Theorie gehalten, dass Komplexität allein infolge von Koevolution enstehen kann!«1
Stroud war vor zehn Jahren von St. Helena als Naturschutzbeauftragter auf die Insel gekommen. Er gibt zu, dass er in dieser Funktion eigentlich alle fremden Bäume roden müsste, um für die heimischen Platz zu schaffen. Dann würde jedoch kaum etwas übrig bleiben. So aber betreue er mit dem Green Hill etwas ungeheuer Interessantes. Dieser bunt zusammengewürfelte Nebelwald sei ein Paradebeispiel, auf das Ökologen gern zurückgreifen, wenn sie, was immer häufiger vorkommt, ihre Paradigmen zur Funktion von Ökosystemen neu bewerten. Denn er zeigt, dass Spezies, die bislang noch keinen Kontakt zueinander gehabt hatten, weit besser miteinander auskommen können als vermutet. Deshalb sind vielleicht auch viele weitere Wälder und andere komplexe Ökosysteme eher Resultat zufälligen Aufeinandertreffens als der Koevolution. Sollte sich dies bestätigen, ergäben sich daraus einige entscheidende Erkenntnisse für die Regeneration der Natur im 21. Jahrhundert.
Die Insel Ascension, die sich vor einer Million Jahren aus dem Boden des Atlantiks erhob, ist knapp doppelt so groß wie Manhattan. Sie blieb jedoch nicht lange eine Einöde. Trotz der Abgeschiedenheit fanden bald Lebewesen den Weg auf das Eiland. Millionen von Seevögeln okkupierten die Ebene, sodass sich das zusammengeschobene schwarze Lavagestein unter ihren Exkrementen weiß färbte. Grüne Meeresschildkröten schwammen Tausende von Kilometern, um auf dem Sandstrand ihre Eier abzulegen. Und die rätselhaften Landkrebse von Ascension kamen von Gott weiß woher – um an den Hängen des Vulkans ihr Leben zu verbringen. Doch abgesehen von einigen Farnen und Moosen auf dem Berg und einem sich wild ausbreitenden Gebüsch namens Ascension-Wolfsmilch an der Küste, blieb die schwarze Wüste für lange Zeit fast völlig pflanzenlos.
Die ersten menschlichen Besucher, von denen wir wissen, waren portugiesische Seefahrer, die auf dem Weg zum indischen Ozean am Himmelfahrtstag des Jahres 1503 hier vor Anker gingen. Von dem portugiesischen ascension für Himmelfahrt hat die Insel denn auch ihren Namen. Richtig besiedelt wurde sie von Angehörigen der britischen Royal Navy, die hier 1815 Soldaten stationierte, um eine Befreiung des berühmtesten internationalen Gefangenen jener Tage zu verhindern – Napoleon Bonaparte. Die Briten hatten den einstigen französischen Kaiser festgenommen und hielten ihn auf St. Helena fest, einem 1 300 Kilometer weiter südlich gelegenen Vorläufer Guantánamos. Nach Napoleons Tod war die Insel für die Briten Ausgangspunkt für die Verfolgung transatlantischer Sklavenschiffe und man lagerte auf ihr Treibstoff für Kriegsschiffe auf dem Weg nach Indien, dem Kronjuwel im britischen Empire.
Auch in den darauffolgenden Jahren ließ sich Ascension hervorragend nutzen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es zu einem Knotenpunkt des transatlantischen Fernmeldewesens, also der Kabelverbindungen zwischen Europa, Südafrika, Brasilien und Argentinien. Und heute ist es übersät mit Antennen, die bei der Kontrolle des Satellitenverkehrs im Weltall, für den Kontakt mit nuklearen U-Booten und für das Anzapfen der kabel- und satellitengestützten Kommunikation eingesetzt werden.
Die britischen Government Communications Headquarters, eine staatliche Behörde des Nachrichten- und Sicherheitsdiensts, mit ihren elektronischen Abhöranlagen ist heute der größte Arbeitgeber der Insel. Ihre jetzige Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 800, und es heißt, es gebe auf Ascension mehr Antennen als Menschen. Außerdem verfügt es über eine der längsten Start- und Landebahnen der Welt, erbaut von der US Airforce während des Zweiten Weltkriegs, um ihren Maschinen auf dem Weg nach Afrika einen bequemen Zwischenstopp zu ermöglichen. Als ich im Juli 2013 eintraf, sah ich zu meiner Verwunderung neun riesige US-Militärflugzeuge auf der Piste stehen, allesamt schwer beschäftigt, Präsident Obama auf seiner Europareise zu beschützen.2
Das Kommen und Gehen der Menschen war zwangsläufig von einem gezielten, aber auch von einem unbeabsichtigten Import fremder Arten begleitet. Zu den jüngsten Neuankömmlingen gehören sich rasch ausbreitende Tabakpflanzen und der Mexikanische Dorn oder Mesquite, den die BBC in den 1960er-Jahren hierher brachte, um in einer Siedlung für die Angestellten ihrer Sendestation für Afrika die Gärten etwas aufzulockern. Vieles wurde gezielt eingeführt, zunächst von der Marinegarnison, die sich auf diesem abgelegenen Außenposten so weit wie möglich aus eigenen Kräften versorgen wollte. Dokumente in den Archiven des Verwaltungszentrums Georgetown zeigen, wie man auf den wenigen Flecken urbaren Bodens am Berghang erstmals begann, Landwirtschaft zu betreiben. Auf der Farm wuchsen Obstbäume wie Guaven aus Brasilien, Andenbeeren aus Südafrika, Bananen aus dem Fernen Osten und Lychees aus China. Außerdem gab es Gemüse, also Kohl, Spinat und Kartoffeln, sowie etwas Getreide, eine Schweineherde aus Südafrika und Rinder und Schafe aus England.
Die Farm wurde bis in die 1990er-Jahre bewirtschaftet, ist inzwischen aber überwuchert. Heute, im 21. Jahrhundert, interessieren uns vor allem die Bäume. Die Briten pflanzten auf dieser vulkanischen Erhebung Ableger aus ihrem gesamten weltweiten Empire. In den frühen Tagen bauten Seeleute aus Neuseeland hier Flachs für ihre Schiffstaue an, ebenso wie die Norfolk Pine, deren gerader Stamm für die Masten verwendet wurde. Der britische Botaniker Sir Joseph Hooker – ein Freund Darwins und später Leiter der berühmten Royal Botanic Gardens Kew in London – besuchte die Insel 1843 und hatte die Idee, mit der Pflanzung von Bäumen den erloschenen Vulkan zu umfassen und die karge Landschaft zu begrünen. In den Archiven befindet sich ein 1847 geschriebener Brief Hookers mit einer Liste einzuführender Pflanzen, die für eine »alsbaldige Steigerung der Regenfälle« sorgen sollten, da die neue Vegetation auf dem Berggipfel den vorbeiziehenden Wolken Feuchtigkeit absaugen werde. Weiter unten am Hang würden Bäume und Büsche die Bodenbildung begünstigen. Hookers Ziel war letztlich eine komplette Neugestaltung der Insel – was Stroud und Catlin »Terraforming« nennen.
1845 brachte ein Frachter aus Argentinien die erste Lieferung von Setzlingen. Im Jahr 1858 trafen aus den südafrikanischen Cape Botanic Gardens mehr als 200 verschiedene Spezies von Pflanzen ein, und 1874 schickten die Kew Gardens 700 Tüten mit Samen, darunter zwei Arten, die sich unter den Bedingungen auf der Insel besonders wohl fühlten: Bambus und Feigenkaktus. Die Seeleute machten sich an die Arbeit und pflanzten innerhalb eines Jahres mehrere Tausend Bäume. Schon bald grünte und blühte es auf der einstmals nackten Bergkuppe, sodass man sie schließlich »Green Mountain« nannte. Ein Admiralsbericht des Jahres 1865 lobte den neu entstandenen Nebelwald, die Insel besäße »ein Dickicht aus mehr als 40 Arten von Bäumen neben zahlreichen Sträuchern. Durch die Ausbreitung der Vegetation verfügen wir nunmehr über eine ausgezeichnete Wasserversorgung, und der Garnison und den uns besuchenden Schiffen steht eine reiche Auswahl von Gemüse zur Verfügung.«
Heute finden sich auf der Insel laut David Wilkinson, einem vielseitigen Botaniker von der John Moore Unversity in Liverpool und einem der seltenen Gäste, die den Green Mountain zu Forschungszwecken besuchten‚ – mehr als 300 fremde Arten, von denen sich viele weiter ausbreiten. Von etwa 600 Metern aufwärts hat der Berg eine durchgängige Pflanzendecke. Auf unserem Rückweg machte mich Stroud auf Kaffeepflanzen aufmerksam, auf Wein, Chilenische Araukarien, Jacaranda, Wacholder, Bananenstauden, Buddleia Palmen, Fledermausblumen, die hübschen rosa Blüten der aus Madagaskar stammenden Catharanthen und amerikanische Gelbe Trompetenblumen. Wie Hooker gehofft hatte, nimmt die Vegetation tatsächlich mehr Feuchtigkeit von den Wolken auf, bestätigte er mir. Und dies, obwohl die Niederschlagsmenge im umliegenden Flachland zurückgegangen ist.3
Die viktorianischen Siedler der Insel beschränkten sich jedoch nicht nur auf Pflanzen. Das dort stationierte Militärpersonal folgte der unter den im Ausland lebenden Europäern verbreiteten Mode, ihre neue Umgebung mit Vögeln und Tieren aus der Heimat auszustatten. Daher befanden sich auf den Schiffen, die Ascension regelmäßig ansteuerten, Igel und Krähen, Frettchen und Eulen, Bienen zur Besamung und Perlhühner für die Jagd. Ascension wurde jedoch nie zu dem erhofften »kleinen England«. Von den eingeführten Vögeln blieben nur tropische Kanarienvögel und Stare. Die Säugetiere konnten sich besser anpassen, was sich an der Vielzahl von Ratten und Kaninchen ablesen lässt, und immer wieder findet man verwilderte Schafe, Kühe und Hühner von der aufgegebenen Landwirtschaft. Außerdem wandern Nachkommen der einst zum Transport des Wassers aus den Bergquellen zur Garnison an der Küste eingesetzten Esel durch die Landschaft, fressen die Früchte des Mesquitebaums und stören den Straßenverkehr.
Die eingeschleppten Ratten wurden zum Problem. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie zwei heimische Vogelarten zum Aussterben gebracht, zwei nur auf Ascension einheimische, endemische Rallen und womöglich auch einen Nachtreiher.4 Lange Zeit gab es auch verwilderte Katzen, deren Vorfahren ursprünglich zur Bekämpfung der Rattenpopulation hergebracht worden waren. Diese hatten nämlich den Kolonien von Seevögeln derart zugesetzt, dass die meisten zum Nisten auf eine kleine, vor der Küste liegende und als Boatswain Bird Island bekannte Insel ausgewichen waren. Nachdem die Ornithologen ein Programm zur Ausrottung der Katzen eingeleitet hatten, konnte man die letzte 2006 in dem abgeschiedenen Cricket Valley erlegen. Seither verzeichnet man auf Ascension die Rückkehr der Tölpel. Und während meines Aufenthalts sprachen die Naturschützer der Insel über das Gelege eines zurückgekehrten Paars heimischer Adlerfregattvögel, das, wie sie hofften, überleben werde.5 Zudem legten im Jahr 2013 ungewöhnlich viele Grüne Meeresschildkröten auf den Inselstränden ihre Eier ab – ein guter Beweis für deren großartige Erholung, denn das Tier wurde jahrzehntelang gejagt, um es zu Suppe zu verarbeiten. Das letzte Opfer wurde 1957 anlässlich seines Besuchs auf Ascension für Prinz Philip, den Herzog von Edinburgh, zubereitet, heißt es.6
Die Neuankömmlinge haben die Biodiversität auf der Insel ganz beträchtlich gesteigert und umfassen heute mindestens 90 Prozent der dortigen Spezies. Bei den Menschen sind sie wohl gelitten. Als die Inselverwaltung im Jahr 1980 zwölf Briefmarken zum Thema »Heimische Insekten« herausgab, hatten alle zwölf Arten ihren Ursprung in anderen Erdteilen. Die sogenannte Ascension-Lilie, die als Nationalsymbol der Insel gilt, stammt eigentlich aus Südamerika. Es gibt jedoch auch Stimmen, die für die Auslöschung fremder Flora und Fauna eintreten, um das Wiedererstarken heimischer Spezies zu unterstützen. Sie machen die Umweltanarchie Hookers und seiner Nachfolger für das Aussterben dreier Farne der Insel und eventuell einiger davon abhängiger Insektenarten verantwortlich – obwohl man nicht ausschließen kann, dass ein paar Exemplare irgendwo in den tiefen Tälern an den Hängen des Vulkans überlebt haben. Als wir von unserem Bergpfad auf eine aufgegebene Bodenstation der NASA blickten, wies Stroud auf eine steile Klippenwand unter uns, wo er im Jahr 2009 eine einzelne Pflanze des ausgestorben geglaubten Ascension-Petersilienfarns, des Anogramma ascensionis, gefunden hatte. Gegenwärtig wird er in Hookers einstigem Amtssitz im Botanischen Garten von Kew vermehrt und auf seine Wiedereinführung vorbereitet.
Die Umweltpolitik der britischen Regierung sieht für die Insel vor, »invasive Spezies zu begrenzen und auszurotten«, um »den Schutz und die Erholung lebensnotwendiger Habitate« sicherzustellen. Doch das sind eher Glaubensbekenntnisse als eine auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte und durchdachte Politik. Denn bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass die »Begrenzung und Ausrottung« fremder Arten das Aussterben einiger heimischer Arten, endemische Farne eingeschlossen, bedeuten könnte, da deren »lebensnotwendige Habitate« inzwischen von fremden Bäumen auf dem Green Mountain gebildet werden. Der zur ursprünglichen Vegetation der Insel gehörende Farn Xiphopteris ascenionos, der sich einst an den nackten Berg klammerte, lebt heute nur noch auf den moosbewachsenen Zweigen importierter Pflanzen, am liebsten auf Bambus. »Die Farne mögen den Schatten«, sagt Stroud. »Gäbe es nicht die Bäume und die anderen Pflanzen, wären sie womöglich gar nicht mehr da.«
Auf unserem Weg zurück ins Tal kame...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Brauchen wir eine neue Natur?
- Dank
- Vorbemerkung
- Abkürzungen
- Einführung: Natur in einer Welt von Menschen
- TEIL I: Die Hoheitsgebiete der Fremden
- TEIL II: Mythen und Dämonen
- TEIL III: Die neue Wildnis
- Anmerkungen
- Artenregister