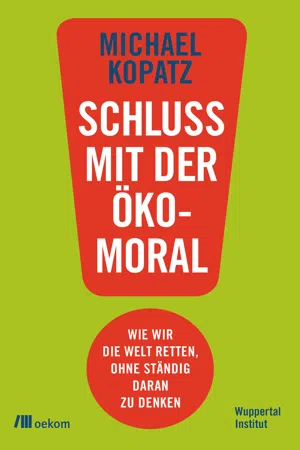
eBook - ePub
Schluss mit der Ökomoral!
Wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken
- 240 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
»Michael Kopatz hat mich begeistert mit der Idee: Menschen ändern sich nicht durch Einsicht, sondern durch neue äußere Umstände, wenn die richtige Entscheidung die leichtere wird. Mehr gute Politik – weniger schlechtes Gewissen!« Eckart Von Hirschhausen
»Politisches Engagement ist wichtiger als privater Konsumverzicht«, meint Michael Kopatz. Moralische Appelle machen nur schlechte Stimmung, ändern aber nicht unsere Routine. Wie erfolgreich Protest sein kann, zeigt aktuell die Fridays for Future-Bewegung, die für neue, der Situation angemessene Strukturen kämpft, statt für persönliche Verhaltensänderungen. Kopatz fordert die Politik auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und intelligente Standards und Limits zu setzen – damit ›Öko‹ zur Routine wird und die erhobenen Zeigefinger verschwinden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Schluss mit der Ökomoral! von Michael Kopatz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politics & International Relations & Politics. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Unterwegs

Freitagnachmittag. Feierabend. Wochenendstimmung. Wenn da nicht der Verkehr wäre. Wo man hinschaut, die Straßen sind verstopft. Fast 50 Millionen Pkw sind in Deutschland mittlerweile zugelassen, dazu kommen noch mal drei Millionen Lkw und vier Millionen Motorräder. Als wäre das nicht längst schon viel zu viel, wächst die Fahrzeugdichte immer weiter. Allein in den letzten zehn Jahren kamen sieben Millionen weitere Kraftfahrzeuge hinzu.
Dabei sprechen Umfragen regelmäßig eine ganz andere Sprache. Die Mehrheit der Bundesbürger ist vom ewigen Stau genervt, 90 Prozent wünschen sich weniger Autos in der Stadt. Viele junge Leute wollen gar kein Auto mehr besitzen. Carsharing wird immer beliebter, die Nutzung von E-Bikes, mit denen sich auch längere Strecken mühelos zurücklegen lassen, wächst rasant. Haben diese Entwicklungen denn gar keinen Effekt?
Leider nein. Entgegen der kollektiven Selbstimagination hat sich die Situation verschlimmert. Die Energiewende ist – zwar langsam, aber immerhin – auf dem Weg, die Verkehrswende findet nicht statt. Auch beschauliche Städtchen wie Münster oder Osnabrück müssen einräumen, dass der Autoverkehr in der Stadt in den vergangenen Jahren noch mal um zehn bis 15 Prozent zugelegt hat.
Bei keinem anderen Thema ist die Bilanz der letzten zwanzig Jahre so düster wie beim Verkehr. Die Energiewirtschaft hat ihre CO2-Emission um fast 30 Prozent verringert, die Industrie um ein Drittel, und bei Gebäuden liegt die Reduktion bei 40 Prozent. Nur bei der Mobilität, da gibt es keine Fortschritte.
Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist klar, dass es langfristig nicht so weitergehen kann wie bisher. Beim Abendessen mit Freunden ist Klimaschutz immer häufiger ein Thema. Alle sind sich einig, dass etwas getan werden muss gegen die globale Erwärmung. Der Hitzesommer 2019 hat deutlich vor Augen geführt, dass es ohne entschiedenen Klimaschutz nicht geht. Nach dem Abendessen fahren die Gäste dann mit dem Auto nach Hause, womöglich keine drei Kilometer.
Erklärungen sind leicht bei der Hand. Man müsse ja nicht gleich sofort und bei sich selbst anfangen. Außerdem bringe es nichts, wenn einer sein Auto stehen lässt, aber alle anderen weitermachen wie bisher. Und sowieso seien China oder Indien die sehr viel größeren Produzenten von Treibhausgasen. Das bisschen CO2, das man selbst, ja selbst ganz Deutschland verursacht, falle da doch kaum ins Gewicht.
Individuell betrachtet, ist das eine ganz rationale Überlegung. Schließlich kann der zum Klimaschutz geneigte Bürger seine Nachbarn nicht zwingen, auf das Auto zu verzichten. Auch werden es nur wenige wagen, ihn darauf anzusprechen. Wer möchte schon als Miesepeter dastehen. Und so führt das individuell rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis. Niemand will den Klimawandel, niemand will sinnlos Ressourcen verfeuern. Trotzdem passiert es.
Dass die Zahl der Fahrzeuge immer weiter zunimmt, ist gar kein Problem, erwidern viele Experten aus der Autobranche. Schließlich würden die Autos ja immer effizienter und klimafreundlicher. Mag sein. Doch für den Klima- und Umweltschutz bringt das wenig, weil die Kraftfahrzeuge immer schwerer und leistungsstärker werden. Im Schnitt hatte im Jahr 2018 jeder Neuwagen 152 PS unter der Haube. Im Jahr 1995 waren es noch 95 PS.9 Diese Entwicklung wird sogar politisch befördert durch das sogenannte Dienstwagenprivileg.10 Zwei Drittel aller Pkw werden in Deutschland als Dienst- beziehungsweise Firmenwagen gekauft, Tendenz steigend.11
Zugleich hat der Straßengüterverkehr dramatisch zugenommen, weil Unternehmen ihre Lager auf die Straße verlegt haben – »Just in Time«, auf Kosten von Steuerzahlern und Umwelt. Um 20 Prozent liegen die CO2-Emissionen des Lkw-Verkehrs mittlerweile über dem Niveau von 1995.
Ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit hat sich etabliert. Und alle machen mit. Weil wir Kartoffeln aus Ägypten kaufen statt bei den Bauern aus der Region. Weil an den Flug- und Seehäfen immer mehr Überflüssiges landet und ins Land gekarrt wird. Weil selbst die Herstellung einer einfachen Lasagne auf fünfzehn Nationen verteilt ist.
Eine Politik für enkeltaugliche Mobilität sorgt hingegen für kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf. Sie schafft eine exzellente Anbindung zum kostengünstigen Nahverkehr und sorgt für verlängerte Wege zum Auto. Sie reduziert schrittweise die Stellplätze und fördert den Einsatz von besonders sparsamen Personenwagen. Und sie traut sich, die steuerliche Begünstigung von Dienstwagen und Dieselkraftstoff endlich abzuschaffen.
Ein Limit für neue Straßen
Ein Straßenbaustopp – das klingt zunächst wie eine verrückte Forderung. Und dennoch gab es sogar eine Petition dazu. Viel Geld könnte so gespart werden, rechnete die Petition »Straßenbaumoratorium« damals vor. Schon jetzt sei ein gewaltiger Sanierungsstau aufgelaufen, argumentierte die Bürgerinitiative, die die Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht hatte. Mit jeder weiteren Straße würden die Unterhaltungskosten weiter steigen und die Mittel zum Erhalt der bestehenden Infrastruktur blockieren.12
Ein Moratorium würde nicht nur die Finanzhaushalte von Bund und Ländern entlasten, sondern auch die der Kommunen. Denn allen Klagen über klamme Kassen zum Trotz ist allerorts noch Geld für Erweiterungs- und Umgehungsstraßen da. Und dies, obwohl die öffentlichen Haushalte schon jetzt kaum in der Lage sind, die Bestandsstraßen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, weil viel zu wenig Geld für die Instandhaltung vorhanden ist.
Nur wenn keine Straßen aus- oder neu gebaut werden, lässt sich vermeiden, dass der Lkw-Verkehr weiter drastisch zunimmt und der Verkehrssektor noch klimaschädlicher wird. Die frei werdenden Mittel investiert der Verkehrsminister stattdessen in die Bahn und ermöglicht so einen echten Schritt in Richtung Verkehrswende. In der Folge werden Spediteure ihre Routinen ändern.
Keine Lust auf Stau: Ein Limit für Autos
Die Straßen sind verstopft, und die Blechverschmutzung unserer Städte verschlimmert sich permanent. Was kann man dagegen unternehmen?
Ganz einfach, wir legen eine Obergrenze fest. Das habe ich bereits in »Ökoroutine« vorgeschlagen. Damals habe ich das noch für revolutionär gehalten. Doch Singapur hat jetzt genau diesen Beschluss gefasst.
Seit dem 1. Februar 2018 gibt es dort nur dann noch eine Zulassung für einen Privatwagen, wenn zuvor ein anderes Auto verschrottet wurde und das nötige Zertifikat somit wieder auf den Markt kommt. Nullwachstum im privaten Autoverkehr – und kein Volksaufstand ist in Sicht.
Schon heute ist die Autodichte Singapurs deutlich geringer als in anderen Städten. Auf zehn Bewohner kommt hier ein Privatwagen, in München sind es fast fünfmal so viele. Der Grund: Eine Pkw-Zulassung kostet zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Das hat auch die Gutverdiener abgeschreckt.13

Eine Citymaut ist das eine, eine Pkw-Zulassung wie in Singapur, für die man zwischen 30.000 und 60.000 Euro berappen muss, das andere. Klar, dass so etwas hilft: Die Zahl der Autos geht dort drastisch zurück.
Es ist also sehr teuer, in Singapur ein eigenes Auto zu unterhalten. Aber die Regierung zockt die Leute nicht einfach ab, sie bietet auch etwas. Das Netz aus Bussen und Bahnen ist exzellent und wird unermüdlich erweitert. Die Ticketpreise sind zudem sehr günstig. Und da so viele Menschen den Nahverkehr nutzen, sind keine Steuerzuschüsse erforderlich.
In Deutschland könnte das Kraftfahrt-Bundesamt den Zuwachs an neuen Autos stabilisieren, also deckeln. Möglich wäre sogar eine schrittweise Reduktion.
Nach jeder Verschrottung würde ja eine Lizenz frei. Doch wer soll entscheiden, wer von den Bewerbern eine Lizenz für die Anmeldung eines Neuwagens bekommt? Nun, zunächst einmal könnte man festlegen, dass jeder, der einen Wagen abmeldet, auch eine neue Lizenz bekommt. Diese wird sehr begehrt sein. Wer sie nicht benötigt, kann verkaufen. Da winkt ein gutes Geschäft, wenn die Nachfrage groß ist.
Möglich wäre auch eine Lotterie oder Auktion. Wer hier nicht zum Zug kommt, würde im Folgejahr bevorzugt. Die Nutzungsdauer der Fahrzeuge verschafft den Interessenten beträchtlichen Spielraum.14
Von Dänemark lernen: Gebühren für den Neuwagen
Im Fernsehen läuft eine Dokumentation über die Verkehrspolitik in Dänemark. Für deutsche Verhältnisse ist es extrem teuer, dort einen Privatwagen zu halten. Die Dänen finden das normal.
Ich bin mir sicher, wenn das bei uns auch so teuer werden würde, schrittweise, dann hätten Busse und Bahnen mehr Zulauf. Und in den Städten würden mehr Menschen den Wagen abschaffen.
Würde man für jede Neuzulassung fünf Euro je Gramm CO2 verlangen, das ein Auto pro Kilometer verursacht, stünden bei einem durchschnittlichem Emissionswert von 130 Gramm mehr als zwei Milliarden Euro Investitionsmittel für den Umweltverbund zur Verfügung.15 Für einen Golf beispielsweise wären dann 730 Euro zu berappen.16 Das ist kein großer Betrag, wenn man bedenkt, dass jeder Pkw in Deutschland rund 2.000 Euro im Jahr an Kosten verursacht, die von der Allgemeinheit getragen werden.17
Auch ergibt sich aus der Gebühr kein unmittelbarer finanzieller Anreiz, die Anschaffung eines Autos zu vermeiden. Denn nach dem Kauf ist die Gebühr innerlich abgehakt, und die anschließende Nutzung des Automobils bleibt unbeeinflusst. Aber in jedem Jahr macht die Gebühr die Ökoalternativen attraktiver.
Steuern und Abgaben wie in Dänemark oder Singapur sind hierzulande zwar gegenwärtig undenkbar. Doch mit den fünf Euro je Gramm Kohlendioxidausstoß wäre ein Anfang gemacht, der noch Luft nach oben hat.
Wohlstandstourismus
Im Sommer 2018 thematisiert die Wochenzeitung »Die Zeit« den Wahnsinn des Flugverkehrs unter dem Titel »Die Hölle am Himmel«. Beschrieben wird dort auch ein Paar, das auf dem Flughafen Düsseldorf auf den Weiterflug nach Málaga wartet. Die beiden haben jeweils nur 40 Euro gezahlt, Hin- und Rückflug inklusive. Für die Parkgebühren am Flughafen Düsseldorf zahlen sie in der Zeit 140 Euro.18
Dumpingpreise haben die Vielfliegerei überhaupt erst möglich gemacht. Was wäre, wenn man eine Kerosinsteuer erheben würde, so wie es die Niederlande machen? Sie sind das einzige Land, das Flugbenzin besteuert. Sie machen einfach das, wovon in Deutschland die meisten behaupten, dass es nicht geht.
Und die Mehrwertsteuer? Genau, Flugtickets gibt es ohne Mehrwertsteuer, doch für Bahnfahrkarten zahlen wir 19 Prozent. Das ist nicht nur nicht fair, das ist ein Unding!
Einmal angenommen, eine Kleinfamilie zahlt für den Flug von Hamburg nach Lissabon rund 500 Euro. Sie fliegt regelmäßig dorthin, um Verwandte zu besuchen. Kämen Kerosin- und Umsatzsteuer dazu, läge der Preis bei 800 Euro. Das wäre keine Katastrophe, aber die Familie würde wohl ein-, zweimal weniger nach Lissabon fliegen.
Wir leben im Wohlstandstourismus. Eine Erholung am anderen Ende der Welt ist aber nicht möglich, ohne genau diese Welt zu zerstören.19
Richtig ist, jeder soll frei entscheiden dürfen, wohin es in den Ferien geht. Doch ein Menschenrecht auf Billigflüge gibt es nicht.
Das Fliegen limitieren statt Malle für alle
Viel wichtiger als eine Steuer auf Flugbenzin ist die Begrenzung der Fliegerei. Da wir offenbar nie genug haben können, müssen wir systemische Grenzen setzen. Limits für Starts und Landungen auf Flughäfen können dabei helfen, dass wir unsere gesellschaftliche Verantwortung auch wahrnehmen – ohne ständig daran denken zu mü...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Zehn Gebote zur Ökoerlösung
- Vorwort: Ökomoral kann nerven
- Einführung: Luisa scheitert
- Warum dauert alles so lange?
- Unterwegs
- Konsum
- Essen
- Wohnen, Wärme, Strom
- Arsch hoch, liebe Demokraten!
- Anmerkungen