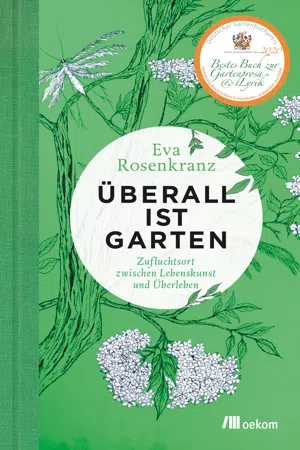
eBook - ePub
Überall ist Garten
Zufluchtsort zwischen Lebenskunst und Überleben
- 352 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Gärtnern ist in – sei es aus Lust am eigenen Tun, sei es als kleine Flucht aus einer Welt voller Zeitnot und Lärm. Doch ein guter Garten ist mehr als ein ›Zurück zur Natur‹, denn die Blaue Blume der Romantik kann schon morgen Schneckenfraß sein. Indem das Buch den ›Spieler‹ April porträtiert, den Südwind im Juli oder den rauschhaften Oktober, führt es durch das Jahr und stellt dabei Tugenden und Haltungen in den Mittelpunkt, die im Garten ihren Nährboden finden – von Gelassenheit und Empathie bis zu Widerstandskraft und beherztem Tun.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Überall ist Garten von Eva Rosenkranz,Ulrike Peters im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Wissenschaftliche Forschung & Methodik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information

JANUAR
Torwächter schützt Unbekümmerte
Buchsbaum und Spatz
»Ein einziger Vogel genügt,
damit der Himmel nicht stürzt.«
damit der Himmel nicht stürzt.«
Faraj Bayrakdar
Der Januar ist eine Enttäuschung. Fraglos ist das ein gewagter Einstieg in ein Buch zum Garten. Aber bleiben Sie bei mir! Enttäuschung wird Erstaunliches zum Vorschein bringen.
Enttäuschung schafft Klarheit, auch Enttäuschungen haben ihren Reiz. Denn der Januar lehrt, sich künftig kein X mehr für ein U vormachen zu lassen. Er verspricht Durchblick. Lassen Sie sich also nicht abschrecken.
Bleiben wir zunächst bei meiner Enttäuschung.
Ja, ich kann den Januar nicht leiden – eigentlich. Er fühlt sich jedes Jahr länger an als 31 Tage, viel länger. Warum?
Nichts los nach all der Dezember-Aufregung, dunkel, alles offen, kein Aufbruch, zu viel wegräumen, Kerzen abgebrannt, Weihnachtsbaum wird grau und lässt Zweige hängen; melancholisch, weil Weihnachten so schön, so gemeinschaftlich, so still war; unwirsch, weil das Getriebe wieder anläuft; Sehnsucht, dass die sanfte Zeit von Weihnachten bis zum Jahreswechsel, hier in Bayern bis Dreikönig, noch ein wenig bleiben möge …
Das Gegenteil ist der Fall. Sobald der erste Tag nach Ferienende heraufzieht, bricht hektische Betriebsamkeit aus. Als müsse sofort alles nachgeholt, nachgelebt werden. Nur ja nicht den Eindruck erwecken, es sei gut gewesen in der Ruhe und Stille (die ungeduldigen Weihnachtsurlauber haben sowieso nur die eine Hektik mit der anderen vertauscht). Den Müßiggang und die lange Weile, in Bayern gibt es hierfür das wunderbare Wort Zeitlang, gilt es vergessen zu machen. Nur nicht zeigen, dass ein anderes Leben denkbar, sogar schön wäre, dass wir gern ein wenig vom Nachsinnen, Langsamsein, heute sagt man Entschleunigung, bewahren würden. Es könnte anders sein, ist eine so verlockende wie beklemmende Botschaft.
Enttäuschung setzt Erwartungen voraus. Der Kalender verspricht Neues, zwölf Monate liegen vor uns, Vorsätze haben Konjunktur. Doch der Blick in den Garten ist ernüchternd. Von wegen »allem Anfang wohnt ein Zauber inne«. So predigen denn die meisten Gartenbücher zum Jahresbeginn, wenn der Winter gerade ein wenig ernst macht, Pseudoaktivitäten. Schnell wieder in den Arbeitsmodus schalten.
Im Garten passiert – nichts. Und deshalb versuchen viele Gartenbücher, die dem Monatsrhythmus folgen, die Januar-Langeweile heftig zu übermalen. Mit dem Hinweis auf neue Kataloge und neue Züchtungen, mit Traumbildern von Frühlings- und Sommergärten. Oder wenigstens mit schön ausgeleuchteten Winterbildern. Die Botschaft heißt: Einkaufslisten machen. Enttäuschung in Käuflichkeit umdeuten.
Das ist verständlich. Aber der Blick aus dem Fenster zeigt in meinem Garten Graubraun als Trendfarbe. Melancholischer geht es kaum. Der Garten widersetzt sich, wie die gesamte Natur draußen, jedem Anflug von Beschaulichkeit, ist beharrlich still, spröde, abweisend. Als sei alle Kraft nach innen gerichtet, aufs Überleben konzentriert.
Der Januar-Garten mutet ungastlich, unversöhnlich, kompromisslos an. Keine Beschönigung. Kein Trost.
Gemeinsam sind wir stark
Da wird gefiederter Widerspruch laut. Spatzen – erst einer, dann zwei, dann … 17, 18, 19. Mag sein, dass ich mich hier schon verzählt habe. Sie können einfach nicht still sitzen. Schon gar nicht, wenn es um Futter geht. Und das übrigens nicht nur im Winter. Aber jetzt lassen sie sich an den Futterstellen auf der Terrasse aus relativer Nähe beobachten. Und ich kann sie im Vergleich mit anderen hungrigen Gästen studieren. Nein, Wintervogel ist nicht gleich Wintervogel. Natürlich wollen sie alle nur eines: fressen. Damit haben sich die Gemeinsamkeiten auch schon. Die Hochlagen des Futters sind Lieblingsplätze der Meisen, der etwas behäbig wirkenden Kohlmeisen wie der feingliedrigen Blaumeisen. Wenn es nicht anders geht, klemmen sich auch Spatzen auf den Rand des mit Glas überdachten Futterrondells. Und wie üblich, nicht nur einer, sondern möglichst alle – was notgedrungen zu Abstürzen führt. Was soll’s, scheint der eine oder andere zu signalisieren. Schauen wir mal, was auf dem Holzdeck so rumliegt. Die Meisen haben etwas indigniert (das ist natürlich eine Vermutung, die ich mit großem Vergnügen nicht nur im Januar anstelle) im angrenzenden Winterschneeball Platz genommen und beobachten das Gedränge. Während die meisten Spatzen also am Boden picken – für die oben verbliebenen ist es auch bald langweilig, und sie schauen mal bei denen unten vorbei –, kommen einige Meisen zurück.
Was nun folgt, ist mir bis heute unklar. Die Meisen kehren das Futter von unterst zu oberst, werfen so einiges runter zu den Spatzen. Die nehmen den Futterregen fressend zur Kenntnis, ohne jedoch alle Brosamen zu akzeptieren. Vor allem sind ihnen Sonnenblumenkerne augenscheinlich zu mühsam. Die bleiben oft wochenlang liegen, bis ich sie durch Ritzen und über die Ränder der Terrasse fege. Im Frühjahr sprießen dann aus Zwischenräumen, in Blumenkästen, an Holzkanten Sonnenblumen. So fällt für die menschlichen Mitbewohner etwas ab.
Die Hilfe aus den oberen Etagen nehmen auch Rotkehlchen, Erlenzeisig, Zaunkönig oder Amsel gerne in Anspruch. Letztere versuchen erst gar nicht, sich in die aufragende Futterstelle zu klemmen. Eine Amsel hat es mal versucht, mit vorhersehbarem Ausgang. Rotkehlchen und Zaunkönig sind ausschließlich hüpfende Bodenfresser. Eine Strategie, die sicher einen guten Grund hat – strenge Zuordnung der Gartenetagen vielleicht –, aber in jedem Fall riskant erscheint. Nachbars Kater ist nie weit.
Highlights bei der Wintergesellschaft sind die Fettbälle, die ich in Metallkörbchen an langen Stielen unterbringe, dort, wo einst Kerzen vorgesehen waren. Auf der überschaubaren Oberfläche dieser Kugeln finden bis zu drei Spatzen Platz, wobei Tumulte, Geflatter und paarweises Auffliegen mit kurzem Lufttänzchen unvermeidlich zu sein scheinen. Um die Futterbälle herum wird jeder halbwegs taugliche Zweig, trockene Stängel oder vergessene Stützstab als Sitz genutzt, um den Abflug der zuerst Fressenden ja nicht zu verpassen. Wildes Geschaukel inklusive. Ich habe den Eindruck, dass Geduld nicht die stärkste Qualität von Spatzenpersönlichkeiten ist.
Wenn ich die Spatzenschar auf der Terrasse einfallen sehe, erinnere ich mich an ein Frühsommerbild: das Spatzenbad. Einer vorne weg in die Matschpfütze mit ausreichendem Wasserstand, bestimmt der Kundschafter; dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 hinterher. Ein spritziges Geplansche, halbe Tauchversuche. Ein wenig wie im Nichtschwimmerbecken für die Kleinsten. Schließlich fliegen alle auf, bis auf den Ersten. Seine Begeisterung scheint grenzenlos. Immer wieder streckt er den Kopf vor ins Wasser und lässt es in einer schnellen wellenartigen Bewegung über den Körper laufen. Erst als er komplett nass wirkt, fliegt er tropfend und zerzaust in die nahe Weide, wo die anderen bereits ihr Gefieder sortieren.
Ich bin verliebt in die Unbekümmertheit der Spatzengesellschaft und könnte ihnen ewig zuschauen. Sie setzen unverbrüchlich auf Gemeinschaft. Wie stark ihr Zusammenhalt und wie gefährdet dieser ehemalige Allerweltsvogel heute ist, lässt sich überall auf dem ›Planet der Spatzen‹ studieren.
Übrigens ist Spatz ein Kosename für die Sperlinge (Feld- und Haussperling), von denen etwa 500 Millionen weltweit leben; beide Namen werden auf sprachliche Bedeutungen von ›zappeln‹ zurückgeführt. Was meinem Eindruck von den unentwegt hüpfenden, auffliegenden, drängelnden Lebenskünstlern entspricht. Lebenskünstler? Welch großes Wort für diese kleinen Vögel, die es nicht einmal zu einem auffälligen Gewand gebracht haben. In Tausenden von Jahren haben sie sich in Braungrau den Menschen und ihren Behausungen angepasst, suchen ihre Nähe, bleiben aber wachsam. Nimmt man eine Notiz von Alfred Brehm ernst, so scheint eine gewisse Vorsicht der Spatzen gegenüber Menschen durchaus ratsam: »Er ist ein schrecklicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. Trotzdem schreit, lärmt und singt er, als ob er mit der Stimme einer Nachtigall begabt wäre.« Auch die Beschreibung ›Dreckspatz‹ ist wohl nur mit Wohlwollen als zärtlich einzustufen, verweist aber auf ihre Vorliebe für Staubbäder, um die Federn von Parasiten frei zu halten. Kaum jemand weiß, dass China unter Mao Krieg gegen die Spatzen führte. Man wollte ihnen die Schuld an den Hungersnöten unter die Federn schieben. Landesweit wurden die Spatzen durch Lärm und Verjagen für drei Tage in der Luft gehalten. Zwei Milliarden Vögel starben. Die Folge: Die Schädlinge nahmen überhand, und Feldsperlinge wurden wieder importiert. Menschliche Dummheit vom Schlimmsten.
Aus Zuneigung zu der graubraunen Gesellschaft in meinem Garten, deren Gepflogenheiten mir so wenig vertraut waren wie ihre Allgegenwart selbstverständlich, habe ich einige Informationen eingeholt. Sie leben, wenn es gut geht, etwa vier Jahre, führen eine Dauerehe mit Seitensprüngen, in der das Weibchen entscheidet, wessen Nestangebot ihren hohen Ansprüchen genügt. Sie brüten bis zu viermal pro Jahr, versorgen auch Küken, die verwaist sind, und haben den höchsten Anteil an Verkehrstoten. In allen Großstädten sind sie zu Hause. Die weltweit größte Spatzenkolonie lebt in Paris an der Kirche Notre-Dame; ihr Flugballett gehört dort zu den Attraktionen. Gehörte muss man nach dem Brand der berühmten Kathedrale wohl sagen. Über die Verluste der Spatzen ist bisher nichts bekannt. Doch die Verluste dort fallen angesichts der gesamten Notlage wohl kaum ins Gewicht. Und dabei ist der Spatz uns Menschen so selbstverständlich, dass wir fast übersehen hätten, wie stark die Bestände zurückgehen (in Europa fast halbiert). Ursachen sind industrialisierte Landwirtschaft mit hohem Gifteinsatz und weitreichender Verödung der Landschaften sowie Futtermangel insbesondere durch das Insektensterben, außerdem die Vernichtung von Hecken als Schutzgehölze sowie gedämmte Häuser und fugenfreie Dächer. Daraus resultiert massive Wohnungsnot. Aus einigen Städten sind die Spatzen verschwunden.
Geheimniskrämer und Freigeist
Von Gefährdungen und Verlusten wird übers Jahr immer wieder zu berichten sein, denn sie lauern auch um mich herum an jeder Ecke.
Hier ist es an der Zeit, meinen Garten, der mich zu diesem Buch bewogen hat, ein wenig vorzustellen. Er liegt in der oberbayerischen Moränenlandschaft, einem ›gletschergeborenen Land‹, am Rand eines Dorfes mit 1500 Einwohnern. Bis vor 25 Jahren war er eine fette Wiese; bis heute grenzt er an landwirtschaftlich genutzte Flächen. Er misst etwa 900 Quadratmeter und hat eine überwiegende Südausrichtung. Das Haus bildet einen lang gestreckten Schutzwall gegen Norden. Für mich strahlte er von Beginn an Gleichmäßigkeit aus, die ich heute Gleichmut zu nennen wage. Auf mich wirkt er unaufgeregt und schön.
Er ist kein Paradiesgarten, kein ›Mein schöner Garten‹, keine Wildnis. Im Laufe der Geschichten um ihn herum wird er Kontur gewinnen. Mit seinen wunderbaren Plätzen und schwierigen Ecken, die aber andere Gartenbewohner für ein gelungenes Leben schätzen. Mit seinen Zuwanderern und Geflüchteten, den Widerborstigen und Anhänglichen. Er hält Überraschendes, Wildwuchs, Geplantes und Ungeplantes bereit – mein Sinn und des Gartens Eigensinn kollidieren hin und wieder.
Schaue ich in beliebte landlustige oder in eher streng kultivierte Zeitschriften zum Garten, beschleichen mich Zweifel, ob jemand außer mir die innere Struktur meines Gartens erkennt. Werde ich den Ansprüchen an einen ›guten‹ Garten gerecht? Sogleich beginne ich im Kopf zu planen, wegzunehmen, neu zu pflanzen. Manches setze ich in die Tat um, vieles nicht, noch nicht, möchte ich hinzusetzen, um die Hoffnung nicht aufzugeben, es doch noch zu realisieren – irgendwann.
Heute prägen ihn einige große Bäume; darunter meine Lebenstrostbuche, deren Vollendung ich trotz ihres beachtlichen Alters von 50 Jahren nicht erleben werde, außerdem der Hüter meines Apfelbaumbüros, zwei Süßkirschen und eine Ulme ganz am Rand (zu dicht an der Ackergrenze …), die dem Ulmensterben trotzt – noch. Anderes kommt hinzu, das im Laufe des Gartenjahres hier und da eine Rolle spielen wird. Die Baum-Mitbewohner mögen den Eindruck erwecken, es müsse schattig sein in diesem (für bayerische Landverhältnisse) mittelgroßen Garten. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt eine angenehme Verteilung von Licht und Schatten, die im Tageslauf durch den Garten wandern und einladen, immer neue Plätze zu erkunden. Nach ernüchternden Versuchen gibt es keinen Gemüsegarten, dafür mehr und mehr wilde Wiese für die Insekten (unsere gemeinsame Geschichte werde ich im Juni erzählen), eine Vielzahl von Stauden und noch mehr Rosen (eine kleine Bestandsaufnahme verspricht ebenfalls der Rosenmonat). Klingt unspektakulär und ist es wohl auch. Manchmal erscheint mir der Garten riesig mit seinen sichtbaren und unsichtbaren Bewohnern, mit all dem, was sich beobachten lässt. Er ist ein Geheimniskrämer (ein Wort, das meine Großmutter gern benutzte), der mir lächelnd die kühle Schulter zeigt, gleichwohl voller Angebote steckt, zu sehen, zu riechen, zu staunen. Unerwartet berührt er – und sei es nur mit einer Brennnessel, die ich, unbedarft umhergehend, übersah.
Er ist offen, aber wir würden uns nie an Vorzeige-Aktionen beteiligen. Manche werden ihn als wild empfinden (der Freund meiner Tochter fragte augenzwinkernd, ob die Bienen nicht eine Machete benötigen). Obgleich ich erst in den Weiten Kanadas gelernt habe, was wild bedeutet. Nein, wild ist er wohl nicht. Wäre er ein Mensch, würde ich ihn als Freigeist bezeichnen, der mich jeden Tag etwas lehrt. Vielleicht könnte ich ihn auch einen Lehrer im Querfeldein-Denken nennen. Er zieht stets eine andere Möglichkeit in Betracht, denn die oft vorgegaukelte eine Antwort gibt es nicht.
Natur eben. »Sie ist klug, sensibel, erfinderisch und genügt sich selbst« (David Boyd). Damit ist Wesentliches über meinen Garten gesagt.
Der Janusköpfige und die Magie
Aber jetzt ist Januar, und der Garten lehrt mich nichts – jedenfalls auf den ersten, zweiten und dritten Blick.
Für die alten Gartenbeobachter war er der härteste Monat des Jahres. Die Energie der Natur ist dick zugedeckt, tief versteckt, geschützt. Das Samenkorn liegt unsichtbar in der Erde, Eier und Puppen warten in Altholz oder welken Pflanzenresten, Bäume und Sträucher wirken wie tot. Ernüchternd jeder Blick nach draußen. Der kälteste, dunkelste, abweisendste Monat und Höhepunkt des Wenig im Jahreslauf. Fast alles draußen ist nun ungeschmückt, pur und nackt. Die Bäume stehen entkleidet da. Ein wenig erstaunt und verschämt muten sie an. Nackte Schönheit? Nur meine Buche trägt weiter ihr noch an die rotgoldene Herbstfärbung erinnerndes Gewand, wie die kleinen Hainbuchen (botanisch übrigens nicht ihre Schwestern) in der Südhecke, die nach dem großen Kahlschlag, von dem noch zu erzählen sein wird, gepflanzt wurde. Erst die Frühjahrsstürme werden die alten Blätter hinwegfegen.
Die längste Nacht der Wintersonnenwende ist kalendarisch im späten Dezember; doch wird sie erhellt vom Lichterfest Weihnachten. Erst der Januar lässt uns den Mangel an natürlichem Licht spüren. Er liegt zwischen dem Einstieg ins Dunkel und dem Ausstieg zu Lichtmess Anfang Februar. Januar und Februar empfinde ich daher als Winterzwillinge mit voneinander abgewandten Gesichtern: Der eine schaut ins Dunkel, der andere ins Licht.
Und in der Tat verdankt dieser Monat seinen Namen dem antiken Gott Janus; der mit den zwei Gesichtern. Eines blickte in die Vergangenheit, eines in die Zukunft. Er war der Hüter des Tores, des Ein- und Ausgangs. Der 1. Januar war ihm geweiht. Den kalendarischen Jahresbeginn markiert der Januar aber erst seit dem 2. Jahrhundert vor Christus.
Als Hüter der Schwelle stehen an der Nordseite zu unserer kleinen Straßen zwei Buchsbäume. Übermannshoch weisen sie den Weg zum Haus und entlassen mich in die Welt. Als Schutzbaum, dessen magische Kraft bis in antike Kulturen zurückreicht, begleitet er die Menschen, galt als Sinnbild des Lebenszyklus, der Liebe und der Unsterblichkeit. Später spielte er als gärtnerisches Gestaltungselement zum Beispiel in den Gärten der französischen Könige eine wesentliche Rolle. Bis heute wird der Buchs in rituellen Gebräuchen eingesetzt, etwa für die vorösterlichen Palmbuschen. Im Garten wird er vielfach als pflegeleichte Einfassung verwendet, wobei ihm seit einiger Zeit der Buchsbaumzünsler an die immergrünen Blätter rückt. Ein zartweißer Schmetterling, der aus Ostasien eingeschleppt, in Wahrheit für den hiesigen Buchsbaum-Hunger als ungebetener Gast mitimportiert wurde.
Mir gefällt die Idee des Schutzbaums, auch wenn ich erst lange nach dem Pflanzen davon erfahren habe. Dass die Magie von Pflanzen mir im Januar in den Sinn kommt, ist auch Teil seiner Janusköpfigkeit. Über Jahrtausende haben Dunkelheit und Kälte die Menschen geängstigt; ihre Tage waren kurz und die langen Nächte bedrohlich mit Traumgestalten und Geistern bevölkert. Die im Alpenraum verbreiteten Raunächte zeugen von dem Bedürfnis, sich für die härtesten Zeiten im Jahr Schutzgeister zu wünschen.
Die Magie von Pflanzen ist aber keineswegs auf winterliche Ängste beschränkt. Der Seidelbast, den ich in diesem Winter geschenkt bekam und der nicht weit von den Buchsbäumen einen Platz gefunden hat, strahlt mit seinen oft schon im Januar erscheinenden lilafarbenen Blüten etwas Magisches aus. Vielfach geht solche Anmutung mit stark giftiger Wirkung einher und mit dem Einsatz in der Heilkunde. Der Buchsbaum enthält 70 bekannte Giftsubstanzen, die übrigens die Raupen des Buchsbaumzünslers speichern und damit selbst für mögliche Fressfeinde ziemlich schwere Kost werden. Allerdings wurde hin und wieder beobachtet, dass Meisen die Raupen an ihre Brut verfüttern. Vielleicht bahnt sich ein Anpassungsprozess bei hiesigen Vögeln an, um diese üppige Nahrungsquelle ausschöpfen zu können.
Im vielfältigen Potpourri der Zauberpflanzen ragt die Alraune (wohlklingend auch Mandragora) heraus; sie beschäftigt die Phantasie bis heute. In meiner Diele hängt die Zeichnung eines Freundes – eine Alraunenwurzel, die sich bei konzentriertem Schauen in ein Liebespaar verwandelt. Um diese heiligste Pflanze, deren Wurzel alte Zeichnungen oft in Menschengestalt zeigen, ranken sich eine Vielzahl von Mythen, und damit hat sie es sogar in die Harry-Potter-Filme geschafft. Dort wird die Legende aufgegriffen, dass die Alraune beim Ausgraben zu schreien beginnt und Menschen um den Verstand bringt. Ich selbst habe vor einigen Jahren eine Alraunenpflanze erworben, sie vorsichtig, ohne ihre Wurzel freizulegen, in einen Topf gepflanzt. Dort machte sie nichts. Regungslos war sie weder bereit zu wachsen noch zu blühen. Eines Nachts verschwanden alle Blätter. Nach langem Zögern – eigentlich glaube ich nicht an Zauber – habe ich die Wurzel ausgegraben. Geschrien hat sie nicht.
Anmut des Winters
Trotz Spatzenglück und Pflanzenmagie holt mich der Januar-Blues wieder ein. Der Garten im Monat eins des Jahres ist eine Kampfansage an unser Schönheitsempfinden. Erst recht an jenes laute Blühdiktat, das Gartencenter und Baumärkte propagieren. Doch ich widersetze mich dieser Versuchung, den kleinen Fluchten in schnelles Ersatzglück – und schaue hin.
Besser wird mein Eindruck allerdings nicht. Es sei denn, man möchte die Erfindungsgabe der Farbe Braun besingen. Denn der Garten ergeht sich in immer neuen Variationen dazu. Dunkelbraun F...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Einleitung: Der Weg führt ins Offene
- Januar: Torwächter schützt Unbekümmerte – Buchsbaum und Spatz
- Februar: Tagträumerin bestaunt Freeclimber – Schlüsselblume und Laubfrosch
- März: Sternguckerin überragt Diagnostikerin – Kuhschelle und Schnecke
- April: Subversiver trifft Überfliegerin – Löwenzahn und Lerche
- Mai: Heiliger begleitet Spielverderberin – Holunder und Federgeistchen
- Juni: Alteingesessene betört Neubürger – Rose und Taubenschwänzchen
- Juli: Wärmeliebhaber hütet Lebenspender – Salbei und Regenwurm
- August: Liebeshungrige erhellen Frauendreißiger – Glühwürmchen und Johanniskraut
- September: Lichtzauberin grüßt Flugkünstler – Nachtkerze und Rotmilan
- Oktober: Anderweltwurzler lauscht Wintersänger – Esche und Zaunkönig
- November: (Un)Sterbliche trauen sich Freiheiten – Weide und Siebenschläfer
- Dezember: Wagemutiger neckt Straßenrowdy – Winterschneeball und Amsel
- Schluss: Ein duftendes Trotzdem
- Dank
- Literatur
- Über die Autorin