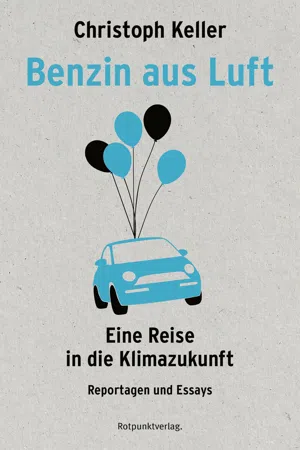![]()
Teil III
Andere Kreisläufe
![]()
CO2 aus der Luft holen
Packen wir’s ein
Wir wissen heute, dass wir das Klima des Planeten nicht stabilisieren können, ohne CO2 aus der Luft zu holen und somit den Anteil des Treibhausgases in der Atmosphäre aktiv zu senken. Eine Möglichkeit besteht darin, Bäume zu pflanzen, Regenwälder zu erhalten und aufzuforsten, oder CO2 mit neuen Landwirtschaftstechniken, etwa dem Arbeiten mit Humus, zu binden. Ein anderer Ansatz ist die technische Filterung von Kohlendioxid aus der Luft, mit großen Filtern. Von dieser Technik erhoffen sich einige Wissenschaftler rasche Ergebnisse; allerdings hätte man damit schon früher anfangen können – schon vor über zehn Jahren, als ich Klaus Lackner ausfindig machte, den Mann, der lange schon daran arbeitete, wie das mit dem CO2-aus-der-Luft-Filtern gehen könnte.
Es war in Los Alamos, in einem Labor des National Laboratory, vor Jahren.
Der Astrophysiker Sterling Colgate stand zwischen Labortischen, gestapelten Papieren, Tassen mit eingetrocknetem Kaffee, und parlierte wieder einmal über seine Idee, man könnte doch mit warmer, aufsteigender Luft in riesigen Türmen Turbinen antreiben und so Elektrizität gewinnen. Die Kollegen kannten die Geschichte, und auch Klaus Lackner hörte nur mit halbem Ohr zu, wie Sterling Colgate von Durchflussmengen sprach, von Kubikkilometern Luft, die man durch die Türme jagen könnte.
Aber dann, zurück in seinem Büro, wurde Klaus Lackner von einem Gedanken eingeholt.
Denn er hatte immer schon diese eine Frage im Sinn gehabt: wie man das viele Kohlendioxid, das die Menschheit durch Verbrennung fossiler Brennstoffe unablässig in die Atmosphäre entlässt, wie man dieses viele CO2 aus der Luft wieder herausfiltern könnte.
Das war zu Beginn der Neunzigerjahre, lange bevor das Thema Klimaerwärmung auf den Titelseiten der Zeitungen stand, weit vor der Zeit, als Menschen begannen, aus Sorge ums Weltklima Glühbirnen gegen Sparlampen auszutauschen, und man auf internationalen Konferenzen nächtelang um Kompromisse rang, um dann eine »Roadmap« zu verabschieden.
Klaus Lackner gehörte zu denen, für die aus wissenschaftlicher Einsicht klar geworden war, dass man eines Tages eine Lösung für die steigende Konzentration an CO2 in der Atmosphäre würde finden müssen. Schließlich hatte Lackner, der 1978 sein Studium in theoretischer Physik an der Universität Heidelberg abgeschlossen hatte, sich stets mit den Aggregatszuständen kleiner und kleinster Teile beschäftigt. Er hatte dies bei seinen Forschungsaufenthalten am California Institute ebenso getan wie am Stanford Linear Accelerator Center, wo er über die Chemie von Atomen arbeitete, später auch über Fragen rund um die Kernfusion.
Als ich mit Klaus Lackner sprach, arbeitete er am renommierten Earth Institute der Columbia University in New York, Tür an Tür mit dem Entwicklungsökonomen Jeffrey Sachs, dem Spiritus Rector des UNO-Millenniumplans zur Bekämpfung der Armut auf der Welt. Mit seinen Flussdiagrammen aus Los Alamos war er ein gutes Stück vorangekommen, er hatte sie so oft durchgespielt und in unzähligen Publikationen verfeinert, dass er sie auswendig konnte; allerdings interessierte ihn nicht mehr, wie viel Energie sich aus aufsteigender Luft gewinnen ließe, sondern einzig die Frage, wie viel Luft man durch eine bestimmte Fläche jagen müsste, um eine genügende Menge an CO2 herauszufiltern.
Ich fragte ihn:
»Ist es möglich, das Weltklima zu retten, indem wir CO2 aus der Luft absaugen?«
»Ja, auf jeden Fall. Pflanzen tun das jeden Tag, sie entnehmen CO2 aus der Luft, wandeln es um in Kohlenstoff, den sie für ihr Wachstum brauchen, und sie geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Unser Problem ist, dass die bestehenden Bäume und Pflanzen das CO2 nicht genügend schnell und auch nicht in genügender Menge aus der Luft entfernen. Und ich sehe zurzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass die Menschheit in absehbarer Zeit vollständig auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen wird verzichten wollen oder können – das heißt, wir haben auf längere Frist hinaus ein Problem.«
»… das aber zu lösen wäre, indem man den Ausstoß an CO2 drastisch reduziert.«
»Keine Frage, wir müssen den Ausstoß von klimaschädigenden Gasen massiv herunterfahren. Aber ich fürchte, wir werden damit nicht schnell genug sein. Wir werden gezwungen sein, die bestehenden Konzentrationen an CO2 in der Luft zu reduzieren. Nur so werden wir den Kollaps des Klimas verhindern können. Konkret: Wir werden verhindern müssen, dass die Konzentration an CO2 über die Marke von 500 ppm steigt, dass sich die globale Temperatur weiter erhöht als die 2 Grad, die vom IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, als kritisch bezeichnet wurden.«
»Man könnte die Konzentration von CO2 auf ein vorindustrielles Niveau senken?«
»Prinzipiell ja.«
»Aber warum soll man das CO2 aus der Luft abscheiden und nicht dort, wo es entsteht?«
»Auch das muss man tun, unbedingt. Man muss das CO2 an den Quellen einfangen, bei Kohlekraftwerken, bei Gaskraftwerken, bei Ölplattformen, also überall dort, wo die Konzentration an CO2 hoch ist. Die Technologie zur sogenannten carbon capture ist verfügbar und wird allmählich auch kostentragend. Aber carbon capture ist eben nur sinnvoll bei großen Anlagen mit einem großen Ausstoß an CO2, während sich das bei den vielen abertausend kleineren Verursachern von CO2, vor allem bei Autos, aber auch bei kleineren Heizungen, nicht rechnet. Sie können nicht in jedes Auto einen Abscheider von CO2 einbauen, das ist auch technisch enorm schwierig, da ist es einfacher, das emittierte CO2 aus der Luft abzusaugen.«
Klaus Lackner hat in seinen Berechnungen alle Parameter berücksichtigt. Sein erstes Problem bestand darin, dass das CO2 in der Luft in ausgesprochen kleinen Konzentrationen vorkommt. Etwa 180 ppm waren es vor der Industrialisierung, heute sind es über 400 ppm, und ppm heißt nichts anderes als »parts per million«, also Teile pro Million Luftpartikel – das ist für unser Klima bereits zu viel, weil die Atmosphäre auf einen Anstieg der CO2-Konzentration äußerst sensibel reagiert; für den Physiker aber stellt sich das Problem, diese wenigen Partikel aus der Luft herauszukriegen.
Klaus Lackner wies nach, dass ein System zur Ausscheidung von Kohlendioxid aus der Luft dann Sinn macht, wenn man den Wind als Transportmittel einsetzt – der Wind würde das CO2 zu den vorgesehenen Filteranlagen transportieren. Dort könnte es ausgeschieden werden – und zwar mit einem Energieaufwand, der um ein Mehrfaches geringer wäre als die Energie, die im CO2 selbst enthalten ist. Energetisch betrachtet, so Lackners Fazit, rechnete sich also die Absorption von Kohlendioxid aus der Luft. Und damit war bereits ein Teil des Problems gelöst – ein Filter von einem Quadratmeter Fläche würde reichen, um den Jahresausstoß eines Amerikaners aus der Luft zu holen. Günstiger und effizienter aber wären größere, windparkähnliche Anlagen, ganze Parks von CO2-Saugern, eventuell auch Konstruktionen, die Blättern an einem Baum glichen. Tausende solcher CO2-Sauger, aufgestellt auf der ganzen Welt.
Nur wenige nahmen Lackners Idee zur Kenntnis; denn das war zu einer Zeit, als man noch glaubte, man könne den Klimawandel mit dem Kyoto-Protokoll stoppen, man werde die Emissionen schon noch in den Griff kriegen, es war zu der Zeit, als die Wissenschaftler noch nicht in Alarmstimmung waren, jedenfalls lange bevor der CEO von Virgin, Richard Branson, einen Preis von 25 Millionen Dollar für das Projekt auslobte, mit dem es gelingen könnte, eine Milliarde Tonnen CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen.
Wer mit Klaus Lackner spricht, entwickelt ein anderes Verhältnis zum ungeliebten Klimagas CO2. Kohlendioxid wird in seinen Ausführungen zu einer fassbaren, fast schon handhabbaren chemischen Verbindung, die, bei Licht besehen, ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. CO2 ist überall. Jeder Mensch produziert pro Tag durch die Atemluft ein Kilo Kohlendioxid, also rund 360 Kilogramm pro Jahr; allein durch den Umstand, dass wir atmen müssen, um zu leben, sind das für die Schweizer Bevölkerung bereits zweieinhalb Millionen Tonnen jährlich.
Man erinnert sich aus dem Chemieunterricht, dass CO2 nachgewiesen werden kann durch die Eingabe von CO2-haltigem Gas in eine wässrige Calciumhydroxidlösung, infolgedessen Calciumcarbonat, also Kalk, ausgefällt wird; oder man kann CO2 in Wasser geben und erhält Kohlensäure, und man kann CO2 auch verwenden zur Düngung von Pflanzen in Treibhäusern, als Kältemittel in Klimaanlagen; CO2 wird auch eingesetzt als Blähungsmittel in Abführzäpfchen.
CO2 ist ein extrem flüchtiges Gas, das sich so blitzschnell ausbreitet, dass es bereits auf ein paar Dutzend Metern hinter dem Auspuff eines Autos nicht mehr in erhöhter Konzentration nachweisbar ist. Das Gas verbreitet sich gleichmäßig in der gesamten Atmosphäre – deshalb stammt das CO2 in der Zürcher oder Tessiner oder Tokioter Luft auch aus den Brandrodungen in Malaysia oder aus dem Abendverkehr in Peking, oder aus den Kohlekraftwerken in Polen. Weil CO2 so volatil ist, herrschen über der Sahara und über den weiten Wäldern Sibiriens und über den Seychellen genau dieselben Konzentrationen an CO2 wie über Basel und Rom, auch wenn die Saharaoui und die Einwohner Sibiriens und die Bewohner der Seychellen nur einen Bruchteil des CO2 der Menschen in Industriestaaten emittieren – 20 Tonnen jährlich sind es im Schnitt für einen Einwohner der USA, in der Schweiz sind es 12,5 Tonnen pro Kopf, rechnet man die anderen Treibhausgase in CO2-Äquivalente hoch und bezieht man die importierte »graue Energie« mit ein.
Nüchtern betrachtet, ist CO2 aber einfach ein Gas unter vielen, das wie andere auch mit mehr oder weniger Aufwand, mit mehr oder weniger Energie isoliert, eventuell auch zu einem neuen Rohstoff umgewandelt werden kann. Klaus Lackner erklärte mit bei unserem Gespräch die begrenzenden Faktoren im Ganzen:
»Der eine beschränkende Faktor für ein System, das CO2 aus der Luft saugen würde, ist die einzusetzende Energie – je sparsamer das System funktioniert, desto besser die Effizienz. Am besten werden die Filteranlagen mit erneuerbaren Energien betrieben, mit Sonnenoder mit Windenergie. Der zweite beschränkende Faktor sind die Kosten – das Ganze muss sich wirtschaftlich rechnen, sonst hat es keinen Sinn.«
»Und das bedeutet?«
»Man sollte das einfachste und günstigste Transportmittel für CO2 verwenden, und das ist nun mal der Wind, weil er CO2 überall hin transportiert, über den ganzen Planeten. Weil sich das Gas in der ganzen Atmosphäre gleichmäßig verteilt, ist es auch egal, wo ich es aus der Luft hole – ich muss meine Maschinen einfach dort hinstellen, wo genügend Wind weht.«
»Riesige Filteranlagen in Wüsten, auf Bergkämmen?«
»Genau, wir stellen uns heute große Filteranlagen vor, jeder Filter etwa so hoch und so breit wie ein Container, Dutzende, Hunderte davon, und diese Filter binden das CO2, das in einem weiteren Schritt mit einem Lösungsmittel abgeschieden wird. Am Ende haben wir reines CO2, das via Pipeline an einem sicheren Ort eingebunkert werden kann, in unterirdischen Kavernen, in Gesteinsformationen, die das Kohlendioxid dauerhaft aufnehmen. Deshalb werden wir diese Anlagen sinnvollerweise nicht irgendwo hinstellen, sondern in der Nähe der zukünftigen Bunker.«
»Klingt ziemlich teuer, das Ganze.«
»Teuer ist nicht die Filteranlage an sich, sondern das Lösungsmittel, mit dem das CO2 ausgewaschen und gebunden wird. Aber wie auch immer wir es rechnen, wir sind nie über einen Preis von 30 Dollar pro Tonne CO2 gekommen.«
Umgerechnet auf den heutigen Benzinpreis in den USA würde das bedeuten: Wenn man auf jede Gallone 25 Cent draufschlagen würde, oder etwa 5 Cent pro Liter, gewissermaßen als Entsorgungsgebühr für das emittierte Klimagas, dann könnte das System finanziert werden. Nach und nach sind auch andere Autoren zu diesem Schluss gekommen. David Keith und Kollegen vom Department of Chemical and Petroleum Engineering der Universität Calgary kamen in einer Modellrechnung zum Ergebnis, dass das System bei »marktfähigen« Kosten einen enormen Einfluss auf das globale Klima hätte.
Mit einem Filtereinlass von zehn mal zehn Meter könnten pro Jahr 1000 Tonnen CO2 aus der Luft gefiltert werden – es bräuchte also ziemlich viele dieser Maschinen, um die gesamten Emissionen von CO2 in der Größenordnung von heute rund 35 Milliarden Tonnen pro Jahr bewältigen zu können. Allen Wright, Präsident der Global Research Technologies in Tucson, Arizona, sagte denn auch bereits vor Jahren, man werde rund dreißig Millionen dieser containergroßen Filter benötigen, aufgestellt in Wüsten, am Fuß von Windanlagen, entlang von Autobahnen, in Talsenken, um »einen spürbaren und nachhaltigen Effekt auf das Weltklima zu haben«. Das scheine zwar viel zu sein, fügt er hinzu, aber man müsse bedenken, dass auf der Welt zurzeit fünfzig Millionen Schiffscontainer herumstehen, und keiner störe sich groß daran.
Global Research Technologies war die erste Firma, die sich an die Entwicklung der CO2-Sauger gemacht hat. Im Herbst 2003 traf sich der Milliardär Gary Comer, ein passionierter Segler und Philanthrop, der m...