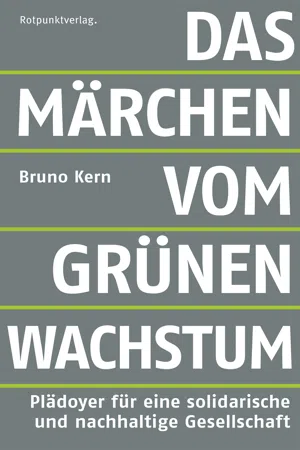![]()
Die Welt im »Zangengriff«
Die Bedrohungsszenarien sind inzwischen hinlänglich bekannt und vielfach veröffentlicht. Ich muss sie deshalb hier nicht im Detail erörtern. Die Computersimulationen werden immer genauer, der wissenschaftliche Beirat der Vereinten Nationen für Klimafragen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) liefert ständig verbesserte Prognosen, die leider keinen Anlass zur Entwarnung geben, im Gegenteil: Die prognostizierten Entwicklungen treten in der Regel schneller ein, als ursprünglich angenommen. Die großen Rückversicherungsgesellschaften, also die Versicherer der Versicherungen, sind in ihrem wirtschaftlichen Interesse unmittelbar von zunehmenden Katastrophen aufgrund der Erderwärmung betroffen und geben deshalb regelmäßig entsprechende Studien in Auftrag. Nach Angaben der Münchener Rückversicherung haben sich etwa die Naturkatastrophen, die durch die Erderwärmung wesentlich mitbedingt sind, seit den 1960er-Jahren verfünffacht. Inzwischen gibt es für die Ernsthaftigkeit der Bedrohung einen unverdächtigen Zeugen: das Pentagon selbst! Unter dem Titel »Yodas apokalyptische Visionen« hat Spiegel online über eine Klimastudie des Pentagon berichtet.1 Die Hauptsorge der Wissenschaftler ist, dass der Klimawandel die Welt innerhalb kürzester Zeit destabilisieren könnte.
Länder mit labilen Regierungen wie Pakistan könnten versucht sein, ihr Nukleararsenal einzusetzen, um sich Nahrung oder Rohstoffe zu erkämpfen. Die Welt könnte in Anarchie versinken – und das nicht erst in tausend Jahren, sondern innerhalb der nächsten drei Dekaden.
Allerdings ist es wichtig, stets im Blick zu behalten: Der Klimawandel ist nur ein Aspekt – wenn auch einer der dramatischsten – einer umfassenden Biosphärenkrise. Der rasante Verlust an fruchtbarem landwirtschaftlich nutzbarem Boden, das Abnehmen der Humusschicht der Erde, die zunehmende Desertifizierung, das heißt Ausbreitung der Wüsten, der Verlust der Artenvielfalt, den uns der Bericht des Weltbiodiversitätsrats jüngst drastisch vor Augen führte,2 und damit einhergehend die zunehmende Instabilität der Ökosysteme, die Abnahme der Fischbestände und damit Nahrungsmittelressourcen in den Ozeanen, die zunehmende Entwaldung – all das ist Teil des fortschreitenden Wegbrechens unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Die ständige Heraufbeschwörung der tatsächlich apokalyptisch anmutenden Szenarien ist nicht sehr hilfreich und hat eher eine lähmende Wirkung. Entscheidend allerdings scheint es mir zu sein, die Dimension der Herausforderung, die zu bewältigen ist, genau in den Blick zu nehmen, um einen klaren Maßstab zu gewinnen, an dem sich politische Lösungsvorschläge zu messen haben. Unredlich wäre es, sich die Zivilisationskrise der Menschheit so lange kleinzurechnen, bis unsere bescheidenen Reformansätze ihr gegenüber als ausreichend erscheinen. Deshalb ist es wichtig festzuhalten, welche Ziele auf keinen Fall unterschritten werden dürfen.
Beschränken wir uns zunächst der Einfachheit halber auf den Klimawandel: International hat man sich darauf verständigt (Pariser Abkommen 2015), dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau beschränkt werden muss, um den Klimawandel noch in einigermaßen kontrollierbaren Grenzen zu halten. Anzustreben seien 1,5 Grad Celsius. Aus den Berichten des Weltklimarates, aber auch aus entsprechenden Analysen von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung3 lässt sich herleiten, dass bis zum Jahr 2050 vom wichtigsten Treibhausgas, nämlich Kohlendioxid, noch ein Budget von etwa 500 Gigatonnen (500 Milliarden Tonnen) verbleibt, das emittiert werden darf. Wenn man nun dieses Budget nach der Maßgabe auf die Weltbevölkerung verteilt, dass jedem Menschen auf der Erde dasselbe Maß an Naturnutzung zusteht (Umweltraum-Konzept von Hans Opschoor), dann bedeutet das etwa für die Bundesrepublik Deutschland mit einem Anteil an der Weltbevölkerung von 1,2 Prozent und einem derzeitigen jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 800 Millionen Tonnen, dass die Kohlendioxidemissionen sofort und dauerhaft auf deutlich weniger als ein Viertel zu reduzieren wären! Ähnliches gilt für die meisten europäischen Industrieländer (für die USA stellt sich diese Situation aufgrund des wesentlich höheren Emissionsniveaus pro Kopf noch verschärft dar). Die selbst gesetzten Klimaziele etwa der Europäischen Union, aber auch der meisten einzelnen Länder sind von dieser Zielvorgabe weit entfernt. Sie können also nicht unseren Maßstab bilden. Dies gilt es bei der Beurteilung politischer Maßnahmen und Strategien stets im Auge zu behalten.
Um einen Anstieg der globalen durchschnittlichen Temperatur um über zwei Grad Celsius zu verhindern, muss die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre auf maximal 400 ppm (parts per million) und das Kohlendioxidäquivalent aller Treibhausgase (zum Beispiel Methan), zusammengenommen, auf maximal 490 ppm stabilisiert werden. Zumindest der erste Wert ist aber bereits erreicht! Das heißt, dass wir neben der raschen und drastischen Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen darauf angewiesen sind, bereits freigesetzte Mengen zu binden und die Kapazität von Kohlendioxidsenken zu vergrößern. Wiederaufforstung im großen Stil, die Neubewässerung von trockengelegten Sumpfgebieten, Neuschaffung von Terra preta und so weiter sind Maßnahmen, die beherzt in Angriff genommen werden müssen. Zu bedenken ist dabei, dass dies Flächen in Anspruch nimmt, die dann anderweitig nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit äußerster Skepsis ist allerdings das geo-engineering zu betrachten, das heißt die Beeinflussung des Klimas beziehungsweise bestimmter Klimafaktoren durch großtechnische Eingriffe wie etwa den Eintrag von Schwefelpartikeln in die Atmosphäre, das Anbringen riesiger das Sonnenlicht reflektierender Flächen aller Art oder die »Düngung der Ozeane« durch Eisenspäne. Diese Methoden wären, in die Tat umgesetzt, völlig unverantwortliche Großexperimente mit höchst ungewissem Ausgang und werfen zudem äußerst delikate geopolitische Fragen auf. Auch CCS (carbon capture and sequestration = CO2-Abscheidung und -Speicherung) mit unterschiedlichen chemischen Verfahren ist nicht der Königsweg. Abgesehen davon, dass die entsprechenden Verfahren sich noch in frühen Entwicklungsstadien befinden, sind sie nur sinnvoll anwendbar an großen Kohlendioxidquellen (Kraftwerken). Sie erhöhen zudem zunächst den Energiebedarf erheblich, vor allem aber ist die Frage der sicheren Endlagerung des Kohlendioxids in großem Stil völlig ungelöst. Den künftigen Generationen könnte hier, ähnlich wie im Fall der Atomenergie, ein nicht zu verantwortendes Risiko aufgebürdet werden.4
Die noch vorhandenen fossilen Bodenschätze binden schätzungsweise etwa 15 000 Gigatonnen Kohlendioxid. Das heißt: Ausgehend vom Gesamtbudget an Kohlendioxid, das wir maximal noch emittieren dürfen, müssen etwa 70 Prozent der Kohle, 30 Prozent des Erdgases und 30 Prozent des noch vorhandenen Erdöls im Boden bleiben, um das Weltklima innerhalb kontrollierbarer Grenzen stabil zu halten! Das Ende des fossilen Zeitalters ist inzwischen endgültig eingeläutet.
Allerdings: Diese »normative Knappheit« der fossilen Ressourcen, das heißt die Tatsache, dass sie schlicht nicht mehr verbrannt werden dürfen, wird begleitet von einer immer stärker spürbaren faktischen Knappheit! Wenn auch der Prozess der allmählichen Erschöpfung dieser nicht erneuerbaren fossilen Energiequellen nicht schnell genug voranschreitet, dass sich damit das Problem der Erderwärmung quasi von selbst lösen würde, und unser politisches Handeln deshalb nicht ersetzen kann, so schränken sich unsere Handlungsspielräume dadurch zunehmend ein. Zu bedenken ist auch: Andernorts, nämlich im globalen Süden, ist die Knappheit der fossilen Ressourcen längst im Alltag spürbar. Der Blick der reichen Industrieländer, die über genügend Kaufkraft verfügen, um sich die knapper werdenden Ressourcen in überproportionalem Maß anzueignen, ist in dieser Hinsicht getrübt.
Die kapitalistische Weltwirtschaft hängt immer noch zu mehr als 80 Prozent von nicht erneuerbaren Energiequellen ab. Sie deckt, Angaben der Internationalen Energieagentur zufolge, ihren Primärenergiebedarf zu 35 Prozent aus Erdöl, zu 25 Prozent aus Kohle, zu etwa 20 Prozent aus Erdgas und zu etwa 6 Prozent aus Atomenergie. Gerade Erdöl ist für das internationale Transportsystem und damit für den global integrierten Kapitalismus mit seiner etablierten internationalen Arbeitsteilung essenziell. Der »Peak« der Erdölförderung, zumindest was die konventionellen Ölfelder betrifft, ist inzwischen erreicht.5 Darüber kann auch der nun bereits einige Jahre anhaltende Fracking-Boom in den USA nicht hinwegtäuschen, im Gegenteil: Im Grunde ist dieser verzweifelte Versuch, mit großem finanziellem und energetischem Aufwand und unter Inkaufnahme von großen Umweltschäden im Gestein abgelagertes Öl und Gas herauszusprengen, die Bestätigung dafür, dass diese Ressource nun zur Neige geht. Bei der Erschließung unkonventioneller Quellen, etwa der kanadischen Ölsande, ist es fraglich, wie hoch der Nettoenergieoutput noch ist, wenn man den energetischen Aufwand der Erschließung, der Aufbereitung, des Transports und so weiter in die Bilanz miteinbezieht – von den verheerenden Umweltschäden ganz zu schweigen.
Welch gravierende Auswirkungen die zunehmend spürbare Knappheit von Erdöl auf die Ökonomie haben kann, darüber belehrt uns eine sicherheitspolitische Studie der deutschen Bundeswehr: »Der Peak Oil kann dramatische Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Das Ausmaß dieser Konsequenzen wird sich – nicht nur, aber eben auch – durch einen Rückgang des Wachstums der Weltwirtschaft messen lassen. […] Ein ökonomischer Tipping Point besteht dort, wo – zum Beispiel infolge des Peaks – die Weltwirtschaft auf unbestimmte Zeit schrumpft. In diesem Fall wäre eine Kettenreaktion die Folge, die das Wirtschaftssystem destabilisiert […]. Mittelfristig bricht das globale Wirtschaftssystem und jede marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft zusammen […]. Eine auf unbestimmte Zeit schrumpfende Wirtschaftsleistung stellt einen höchst instabilen Zustand dar, der unumgänglich in einem Systemkollaps endet. Die Sicherheitsrisiken einer solchen Entwicklung sind nicht abzuschätzen […].«6
Auch die anderen wesentlichen fossilen Energiequellen (Erdgas, Kohle) gehen schneller zur Neige, als man noch vor einigen Jahren annehmen durfte. Die Energy Watch Group Germany geht etwa davon aus, dass bis zum Jahr 2050 nur noch ein Drittel der heute jährlich geförderten Erdölmenge zur Verfügung stehen wird. Bei Erdgas sei ab 2035 eine längere Phase der Stagnation des Fördervolumens zu erwarten, bis dann im Jahr 2045 die Fördermenge rapide abnimmt. Und selbst bei Kohle sei ab dem Jahr 2035 mit einem steilen Abfall der Förderung zu rechnen. Das Fördermaximum aller fossilen Energieträger zusammengenommen wird für das Jahr 2025 prognostiziert.7
Die Situation, in der wir uns befinden, kann man zutreffend als eine »Zangengriffkrise« bezeichnen:8 Wir sind gleichsam gefangen zwischen der drohenden Gefahr der Klimakatastrophe einerseits und der immer deutlicher spürbar werdenden Erschöpfung der fossilen Energiequellen und anderer wichtiger Ressourcen wie mineralischer Rohstoffe andererseits. Wenn man die beiden Seiten des Dilemmas nicht gleichzeitig im Auge behält, dann wird man sich zwangsläufig in eine Sackgasse verlaufen und »Lösungen« anstreben, die an dieser Situation völlig vorbeigehen. Paradigmatisch dafür sind zwei prominente Studien, deren grundsätzliche Schwäche darin liegt, dass sie jeweils eine Seite des Dilemmas aus den Augen verloren haben: Der Hirsch-Report, den Robert Hirsch im Auftrag des US-Energieministeriums erstellt hat, stellt eine Peak-Oil-Strategie dar, die den Klimawandel völlig ausblendet. Die Lösungsvorschläge konzentrieren sich darauf, das fossile Zeitalter möglichst lange zu strecken beziehungsweise die auf fossiler Energie basierende Infrastruktur möglichst lange aufrechtzuerhalten, zum Beispiel durch Treibstoffgewinnung aus Kohleverflüssigung.9 Anders der prominentere Stern-Report, von Nicholas Stern im Auftrag der britischen Regierung erstellt. Seine Modelle zur Finanzierung von Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen, unterstellen ein Wirtschaftswachstum, das nur auf der Basis einer weiteren uneingeschränkten Verfügbarkeit von fossiler Energie möglich ist.10 Beide Studien sind auf einem (dem jeweils anderen) Auge blind, ihre Lösungsvorschläge daher unrealistisch und unbrauchbar.
Die Erschöpfung mineralischer Rohstoffe, die teilweise für unsere Infrastruktur, unsere technische Ausrüstung und unseren Lebensstil schier unverzichtbar sind, verschärft die Situation erheblich. Während Metalle wie etwa Eisen oder Bauxit in dieser Hinsicht unproblematisch sind, weil sie in ausreichender Menge und leicht abbaubar in der Erdkruste vorhanden sind, ist die Lage hinsichtlich anderer Metalle äußerst prekär. Die künftige Knappheit macht sich teilweise bereits bemerkbar. Daten des US Geological Survey11 zeigen, dass zum Beispiel für Kupfer, Zink, Platin, Kadmium, Zinn, Chrom, Molybdän und Nickel der »Peak«, also der Förderhöhepunkt, ab dem die Förderung dann kontinuierlich abnimmt, in den nächsten drei bis vier Jahrzehnten erreicht sein wird. Die Knappheit betrifft Metalle, die kaum aus unserer Infrastruktur wegzudenken sind, wie etwa Kupfer, das wegen seiner hohen Leitfähigkeit in der Verteilung von Strom und Daten, aber auch im Baubereich Anwendung findet. Sie betrifft aber auch Metalle und sogenannte seltene Erden, die gerade für die Umstellung auf erneuerbare Energien wesentlich sind und teilweise als nicht substituierbar gelten (Kadmium und Neodym im Bereich der Solar- und Windenergie, Lithium für Batterien, Platin für Brennstoffzellen).
In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass es Grenzen des Recyclings gibt. Metalle werden oft so dissipativ verwendet (z. B. Zink in Lacken), dass kein Recycling möglich ist. In vielen anderen Fällen ist ein Recycling zwar grundsätzlich möglich, wäre aber mit einem zu großen Energie- und Rohstoffverbrauch verbunden, um noch wirtschaftlich sinnvoll zu sein. Den Autoren eines Berichts an den Club of Rome zufolge gingen seinerzeit im Schnitt 70 Prozent der jährlichen Metallproduktion nach einmaligem Gebrauch verloren. Von den 3 Prozent, die recycelt werden, sind demnach nach zehn »Lebenszyklen« nur noch 0,1 Prozent im Einsatz.12 Trotz des relativen Alters dieses Berichts dürfte sich an der Situation grundsätzlich wenig geändert haben. Der heute viel höhere Einsatz von Verbundstoffen (etwa in der Automobilproduktion) verschärft das Problem noch. Täuschen lassen darf man sich auf keinen Fall von offiziell angegebenen Recyclingquoten (etwa beim Plastikmüll), die sich lediglich auf die Messung des Inputs einer Anlage beziehen und keinen Aufschluss über die tatsächliche stoffliche Wiederverwertung geben. Natürlich kann die Recyclingrate durch technische Entwicklung und steigende Preise verbessert werden, aber Recycling kann das Problem nur aufschieben, nicht lösen.
Ökokapitalistische Illusionen
Der Mythos der Informations- und
Dienstleistungsgesellschaft
In den Kernländern der kapitalistischen Weltwirtschaft machen sogenannte Dienstleistungen zwei Drittel des ...