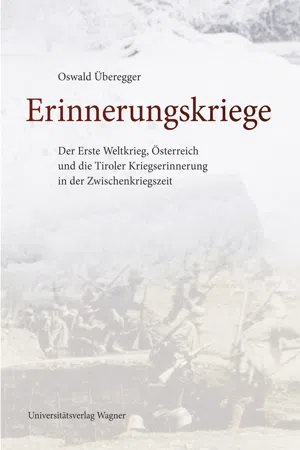![]()
1. Einleitung
Die Erforschung der regionalen Geschichte des Ersten Weltkrieges ist in den letzten Jahren auch und besonders in Tirol weit fortgeschritten. Von der bis in die 1980er Jahre vorherrschenden klassischen Betrachtungsweise, die sich vor allem der Operationsgeschichte des Gebirgskrieges und – allzu oft – der Verklärung seiner Protagonisten verschrieben hatte, verschob sich der Fokus hin zur Erforschung der so genannten ‚Heimatfront‘.1 Die international und besonders in Deutschland ab Ende der 1980er Jahre prosperierende Alltags- und Mentalitätsgeschichte des Krieges2 sowie die neue ‚Militärgeschichte von unten‘3 beeinflussten auch die österreichische respektive Tiroler Weltkriegsforschung, die sich im internationalen Vergleich allerdings relativ spät neueren Forschungsinteressen zuwandte.
Die kriegsspezifischen, teilweise sehr konfliktreichen Beziehungen zwischen Staat, Militär und Gesellschaft, das Entstehen und die Auswirkungen der staatlichen Kriegs- und Mangelwirtschaft sowie – damit verbunden – die soziale Situation der Kriegsgesellschaft, der Komplex der vielgestaltigen Zwangsmaßnahmen des autoritären Kriegsstaates und die Rolle gesellschaftlicher Akteure und Kollektive im Krieg standen in den letzten Jahren im Mittelpunkt der Forschungen über Tirol im Ersten Weltkrieg.4
So differenziert und in gleichem Maße allumfassend die regionale Beschäftigung mit der Geschichte des Krieges auf den ersten Blick auch scheinen mag, werden bei näherer Betrachtung und im Kontext der neuesten Trends der internationalen Weltkriegsforschung doch auch merkliche Defizite sichtbar. Nach wie vor fehlt es auch für den zivilen Raum abseits der Fronten an Arbeiten, die stärker auf die erfahrungsgeschichtliche Ebene rekurrieren. Besonders bedauerlich erscheint die Tatsache, dass es auch in Tirol bisher an theoretisch-methodisch fundierten ‚Mikrogeschichten‘ fehlt, die unterhalb der stets fokussierten regionalen Räume auf lokaler, familialer oder individueller Ebene die mentalitäts- und erfahrungsgeschichtliche Dimension gewissermaßen ‚vor Ort‘ ausloten.5
Neben dem fehlenden mikrogeschichtlichen Blick stellt die forschungspraktisch bedingte starke Separierung der beiden Erfahrungsebenen von ‚Front‘ und ‚Heimat‘ ein weiteres Defizit dar. Sie ist letztlich auch eine Folge der oftmals überschätzten kriegsbedingten ‚Entfremdung‘ ziviler und militärischer Lebenswelten. Die Analyse von ‚Front‘ und ‚Heimat‘ als vielschichtige, miteinander verbundene Erfahrungs-, Erwartungs- und Sehnsuchtsräume bildet weiterhin ein Desiderat der Forschung. In diesem Zusammenhang könnte man sich etwa die Frage stellen, welche Brüche und Kontinuitäten es in der raum- und funktionsspezifischen Wahrnehmung von Front und Heimat gab.6
Die Fokussierung der zivilen Seite in der Erforschung der regionalen Geschichte des Ersten Weltkriegs brachte es nolens volens mit sich, dass die Perspektive des soldatischen Kriegserlebnisses letzthin etwas außerhalb des Blickwinkels der Forschenden geriet. Obwohl in den letzten Jahren einige Studien entstanden, fehlt es bisher an einer modernen Erfahrungsgeschichte der Tiroler Weltkriegssoldaten, die sich an aktuellen theoretisch-methodischen Vorgaben orientiert.7 Die bestehenden Studien – es handelt sich meist um universitäre Abschlussarbeiten – kommen für gewöhnlich über den Typus einer sehr konventionell und deskriptiv gehaltenen klassischen Alltagsgeschichte – meist als soldatische Leidens- und Passionsgeschichte verstanden – nicht hinaus.8 Die ganze Bandbreite der Gewalterfahrung und der eigentliche Akt des Tötens als Gewaltausübung spielen darin kaum eine Rolle. Im Zentrum stehen die Soldaten „als Befehlsempfänger, als leidende und passive Objekte der kriegerischen Gewalt und des militärischen Repressionssystems“.9
Neben der fehlenden Mikroperspektive, der zu starken Separierung kaum sinnvoll zu trennender Erfahrungsräume und der Vernachlässigung des soldatischen Kriegserlebnisses bildet die meist mit dem Ende der militärischen Auseinandersetzungen im November 1918 abreißende Perspektive der Untersuchungszeiträume zweifellos ein weiteres Manko. Die Nachkriegszeit ist in Wirklichkeit nicht ohne den Krieg zu verstehen. Soziale, mentale und psychosoziale Veränderungsprozesse wurzeln mit unterschiedlicher Intensität in den Kriegsereignissen und -erlebnissen. Erlebter Krieg und gegenwärtiges (Nachkriegs-)Handeln interagieren im Rahmen der Aktualisierungs- und Vergegenwärtigungsprozesse des in Erinnerung gerufenen Krieges auf vielfältige Weise. Mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Geschichtsschreibung ist gewissermaßen ein doppeltes Defizit zu konstatieren: Zum einen enden die Studien, die sich mit der Kriegszeit beschäftigen, mehr oder weniger abrupt mit dem Kriegsende. Zum anderen lässt sich auch innerhalb der österreichischen Geschichtsschreibung zur Ersten Republik beobachten, dass der Krieg als zentrales Ereignis und Erlebnis, das die individuellen Handlungsdispositionen vielfach entscheidend tangierte und Einfluss auf die Lebenswelten der Nachkriegszeit nahm, nicht gebührend oder lediglich sehr oberflächlich bzw. beiläufig berücksichtigt wird.
Im Zentrum dieser Studie steht die bisher – das gilt für Österreich gleichermaßen wie für Tirol – in der Forschung vernachlässigte Kriegserinnerung der Zwischenkriegszeit. Sie versucht darzustellen, wann, warum und in welcher Weise Individuen, Institutionen oder gesellschaftliche Gruppen den vergangenen Krieg zum Gegenstand gegenwärtiger Betrachtungen machten. Und sie will veranschaulichen, über welche Medien des Gedächtnisses diese Aktualisierungsprozesse erfolgten. Die mentalen und psychosozialen Auswirkungen der Weltkriege für die Gesellschaftsentwicklung stellen in Österreich ein noch weitgehend unerforschtes Terrain dar. Noch sehr viel mehr als für den Zweiten Weltkrieg gilt dieser Befund für den Ersten Weltkrieg. Wissenschaftliche Untersuchungen über die Frage, welche Bedeutung dem erinnerten Krieg als Kategorie mentaler Gesellschaftsentwicklung im Frieden zukam, fehlen bisher ebenso wie Forschungsbemühungen, die sich mit der ineinandergreifenden Bedeutung von erinnerungskulturellen Residuen, wissenschaftlicher Aufarbeitung der Kriegsgeschichte und verarbeitendem Umgang mit dem Krieg nach 1918 auseinandersetzen.
Die Studie beschäftigt sich auf mehreren Ebenen eingehend mit den nach 1918 entstehenden Erinnerungskulturen des Krieges. Neben der politischen und militärischen Konstruktion der Kriegserinnerung sollen vor allem auch die erinnerungskulturellen Entwicklungstendenzen und die konkrete Bedeutung des erinnerten Krieges für die Nachkriegsgesellschaft analysiert werden. Ausgehend von den öffentlichen politischen bzw. militärischen Projektionen historischer Kriegserinnerung soll untersucht werden, inwiefern sich derartige Deutungsangebote erinnerungskulturell sedimentiert haben und wie bzw. in welcher Weise diese Wissensvermittlung konkret im lebensweltlichen Umfeld entstanden ist bzw. transportiert und aufgenommen wurde.
Die theoretisch-methodische Grundkonzeption der Arbeit basiert dabei auf verschiedenen Prämissen:
1. Der Untersuchungsraum dieser Arbeit beschränkt sich auf das Gebiet des Bundeslandes Tirol in den heutigen Grenzen (Nord- und Osttirol). Die im Sinne eines regionalen Vergleichs äußerst spannende Mitberücksichtigung Südtirols und des Trentino10 musste aus forschungspraktischen Gründen unterbleiben. Der Vergleich von drei sich sehr unterschiedlich entwickelnden regionalen Erinnerungskulturen hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt, innerhalb welchem die Arbeiten für diese Studie abgeschlossen werden mussten. Die einzelnen Fallstudien der Arbeit fokussieren in erster Linie die angesprochene regionale Ebene, versuchen allerdings innerhalb des regionalen Fokus mehr oder weniger dynamisch die in lokalen Zusammenhängen wirksam werdenden mikrosozialen Erinnerungsprozesse auf der einen Seite und die nationalen ‚Rahmenbedingungen‘ des Erinnerns auf der anderen Seite im Blickfeld zu behalten. Kriegserinnerung lässt sich als Prozess und Vorgang nur verstehen, wenn man keine der angesprochenen Ebenen verabsolutiert bzw. ausklammert.
2. Die Studie sieht sich einer Art „Sozialgeschichte des Erinnerns“11 verpflichtet, der es um eine möglichst breite Berücksichtigung verschiedener gesellschaftlicher Erinnerungsakteure geht – wenngleich auch diese Studie natürlich exemplarisch bleiben muss. Innerhalb der hier postulierten Erinnerungsgeschichte geht es vor allem um das zentrale Spannungsfeld von öffentlichen und ‚privaten‘ Kriegsdeutungen, wobei der Kriegserinnerung ländlicher Bevölkerungsschichten besondere Bedeutung beigemessen wird. Eine Leitfrage, die sich wie ein roter Faden durch mehrere Kapitel dieser Arbeit zieht, ist die Frage nach dem unterschiedlichen Gehalt von öffentlich inszenierter Kriegserinnerung und individuellen Erinnerungsmustern und jene nach den Veränderungsprozessen, denen sie unterlagen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Kompatibilität der Deutungsinhalte der verschiedenen Erinnerungsformen und nach der Herausbildung hegemonialer bzw. alternativer Kriegsgedächtnisse. Ziel des Projektes ist es vor allem, die Entwicklung der Kriegserinnerung im lebensweltlichen Kontext zu untersuchen, um Informationen über die konkrete Verarbeitung des Krieges zu gewinnen. Wie vollzog sich der Kampf um die Deutungsmacht des Krieges nach 1918? Gab es innerhalb der popularen Ebene historischer Kriegserinnerung so etwas wie konkurrenzierende Deutungsmuster? Lassen sich milieuspezifische (politische und soziale Milieus) Deutungsmuster festmachen?
3. Die Studie zielt auf die Berücksichtigung der breiten Varianz der Medien des Kriegsgedächtnisses. Ein Defizit der bisherigen regionalen (und nationalen) Erforschung der Erinnerungskulturen des Krieges stellt die schier exklusive Betrachtung einzelner ‚Erinnerungsorte‘ und einzelner Medien des Kriegsgedächtnisses dar – allen voran des Kriegerdenkmals. Diese Arbeit hingegen versucht nicht ein bestimmtes Medium des Kriegsgedächtnisses gleichsam exemplarisch in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, sondern die diskursiv bzw. symbolisch produzierten „Erinnerungsfiguren“12 und die Aktivität der zentralen Erinnerungsträger eines regional begrenzten Territoriums. Eine ausgewogene Berücksichtigung verschiedener Erinnerungsmedien, Erinnerungsträger und der von ihnen konstruierten Erinnerungsfiguren bietet die Gewähr dafür, dass die komplexe Gemengelage des regionalen Erinnerungsgeschehens zutreffender erfasst wird.
4. Methodisch orientiert sich die Studie an der neueren geschichtswissenschaftlichen Erinnerungsforschung, die in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Diskussionsbeiträgen und Denkanstößen zur historischen Erinnerungsforschung hervorgebracht hat, und an der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung.13 Wo immer es möglich und sinnvoll erschien, versucht die Studie den territorialen Bezugsrahmen der Arbeit nicht isoliert zu betrachten, sondern den Vergleich mit anderen regionalen Räumen zu suchen. Aufgrund der schlechten Forschungslage in Österreich sind es vor allem sich auf Deutschland beziehende Vergleichsstudien, die für diese Studie herangezogen wurden.14
Am Beginn dieser Arbeit steht die Beschäftigung mit den zentralen Erinnerungsfiguren des Krieges, die in der politischen und medialen Öffentlichkeit der Zwischenkriegszeit eine Schlüsselrolle spielten. Die Kriegsschuldfrage, die Debatten über die Schuld an der Niederlage sowie die Frage, ob das, was im November 1918 geschah, wirklich eine militärische ‚Niederlage‘ war, beschäftigten nicht nur die österreichische, sondern auch die Tiroler Öffentlichkeit nach 1918 in intensiver Weise. Diesem einleitenden Kapitel, das vor allem die grundsätzlichen Erinnerungsdebatten und -politiken im öffentlichen Raum verständlich machen will, folgt eine ausführliche Betrachtung der ‚militärischen Erinnerungskulturen‘. Die Rolle der ehemaligen k.(u.)k. Offiziere im ‚Erinnerungskulturkampf‘ der Ersten Republik und die Bedeutung und Wirkmacht der von ihnen dominierten Kriegsgeschichtsschreibung werden ebenso analysiert wie etwa die Rolle der organisierten Veteranen und das Verhältnis zwischen letzteren und dem neuen Bundesheer der Ersten Republik. Eine Analyse der ländlichen Kriegserinnerung der Heimkehrer vor Ort zeigt, dass auch die stets bemühten Deutungsetiketten einer ‚Radikalisierung‘ und ‚Brutalisierung‘ mit Vorsicht zu genießen sind. Das Kriegserlebnis, so die entwickelte These, hat die regionale Gesellschaft insgesamt weit weniger ‚brutalisiert‘ und ‚radikalisiert‘ als vielfach angenommen.
Anschließend erfolgt eine Analyse der regionalen symbolischen Erinnerungslandschaften. Ihr geht es vor allem um eine Problematisierung des Wesens der von der Denkmalkultur der Zwischenkriegszeit ausgehenden Erinnerungsimpulse. Die Befunde relativieren letztlich die zentrale Bedeutung, die dem Kriegerdenkmal für die Verarbeitung des Krieges in der Literatur stets zugeschrieben wird. Über die klassische Analyse der Formensprache der Kriegerdenkmäler hinaus, versucht die vorgenommene Mehrebenen-Analyse auch zur diskursiven Semiotisierung der Denkmäler im Rahmen der Repräsentation des Gefallenengedenkens und der Konstruktion des Gefallenen vorzustoßen sowie die öffentliche Denkmal-Erinnerung mit anderen Gruppengedächtnissen zu kontrastieren. Dieser Vergleich zeigt, dass die Denkmal-Erinnerung viele Bevölkerungsschichten nur mittelbar oder teilweise auch gar nicht erreicht hat und die von ihr ausgehenden Botschaften sehr unterschiedlich aufgenommen wurden.
Noch während des Krieges, vor allem gegen Ende des Krieges, entstand der Topos der ‚undankbaren Heimat‘ als Teil der Dolchstoß-Legende. Die diffusen Klagen der Kriegsheimkehrer über die vermeintliche ‚Undankbarkeit‘ der Heimat dienten im zeitgenössischen und – später – im historiographischen Diskurs häufig als Referenzpunkt und Beweis für die teilweise gescheiterte Reintegration der Heimkehrer. Letztere nährte die historiographischen Radikalisierungs- und Brutalisierungsdiskurse oder verleitete zur vorschnellen Verortung diverser ‚Männlichkeits-Krisen‘. Die Studie versucht in einem eigenen Kapitel über den Topos der ‚undankbaren Heimat‘ seine Entstehungsgeschichte nachzuvollziehen. Dabei zeigt sich, dass die Vorwürfe primär militärelitären Deutungsmustern heimkehrender Offiziere entsprangen. Nicht die individuelle Flucht in die Radikalisierung, ‚Brutalisierung‘ oder andere Krisen war im Übergang vom Soldaten zum Zivilisten die Regel, sondern die vielfach erfolgreiche Reintegration in die vertraute ländlich-lokale Lebenswelt oder die Rückkehr zum gewohnten und ersehnten zivilen Alltagsleben.
In diesem Reintegrationsprozess spielten die Kirche und die religiösen Strategien zur Reintegration der Heimkehrer eine ...