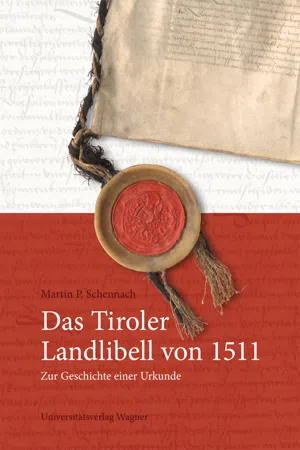![]()
V. Die Rezeption des Landlibells
1. Die Prägung eines Eigennamens
Der Beschluss des Innsbrucker Junilandtags 1511 wurde seinem Rechtscharakter entsprechend zunächst auch als ein solcher betrachtet und bezeichnet. Im Juli und August desselben Jahres ist dementsprechend ausdrücklich vom Innsbrucker Landtagsabschied die Rede.1 Selbst nach der Ausfertigung der Kaiserurkunde änderte sich zunächst nichts an dieser Sichtweise. Wenn in den Folgejahren im Zusammenhang mit dem Rezess vom 23. Juni 1511 von „Ordnung“, „Landesordnung“ oder „Libell“ die Rede ist, werden damit Termini verwendet, die damals ganz allgemein als Synonyme für einen Landtagsabschied galten. Bis Mitte der zwanziger Jahre war die Bezeichnung eines Landtagsschlusses als „Libell“, „Ordnung“ oder „Landesordnung“ durchaus gängig und keineswegs auf inhaltlich vermeintlich herausragende Landtagsrezesse beschränkt, handelte es sich doch stets um von Landständen und Landesfürst gemeinsam für das Land vorgenommene Regelungskomplexe. Um den Landtagsabschied vom Juni 1511 eindeutig zu identifizieren, wurden daher häufig – keineswegs immer – Präzisierungen vorgenommen, indem beispielsweise vom versigleten libell[s],2 vom kayserlichen libell[s],3 von der versiglten gemainer lanndsordnung, [die] an dem dreyundzwainzigisten tag Juny in dem aindlefften jar auf gehallten lanndtag durch gemaine lanndtschafft beslossen ist,4 von der ordnung, wie es in feindsnoten, zuezug und aufpoten mit ainer lanndtschafft gehalten werden solle,5 von der lanndsordnung, so in dem kayserlichen libell begriffen6 oder von der landsordnung zu widerstanndt der veind7 gesprochen wird. Dabei wird zumeist der Akzent auf die äußere Form und die Art des Zustandekommens gelegt, in manchen Fällen hingegen auf den Inhalt.
Ab der Mitte der zwanziger Jahre und speziell nach der Publikation der Tiroler Landesordnung von 1526 kam es zu markanten Bedeutungsveränderungen. Der Terminus „Landesordnung“ bezeichnete fortan ausschließlich die von Ferdinand I. erlassene Kodifikation. Gleichzeitig kam das Kompositum „Landlibell“ auf, das sich jedoch nicht etwa auf die Urkunde vom 23. Juni 1511 bezog, sondern ebenfalls auf das kodifikatorische Werk der Tiroler Landesordnung von 1526 bzw. der reformierten Landesordnung von 1532.8 Wenngleich dieses sogar die Selbstbezeichnung „Landesordnung“ führte, schien sich im Schriftverkehr zunächst der Begriff „Landlibell“ durchzusetzen. Als Anfang der dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts eine grundlegende Novellierung der Landesordnung von 1526 diskutiert wurde, war in diesem Zusammenhang praktisch ausschließlich von der reformierung des tirolischen lanndtlibells die Rede.9 Alternativ wurde statt vom „Landlibell“ sehr vereinzelt vom lanndordnung-libell gesprochen.10 Allerdings kam es hier in den Folgejahren ebenfalls zu einer allmählichen Verlagerung: Immer häufiger wurde das Gesetzbuch aus dem Jahr 1532 nunmehr tatsächlich als „Landesordnung“ angesprochen; demgegenüber trat die Bezeichnung „Landlibell“, die um 1530 noch dominiert hatte, immer mehr in den Hintergrund.11 Die letzte bekannte Verwendung von „Landlibell“ zur Bezeichnung der Tiroler Landesordnung datiert aus dem Jahr 1544.12
Festzuhalten ist: Als „Landlibell“ wurde damals nie der Landtagsabschied vom Juni 1511, sondern ausschließlich die Landesordnung von 1526 und anschließend die reformierte Landesordnung von 1532 tituliert.
Erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts kam die kurze, prägnante Bezeichnung aindliffjähriges (elfjähriges) Landlibell zur Kennzeichnung der über den Landtagsabschied vom Juni 1511 ausgestellten Kaiserurkunde auf,13 wobei das Attribut „elfjährig“ schlichtweg auf das Jahr der Entstehung Bezug nahm. Diese Präzisierung war notwendig, konnte jedoch auch in anderer Form erfolgen. Als auf dem Bozner Landtag des Jahres 1544 im Zusammenhang mit dem Landtagsabschied des Jahres 1511 erstmals vom „Landlibell“ die Rede war, wurde dies sogleich genauer umrissen und auf die darin enthaltene Regelung der Mannschaftsrepartierung zwischen den Landständen hingewiesen.14 Die nächsten Belege für die Bezeichnung „elfjähriges Landlibell“ finden sich in den Landtagsverhandlungen des Jahres 1547, wobei aus dem Kontext die Bezugnahme auf den Landtagsabschied vom Juni 1511 klar hervorging.15 In anderen Fällen schien dies freilich nicht so deutlich, so dass in den nächsten Jahren immer noch alternative Bezeichnungen vorkamen. Ein 1551 von der Regierung und der Kammer gemeinsam verfasstes Gutachten spricht von ordnung und vergleichung, so im 1511. jar von wegen des zuzugs in ainer lanndtsnott gemacht worden sei.16 In einem um 1559 entstandenen Konzept eines Regierungsgutachtens war zunächst noch von dem aindlifjerigem libell die Rede, was dem Schreiber offensichtlich bei nochmaliger Lektüre nicht bestimmt genug erschien. Er strich die ursprünglich gewählte Bezeichnung durch und ersetzte sie durch das vertragslibell im 1511. jar aufgericht.17 Dagegen sprach schon drei Jahre zuvor ein Regierungsgutachten durchgehend vom aindliffjährigen libell oder aindliffjährigen vertragslibell.18 Ab den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts hatten sich „elfjähriges Libell“ bzw. „Landlibell“ schließlich definitiv durchgesetzt.
Nur zwei Parteien, die 1511 am Zustandekommen des Landtagsabschieds beteiligt gewesen waren, vermieden es ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zur Säkularisation 1803 tunlichst, von einem „Landlibell“ zu sprechen, sondern bevorzugten (nahezu durchgehend) Bezeichnungen wie „Bündnis“, „Bund(libell)“, „Bündnisvertrag“, „Einigung“, „foedus“, „confoederation“ oder schlichtweg „Vertrag“, um jene Urkunde zu bezeichnen. Diesen Sprachgebrauch wählten die Repräsentanten und juristischen Berater der Hochstifte Trient und Brixen.19 Für sie musste es vor dem Hintergrund der sich bis in das 18. Jahrhundert hinziehenden Diskussionen über ihre Reichsunmittelbarkeit und über die Stellung Brixens und Trients zur Gefürsteten Grafschaft Tirol und zu den Habsburgern darum gehen, die Selbständigkeit der Hochstifte mit Nachdruck zu betonen. Der Ausdruck „Landlibell“ impliziert die Geltung für ein Land, und diesem Land – der Grafschaft Tirol – war man nicht zugehörig. Durch das Sprechen von einem „Bündnisvertrag“ akzentuierte man demgegenüber die Stellung der Hochstifte als gleichberechtigte Vertragspartner und damit ihre Unabhängigkeit und Reichsunmittelbarkeit.20 Diese unterschiedliche Bezeichnung derselben Urkunde wurde von den Hochstiftern in ihrer Konfrontation mit den Habsburgern sogar ausdrücklich thematisiert: Grundsätzlich wurde das kaiserliche Diplom ihrerseits als „Ainigung und Vertrag“ klassifiziert, als ein „Vergleich“, der „respectu der Stiffter als freyen Reichs-Stend ain Pund-Libell, respectu der Tyrol. Landt-Stendt (weillen etliche Absatz darinnen sich erfünden, so sie allein und die Stifft ganz nichte […] beriehren) ain Landt-Libell intituliert werden mag.“21 Damit wurde der tirolerseits ventilierten und am Eigennamen „Landlibell“ festgemachten Behauptung widersprochen, dass es sich beim Diplom Maximilians um nichts anderes als einen besiegelten Landtagsabschied handle, der des Vertragscharakters entbehre.22
2. Die „Wiederentdeckung“ des Landlibells um 1550
Die Prägung des Eigennamens „Landlibell“ zur Bezeichnung der Kaiserurkunde über den Landtagsrezess vom 23. Juni 1511 ging Hand in Hand mit der in diesem Zeitraum einsetzenden Instrumentalisierung des Landlibells durch die Landstände, die es ab der Mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend ins Treffen führten, um einerseits im Bereich der Landesdefension weitergehende Anforderungen des Landesfürsten an die militärische und finanzielle Leistungskraft des Landes abzuwehren und um andererseits ständeinterne Diskussionen über die Verteilung der Steuerlast zu unterbinden.23
Demgegenüber sind Rekurse auf das später so genannte Landlibell in den frühen Regierungsjahren Ferdinands I. sehr selten. Hatte die Kaiserurkunde in den späten Jahren der maximilianeischen Herrschaft noch jene Verwendung gefunden, die die Landstände bei ihrem Drängen nach einer Urkundenausfertigung im Auge gehabt hatten – um durch wiederholte Verweise auf die darin enthaltenen kaiserlichen Zusagen nachdrücklich deren Einhaltung reklamieren zu können –, sind Bezugnahmen auf das Landlibell in den zwanziger und dreißiger Jahren bemerkenswert rar. Im Bereich des Steuerwesens war noch keineswegs klar, dass die im Landlibell enthaltene Repartition des Steueraufkommens auf die vier Stände und die beiden Hochstifte dauerhafte Geltung behalten würde.24 Immerhin wurde auf dem Innsbrucker Landtag 1525 statuiert, dass der Anschlag der Mannschaften nach dem Inhalt aines aufgerichten versiglten kayserlichen libells erfolgen sollte,25 und 1527 wurde auf einem Landtag festgelegt, dass der Zuzug gemäß den Bestimmungen des aufgerichten kayserlichen libells zu erfolgen hat.26 Das Landlibell war nicht vergessen. Aber es spielte in den politischen Diskussionen keine besonders hervorgehobene Rolle. Der militärische Aspekt war nach dem Ende der maximilianeischen Kriege in den Hintergrund getreten, und mit dem seitens der Landstände lange angestrebten Erlass einer Landesordnung im Jahr 1526 war auch die Bedeutung der Urkunde als eines gewissen Substituts für die jahrelang verweigerte Landesordnung weggefallen. In dieses Bild fügt sich nahtlos ein, dass die von 1526 bis 1562 erlassenen Zuzugsordnungen – im Gegensatz zur Defensionsordnung von 1605 – noch nicht auf das Landlibell verwiesen. Selbst dass ein Artikel der Tiroler Landesordnung von 1526 wörtlich mit einer im Landlibell enthaltenen Bestimmung übereinstimmt,27 erlaubt nicht den Schluss,...