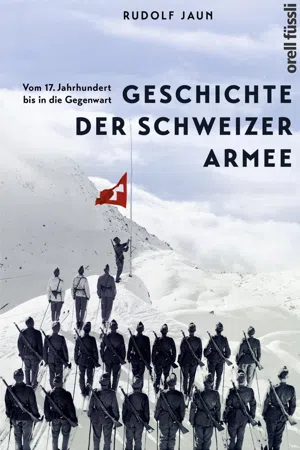![]()
1Die Miliz der Alten Eidgenossenschaft: Vom ersten Exerzierreglement zur Niederlage gegen Napoleon 1615–1798
Einleitung
«Die Entwicklung der europäischen Kriegstechnik ging über das einst so erfolgreiche, genossenschaftlich-gefolgschaftlich organisierte Fusskriegswesen der Eidgenossen hinweg. Doch dieses blieb in seiner Heimat trotz aller Neuerungen stets stark genug, um den vollen Durchbruch zum allein von der obersten Staatsgewalt abhängigen besoldeten Berufsheer im Sinne des Absolutismus zu verhindern.»23
Diese Einschätzung Hans Conrad Peyers muss differenziert werden: Das Konzept eines «besoldeten Berufsheeres», das lediglich in Bern und Zürich ernsthaft diskutiert wurde, hatte aus verschiedenen Gründen keine Chancen, realisiert zu werden. Zu stark war der Widerstand der Landbevölkerung gegen die Finanzierung eines solchen Heeres mittels erhöhter Steuern, aber auch politischer Argwohn trug dazu bei. Ein ständig besoldetes Berufsheer auf der Ebene der Einzelorte und vor allem der Bünde widersprach der eidgenössischen Staatsauffassung im Ancien Régime zutiefst. Diese Auffassung hielt auch im Bundesstaat des 19. und des 20. Jahrhunderts an und entfaltet bis auf weiteres auch im 21. Jahrhundert ihre Wirkung.
Was aber den grösseren Städteorten – allen voran Bern und Zürich – seit dem frühen 17. Jahrhundert gelang, war die Umwandlung der genossenschaftlich-gefolgsschaftlichen Aufgebote in eine organisierte und zunehmend homogener ausgerüstete Miliz. Die Städteorte legten den Aufgeboten anstelle der feudalrechtlichen Auszugsgebote gebietsweise Militärquartiere zu Grunde, führten standardisierte Truppenformationen (Kompanien und Bataillone) ein, förderten die Selbstbewaffnung mit Feuerwaffen und legten grössere Zeughausbestände für die Ausstattung der ersten Aufgebote an. Zudem versuchten sie, die Ausbildung nach dem Erlass von Exerzierreglementen mit Drilltagen zu formalisieren und damit von Kadern instruierte und kommandierte Kampfformen einzuführen. Das erste Exerzierreglement erliess Bern im Jahre 1615. Die Landorte folgten dieser von Holland («Oranische Militärreformen»/Erste Periode des modernen militärischen Wandels) ausgehenden Modernisierung meist erst im 18. Jahrhundert und nur äusserst zögerlich, so dass das «genossenschaftlich-gefolgschaftliche Fusskriegswesen» im Ersten und Zweiten Villmergerkrieg 1656 beziehungsweise 1712 und auch noch 1798 bei den Abwehrkämpfen gegen den Einmarsch französischer Truppen zum Tragen kam.
Die Miliz-Streitkräfte der eidgenössischen Orte folgten damit mit grosser Verzögerung und teilweise geringer Wirkung der Entwicklung der Kampfweise der seit dem Ende des Dreissigjährigen Krieges zunehmenden besoldeten-fürstlichen oder republikanischen-stehenden Heere (letztere zum Beispiel Niederlande und Venedig).
Dies stand im Gegensatz zu den zahlreichen eidgenössischen Solddienst-Einheiten im Dienste europäischer Monarchen, die von den Kompanie-Inhabern privat finanziert, verwaltet und geführt wurden und deren Werbung mehrheitlich von den eidgenössischen Orten lizenziert (avouiert) wurde. Die Solddienst-Einheiten konnten sich der Feuerwaffenentwicklung und der intensiver werdenden formalen Drill-Ausbildung und Kampfführung nicht entziehen. Da die Milizverbände der eidgenössischen Orte auf der grundsätzlichen Wehrpflicht der männlichen Bevölkerung beruhten, wurden sie trotz dem disparaten Entwicklungsstand zur Referenz einer republikanischen «well regulated militia», die im Staatsrechtsdenken vor und nach der Französischen Revolution als Gegenmodell zu absolutistischen, zentralistisch-monarchischen Streitkräften diente. Diese Projektion der «well regulated militia» setzte mit Machiavelli, der die eidgenössischen Aufgebote als die neue römische Miliz verklärte, prominent ein und wurde von Rousseau über die deutschen Liberalen und Sozialisten bis zur Nouvelle Armée von Jean Jaurès fortgesetzt.24
Wandel und Problemlagen der Milizstreitkräfte der eidgenössischen Orte
Die Geschichtsschreibung zur Schweizer Miliz des Ancien Régimes folgt bevorzugt den Militärreglementen der einzelnen Kantone und bewegt sich damit auf der Ebene der Vorschriften. Der Umsetzung hingegen wird häufig nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet. Um den Zustand der Milizorganisation und der Milizformationen, deren Aufbau, die Aufrechterhaltung und den Verfall des Ausrüstungs- und Ausbildungsniveaus zu erfassen, wird hier ein anderes Vorgehen gewählt.
Eine Auswertung der Resultate der Forschungsarbeiten zum Ersten und Zweiten Villmergerkrieg von 1656 und 1712 ermöglicht es, ein Beobachtungsfenster auf den Entwicklungsstand und die Kampfweisen der Zentralschweizer Landorte und der Städteorte Bern und Zürich vor und nach den beiden Kriegen zu öffnen und die zentralen Faktoren der Formierung der kantonalen Miliz-Verbände zu bestimmen und zu erörtern. Sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Villmergerkrieg trafen das alteidgenössische «Fusskriegswesen» der Zentralschweizer Orte und die formalisierte, auf Feuerwaffen basierte Kampfweise der Städteorte Bern und Zürich aufeinander. Im Ersten Villmergerkrieg 1656 siegte das mit Halbarten bewehrte «Fusskriegswesen» über den formalisierten Feuerkampf; im Zweiten Villmergerkrieg drohte dasselbe, der formalisierte Feuerkampf und der Verbund von Feuerwaffen und Kavallerie hielten aber stand und siegten schliesslich im Gegenstoss: Der fortgeschrittene Entwicklungsstand der Bewaffnung, der Ausbildung und der Kampfweise kam zum Tragen. Die Untersuchungen zum Ersten und Zweiten Villmergerkrieg ermöglichen es, die Unterschiede im Entwicklungsstand der personellen und materiellen Ausstattung, der Mobilmachung und Organisation sowie der Kampfweise und der Ausbildung vor und nach 1712 adäquat zu erfassen.25
Die personelle Alimentierung und Versorgung der Milizverbände
Im Gegensatz zu den Solddienst-Verbänden, die gegen Geld von den Kriegsherren für beliebige Kriegsschauplätze und Garnisons-Standorte angeworben werden konnten, beruhte das Aufgebot der Milizpflichtigen auf lokalen, feudal-rechtlichen Mannschaftsrechten, die sich die eidgenössischen Orte in ihren Territorien angeeignet hatten. Die Ausübung der Mannschaftsrechte durch die Orte war räumlich und zeitlich beschränkt und gab den Wehrpflichtigen eine Handhabe, ihre Aufgebotspflicht restriktiv auszulegen. Die feudalrechtliche Basis der Aufgebotspflicht wurde im 18. Jahrhundert zwar durch naturrechtliche Rechtsauffassungen überlagert, änderte aber an der lokal eingeschränkten Befolgung der Aufgebotspflicht nichts.26 Das höchst unterschiedliche Bündnisgeflecht der dreizehn Orte der Alten Eidgenossenschaft sah wiederum abgezirkelte militärische Hilfskreise vor, die das Aufgebot und den Zuzug der zum Milizdienst verpflichteten Männer beschränkte.
Die Aufgebote erfolgten nicht individuell, sondern kollektiv an die Gemeinden und Landschaften oder an die Militärquartiere mit der Aufforderung, die vorgesehenen Formationen mit Mannschaften zu versehen. Die Wehrmänner hatten sich mit ihren Waffen, im 18. Jahrhundert vielfach in Uniform, auf den Sammelplätzen einzufinden. Zudem waren die Aufgebote nach Auszügen je nach Bedrohungsgrad und Bedarf abgestuft. Mit der Bildung von Militärquartieren konnte der bisher völlig offene Zulauf zu einem feudalrechtlichen «Fähnli-Auszug»27 reguliert und auf die zu alimentierenden Formationen ausgerichtet werden. In den Militärquartieren, wie später auch in den Gemeinden und Herrschaften, wurden seit dem 17. Jahrhundert Mannschaftslisten geführt, in Weiterführung älterer, stets lokal und in Hinblick auf konkrete Bedrohungslagen zusammengestellte «Reisrödel». Sie bildeten die Grundlage für die Entsendung militärischer Aufgebote. Diese Mannschaftslisten wurden jedoch oft nicht nachgeführt und waren bei einer Mobilmachung meistens nicht à jour. Zudem versuchten nicht wenige der rein normativ vom 16. bis zum 50. beziehungsweise 60. Altersjahr wehrpflichtigen Männer einem Aufgebot zu entgehen, indem Hintersassen und neu ins Landrecht Aufgenommene gedrängt wurden, die Kontingente aufzufüllen. Auch bestanden zahlreiche Exemtionen für Gewerbe- und Amtsleute oder für gewisse Stadtbewohner. Dies führte dazu, dass für das Erste Aufgebot oft auf Freiwillige zurückgegriffen werden musste und sich der Status dieser Milizen dem Status der Söldner annäherte.28
Der Widerstand gegen Aufgebote sowohl zu Ausbildungstagen wie auch zu Kampfeinsätzen hatte seinen Grund darin, dass man Drilltage nicht besoldete und die Versorgung der Milizen von den Gemeinden und Herrschaften selbst getragen werden musste. Vor allem die Städteorte verlangten von den Gemeinden die Bereitstellung von «Reisgeldern» (Sold für die aufgebotenen Milizen). Proviantverantwortliche wurden bestimmt, um regionale Müller und Bäcker für die Kriegsversorgung zu verpflichten.29
Erhielten die Milizen keine Entschädigungen, so wurde das Mannschaftsrecht beziehungsweise die Wehrpflicht erst recht als Last aufgefasst und im Aufgebotsfall oft nur widerstrebend befolgt. So wollten im Kontext des Zweiten Villmergerkrieges beispielsweise die Untertanen von Hünenberg (ZG) keine Wacht bei Wanghäusern halten mit der Begründung, dies gehe sie nichts an, da Wanghäusern nicht auf Hünenberger Boden gelegen sei. Die Zuger Obrigkeit zog daraus den Schluss, dass bei einem Aufgebot des Landsturms jeder nur über «seinen Küostall wachen» wollte.30 Die Mobilisierung der Wehrkraft der einzelnen Orte war durch die agrarwirtschaftlich-feudale Basis räumlich und zeitlich nur beschränkt möglich. Zudem beriefen sich die «Landleute» auf ihre in harten Verhandlungen mit der Herrschaft errungenen «alten Rechte» und ihre gemeindliche Autonomie.
Milizverbände und Solddiensttruppen: Zugewinn und Belastungen
Die Entstehung organisierter Milizverbände der einzelnen Orte der Alten Eidgenossenschaft ist nicht ohne die Entwicklung des Solddienstes und des Solddienst-Unternehmertums zu verstehen. Geldwirtschaft beziehungsweise Soldwerbung und herrschaftliches Aufgebotsrecht beziehungsweise Reispflicht bilden im Raum der Eidgenossenschaft bis ins 16. Jahrhundert eine sich überkreuzende und ergänzende Grundlage der Rekrutierung von bewaffnetem, kampffähigem Personal. Seit dem späten 16. Jahrhundert setzte sich jedoch eine allmähliche Formalisierung der für einzelne Kriege angeworbenen Söldnerverbände durch, die die rein geldwirtschaftliche Grundlage der Anwerbung stärkte und mit der Bildung von stehenden Solddienst-Regimentern um 1670 abgeschlossen wurde.31 Die herrschaftlichen Aufgebotsrechte wandelten sich einesteils allmählich zu obrigkeitlichen Werbebezirken, die von den Orten den Solddienst-Unternehmern für die Soldanwerbung zugeteilt wurden, anderenteils zu lokalen, entlang der herrschaftlichen Aufgebotsgebiete oder neu errichteten Militärquartieren der Miliz. Die Einführung von formellen Truppeneinheiten und einer regulierten Drillausbildung auch bei der Miliz führte zu gesonderten militärischen Organisationen, die aber in mannigfacher Weise mit den Sold-Kompanien verbunden blieben.
Es stellt sich die Frage, wieweit sich die Solddienst-Anwerbung und das Aufgebot zu Milizverbänden in quantitativer und qualitativer Weise konkurrenzierten und wieweit die Miliz von der Eingliederung ehemaliger Söldner, insbesondere von Solddienst-Offizieren, profitierte. Daran schliessen die Fragen an, wieweit die eidgenössischen Solddienst-Truppen pacesetter für die eidgenössischen Milizformationen waren, ihnen Neuerungen in der Bewaffnung sowie in den Kampfverfahren vermittelten und wieweit (ehemalige) Solddienstoffiziere bei der Restrukturierung und der Reorganisation der Ausbildung als Experten wirkten.
Abb. 1: Offizier und Füsilier des Schweizer Gardebataillons in neapolitanischen Diensten 1750.
Was die Konkurrenzierung betreffend die personelle Rekrutierung von Mannschaften betrifft, ist zu bemerken, dass sich viele meist junge Söldner nur für wenige Jahre anwerben liessen und nach der Rückkehr grundsätzlich wieder für die Milizformationen zur Verfügung standen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts standen rund 10000 Söldner im Dienste von Schweizer Regimentern. Vor 1792 waren es zwölf Regimenter (193 Kompanien) in Frankreich, sechs Regimenter (68 Kompanien) in Holland, vier Regimenter (44 Kompanien) in Sardinien, vier Regimenter (60 Kompanien) in Spanien und vier Regimenter (38 Kompanien) in Neapel.32
Da sich die Anwerbung von Söldnern aus der Eidgenossenschaft immer schwieriger gestaltete, stammt...