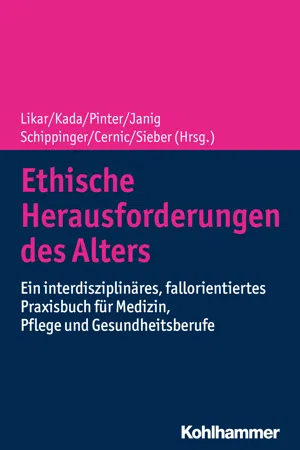
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Ethische Herausforderungen des Alters
Ein interdisziplinäres, fallorientiertes Praxisbuch für Medizin, Pflege und Gesundheitsberufe
- 471 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Ethische Herausforderungen des Alters
Ein interdisziplinäres, fallorientiertes Praxisbuch für Medizin, Pflege und Gesundheitsberufe
Über dieses Buch
Im Zentrum des Buchs steht der alternde Mensch mit seinen Angehörigen. Seine Interaktion mit dem Gesundheits- und Pflegesystem, den Ärzten und Pflegekräften verändert sich über den Prozess des Alterns hinweg. Zugleich ändern sich derzeit die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegend. Dadurch entstehen immer wieder neue ethische Herausforderungen für die Patienten selbst, ihre Angehörigen, die Gesundheitsprofessionellen, die Institutionen und die Gesellschaft insgesamt. Das Buch beleuchtet die verschiedenen Sichtweisen eingehender und zeigt anhand von vielen Praxisbeispielen nicht nur die ethischen Dilemmata, sondern bietet auch etliche Lösungsmöglichkeiten an.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Ethische Herausforderungen des Alters von Rudolf Likar, Olivia Kada, Georg Pinter, Herbert Janig, Walter Schippinger, Karl Cernic, Cornel Sieber, Rudolf Likar,Olivia Kada,Georg Pinter,Herbert Janig,Walter Schippinger,Karl Cernic,Cornel Sieber im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Ethik in der Medizin. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil II – Allgemeiner Teil
3 Rechtliche und ethische Betrachtungen zur palliativmedizinischen Betreuung in der Sterbephase
Gerhard Aigner
3.1 Einleitung
»Die Bewegungen der Kranken hatten zugenommen […]. Ihre Augen, diese armen, flehenden, wehklagenden und suchenden Augen schlossen sich bei den röchelnden Drehungen des Kopfes manchmal mit brechendem Ausdruck oder erweiterten sich so sehr, daß die kleinen Adern des Augapfels blutrot hervortraten. […] War es noch ein Kampf mit dem Tode? Nein, sie rang jetzt mit dem Leben um den Tod. […] Meine Herren, aus Barmherzigkeit! was zu schlafen […]!
Aber die Ärzte kannten ihre Pflicht. […] Ärzte waren nicht auf der Welt, den Tod herbeizuführen, sondern das Leben um jeden Preis zu konservieren. […] Sie stärkten […] mit verschiedenen Mitteln das Herz und brachten durch Brechreiz mehrere Male eine momentane Erleichterung hervor.«7
Ärztliche Kunst im 19. Jahrhundert, geprägt nicht bloß von rechtlichen, sondern auch von religiösen und moralischen Vorgaben. Wäre der rechtliche und moralisch/ethische Rahmen für den Todeskampf der Konsulin Buddenbrook im 19. Jahrhundert auch in der Gegenwart ein unveränderter?8
3.2 Die Relativität des Altersbegriffes
Gespräche zwischen Ärzten und Juristen führen zumeist rasch zur ärztlicherseits getroffenen Feststellung, bei der Ausübung ihres Berufes ohnedies »mit einem Fuß im Kriminal« zu stehen. Dies ist – aus der Sicht des Juristen – bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt deutlich zu relativieren, jedenfalls dann aber verständlich und umso mehr nachvollziehbar, wenn die Sorge mitschwingt, vom Vorwurf der Tötung eines Menschen getroffen werden zu können. Eben dies widerfuhr einem Arzt in Salzburg dem zur Last gelegt wurde, einer 79-jährigen Patientin so viel Morphin verabreicht zu haben, dass sie daran starb.9 Wenngleich nach dem zunächst erhobenen Mordvorwurf schlussendlich auch ein Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung erfolgte, blieben gerade auf dem Gebiet der Palliativmedizin Unbehagen und große Verunsicherung zurück, was an den Autor in zahlreichen Gesprächen, darunter auch mit Verfassern von Beiträgen in diesem Buch, herangetragen wurde.
3.3 (Verfassungs-)rechtliche Eckpunkte
Klarheit besteht dann, wenn der Patient in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts eine oder auch mehrere medizinische Maßnahmen ablehnt. Neben dem strafrechtlichen Verbot der »eigenmächtigen Heilbehandlung«10 ist in diesem Zusammenhang auch auf Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und dem damit garantierten Recht jedes Menschen auf Selbstbestimmung zu verweisen, sodass Verletzungen des Körpers, die nicht vom Willen des Betroffenen getragen sind, sich als Verstoß gegen die genannte Grundrechtsnorm erweisen.11 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) wird die von Art. 8 EMRK geschützte physische Integrität durch Eingriffe in den Körper ohne Rücksicht darauf berührt, ob es sich um therapeutische oder diagnostische, invasive oder nicht invasive Eingriffe handelt.12 Dies ist kein Widerspruch zu Art. 2 EMRK und dem dort statuierten Recht auf Leben, da aus diesem eine grundrechtliche Lebenspflicht nicht abzuleiten ist.13 Ebenso sollten Klarheit und damit Rechtssicherheit auch beim Vorliegen einer Patientenverfügung bestehen, durch die der Patient noch im Zustand von Willensbildungs- und Handlungsfähigkeit für den Fall des Verlusts dieser Fähigkeiten einen derart ablehnenden Willen zum Ausdruck gebracht hat.14,15 Gleiches gilt bei entsprechenden Erklärungen des Patienten in einer Vorsorgevollmacht16 oder einer Dokumentation im Rahmen eines sogenannten Vorsorgedialogs.17 Mangels Vorliegen jeglicher Äußerung des Patienten, auch bei Fehlen eines für medizinische Entscheidungen bestellten Sachwalters, ist schließlich der mutmaßliche Wille des Patienten18 zu ermitteln.
Diese Regelungen erfassen jedoch – wenn überhaupt – nur einen Teil des gestellten Themas, zielen sie doch auf einen vom Patienten ausdrücklich bzw. nach dem ermittelten (auch mutmaßlichen) Willen gewünschten Therapierückzug ab (Ablehnung einer Behandlung), wobei freilich die Entscheidung für palliative Maßnahmen kurative Maßnahmen nicht ausschließt. Willensbildungs- und Handlungsfähigkeit des Patienten vorausgesetzt, ist mit dessen Einwilligung19 in Maßnahmen der Palliativmedizin als Alternative zur bisherigen Behandlung oder zu dieser hinzutretend auch die gebotene Rechtssicherheit für die Behandler gegeben.
Nicht angesprochen sind mit diesem Regime hingegen jene Fallgruppen, in denen eine Entscheidungsfähigkeit des Patienten nicht mehr gegeben ist, auch ein (mutmaßlicher) Wille sich nicht ermitteln lässt und – siehe die Einleitung – bei einer Therapiezieländerung eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen ist. Dem soll nun auf dem Boden des einschlägigen Strafrechts und der berufsrechtlichen Vorgaben für Ärzte weiter nachgegangen werden.
3.4 Strafrecht versus ärztliches Berufsrecht
Aktive Sterbehilfe ist in Österreich jedenfalls strafbar und fällt entweder unter den Tatbestand des Mordes (§ 75 StGB), der Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) oder der Mitwirkung am Selbstmord (§ 78 StGB).20 Im Hinblick auf den bereits erwähnten Tatbestand der eigenmächtigen Heilbehandlung kommen die §§ 75, 77 und 78 StGB bei einem Therapieabbruch bzw. Therapierückzug hingegen nicht zum Tragen, wenn das Absetzen von Behandlungsmaßnahmen dem Willen des Patienten entspricht, mit anderen Worten ihre Fortsetzung als eigenmächtige Heilbehandlung zu werten wäre. Auch ist die einverständliche Unterlassung von Maßnahmen, die den Sterbevorgang erschweren, zulässig, wenn dabei nicht in erster Linie eine Verkürzung des Lebens bezweckt, sondern diese lediglich als Nebenwirkung zum primär verfolgten Zweck einer Leidensmilderung in Kauf genommen wird.21 Für das gebotene Vorgehen bei den zuletzt angesprochenen Fallgruppen eines nicht vorliegenden bzw. auch nicht ermittelbaren Willens des Patienten bietet es sich an, auf das ärztliche Berufsrecht zuzugreifen.
§ 49 Abs. 1 Ärztegesetz 199822 verpflichtet den Arzt unter anderem dazu, jeden von ihm in ärztliche Beratung oder Behandlung übernommenen Gesunden und Kranken ohne Unterschied der Person gewissenhaft zu betreuen [……] und nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung sowie unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften und der fachspezifischen Qualitätsstandards [……] das Wohl der Kranken [……] zu wahren. Wird die Medizin diesen Vorgaben wirklich gerecht, wenn 33–38% der Patienten noch kurz vor ihrem Tod übertherapiert werden und 10% der Patienten zuletzt in eine Intensivstation verlegt werden, obwohl naheliegt, dass dadurch das Sterben nur verlängert wird? Dies führte jüngst zur Forderung nach einer neuen Humanisierung der Intensivmedizin.23
Es sollte Konsens zwischen Medizin und Rechtswissenschaft bestehen, dass Maßnahmen, die allein den Sterbeprozess verlängern, weder den Vorgaben einer gewissenhaften Betreuung noch der Wahrung des Wohls des Patienten entsprechen.
So hat zum Beispiel auch Kopetzki schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass eine Behandlung dann nicht begonnen oder fortgesetzt werden muss, wenn sie aus medizinischer Sicht nicht indiziert oder – was auf dasselbe hinausläuft – mangels Wirksamkeit nicht mehr erfolgversprechend oder sogar aussichtslos ist. Dazu zählen gerade auch Konstellationen eines bereits unaufhaltsam eingetretenen Sterbeprozesses, der durch weitere medizinische Interventionen nur in die Länge gezogen werden würde.24
Ganz in diesem Sinne stellt auch die österreichische Bioethikkommission in ihren Empfehlungen zum Sterben in Würde fest, dass medizinische Interventionen, die keinen Nutzen für den Patienten erbringen oder deren Belastung für den Patienten größer ist als ein eventueller Nutzen und die am Lebensende zu einer Verlängerung des Sterbeprozesses führen können, im Hinblick auf die Unverhältnismäßigkeit weder aus ethischer noch aus medizinischer Sicht zu rechtfertigen sind.25 Bei einem möglichen hypothetischen, zukünftigen Nutzen wird das Kriterium der Verhältnismäßigkeit anzuwenden sein, das heißt, es ist die aktuelle Belastung gegen den hypothetischen, wahrscheinlich zukünftigen Nutzen abzuwägen. Diese Abwägung ist Aufgabe des Arztes.26
3.5 Resümee – gesetzlicher Handlungsbedarf?
»Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.« Diese weise Erkenntnis des französischen Philosophen Charles Baron de Montesquieu hat auch in der Gegenwart nichts an Bedeutung verloren. Somit könnte nach den vorstehenden Ausführungen der Schluss zu ziehen sein, dass Grundrechte, Strafrecht und ärztliches Berufsrecht ohnehin eine eindeutige Antwort geben und für eine ausreichende Rechtssicherheit bei ärztlichen Entscheidungen am Lebensende eines Patienten sorgen. Vor dem Hintergrund des eingangs geschilderten Strafverfahrens und der daraus resultierenden Verunsicherung palliativmedizinisch tätiger Ärzte stellt sich freilich doch die Frage nach einem allfälligen Handlungsbedarf des Gesetzgebers dahin, nicht erst durch juristische Interpretation, sondern bereits durch den Wortlaut des Gesetzes selbst für Klarheit zu sorgen.27 Dies insbesondere dann, wenn sich Patienten in einem nicht mehr aufhaltbaren Sterbeprozess befinden und aus diesem Grund ärztliche Maßnahmen zur Reduzierung von Schmerzen und Qualen in den Mittelpunkt rücken.
In diesem Sinne böte sich beispielsweise im Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Pflicht des Arztes, das Wohl des Patienten zu wahren, eine ergänzende Präzisierung an, wonach es insbesondere auch zulässig ist, im Rahmen qualitätsgesicherter palliativmedizinischer Indikationen Maßnahmen zu setzen, deren Nutzen zur Linderung irreversibler schwerster Schmerzen und Qualen das Risiko überwiegt, dass dadurch eine Beschleunigung des Verlusts vitaler Lebensfunktionen bewirkt28 werden kann.29
Unabhängig davon, ob sich der Gesetzgeber dieser Thematik annimmt oder nicht, ist es aber Aufgabe der Juristen und der Vertreter der Ethik, auch auf dem Boden der geltenden Rechtslage den ohnehin bestehenden Rahmen für ärztliche Entscheidungen am Lebensende und für palliativmedizinische Behandlungsmaßnahmen aufzuzeigen und klarzustellen. Überdies ist auf die Bedeutung von Leitlinien30 zu verweisen, denen zwar formal nicht der Stellenwert einer rechtlichen Norm zukommt, die jedoch den Stand der medizinischen Wissenschaft wiedergeben und damit rechtlich doch von erheblichem Wert sind.31
7 Thomas Mann, Buddenbrooks, Neunter Teil, Erstes Kapitel. Siehe auch FN 8.
8 Siehe zur Fortentwicklung des Meinungsstandes Bernat, Der Tod der Konsulin Buddenbrook, RdM 2014/158.
9 Vgl. z. B. derStandard.at, 16.3.2016 »Drohende Mordanklage …. vom Tisch«.
10 Siehe § 110 StGB und überdies auch § 8 Abs. 3 KAKuG (»Behandlungen dürfen an einem Pflegling nur mit dessen Einwilligung vorgenommen werden«).
11 Kneihs, Schutz von Leib und Leben sowie Achtung der Menschenwürde, in: Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 9 RN 31 f.
12 Siehe Wiederin, Schutz der Privatsphäre, in: Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 10 RN 42.
13 Kneihs, aaO, RN 11.
14 Siehe das Patientenverfügungsgesetz, BGBl I 2006/55.
15 Körtner/Kopetzki/Kletečka-Pulker [Hrsg], Das österreichische Patientenverfügungsgesetz – ethische und rechtliche Aspekte.
16 Siehe § 284 f ABGB.
17 Siehe M. Kletečka-Pulker/K. Leitner, Der Vorsorgedialog (VSD), RdM 2017/154.
18 Zur Bedeutung einer bloß mutmaßlichen Einwilligung des Patienten in einen Behandlungsabbruch siehe schon Bernat, Behandlungsabbruch und (mutmaßlicher) Patientenwille, RdM 1995, 51 ff, sowie Decker, Der Abbruch intensivmedizinischer Maßnahmen in den Ländern Österreich und Deutschland, 51 ff, zu OGH vom 7.7.2008, 6 Ob 286/07p; dazu ebenso die Entscheidungsbesprechung von Bernat, JBl 2009, S 129 ff.
19 Fragen der notwendigen Aufklärung für eine rechtmäßige Einwilligung bleiben in dieser Darstellung ausgeklammert.
20 Dazu und zum Freiraum für unterschiedliche nationale Regelungen der Mitgliedstaaten des Europarats nach der Rechtsprechung des EGMR siehe Salzburger Nachrichten, 30.10.2017, S 15.
21 Siehe Kneihs, Grundrechte und Sterbehilfe, S 516.
22 BGBl I 1998/169 idgF.
23 Siehe Austria Presseagentur vom 12.10.2017, https://science.apa.at/rubrik/medizin_und_biotech/Experten_Neue_Humanisierung_der_Intensivmedizin_gefordert/SCI_20171012_SCI39371351238635658.
24 Siehe Kopetzki, Einleitung und Abbruch der medizinischen Behandlung beim einwilligungsunfähigen Patienten, iFamZ 2007, 197 (201), mit weiteren Nachweisen.
25 Stellungnahme der Bioethikkommission vom 9.2.2015, Sterben in Würde, Empfehlungen zur Begleitung und Betreuung von Mensc...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Teil I – Fallbezogener Einstieg
- Teil II – Allgemeiner Teil
- Teil III – Spezifische Kapitel mit Fallbezug
- Autorinnen und Autoren