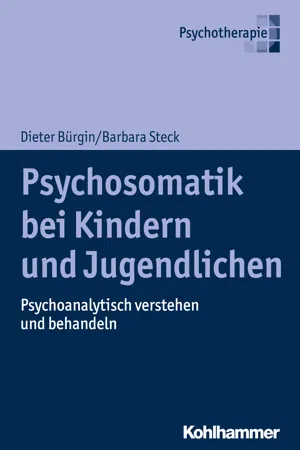![]()
II Spezieller Teil
![]()
9 Psychsomatische Erscheinungen in den ersten Lebensjahren
9.1 Einleitung
Jegliche psychosomatische Erscheinung kann nicht vertieft verstanden werden, wenn sie nicht in eine Theorie über die zwischenmenschliche Kommunikationsentwicklung eingeschrieben wird. Das für Erwachsene von Marty, de M’Uzan, Fain und David beschriebene psychische Funktionieren von psychosomatischen Patienten (»pensée opératoire«), bei welchem eine ausgeprägte Gefühlsabspaltung vom konzeptionellen Denken zu beobachten ist, kann beim Kind und Jugendlichen nicht in gleicher Form gefunden werden (Marty, 1958; Kreisler Fain, Soulé, 1974). Hingegen spielen für Kreisler (1995) in diesem Alter potenziell traumatisierende Umweltsverhältnisse, psychoaffektiv bedingte psychosomatische Desorganisationen und abwehrbedingte Somatisierungen eine größere Rolle, Überlegungen, die im Sammelband von Nayrou & Szwec (2017) weiter elaboriert wurden.
9.2 Physiologische Umstellungen bei der Geburt
Jedes Kind erlebt bei der Geburt eine massive Umstellung seiner physiologischen Abläufe. Der Atmungs-, Verdauungs-, Ausscheidungs- wie auch der Bewegungsapparat, sie alle werden neu erfahren. Viele Funktionen werden zum ersten Mal erlebt und treten aus dem automatisierten Modus über in einen, in welchem sie zunehmend dem intentionalen (nicht bewussten!) Gebrauch zugänglich werden. Als Grundfunktionen dienen sie dem Überleben und erhalten die für die vitale Funktion nötige Triebbesetzung. Das infantile Ich vergewissert sich gleichsam im Verlaufe seiner Entwicklung, über welche Funktionen es verfügt (Atmen, Schreien, Schlucken, sich Bewegen).
Die Motorik, anfänglich global und völlig unkoordiniert, beginnt sich ganz peripher an den Händen zu differenzieren und entwickelt sich zu koordinierteren Bewegungsabläufen bis hin zum Zweifingergriff, einem Synonym des »Begreifens« und »Erfassens«. Hand, Augen und Mundhöhle werden zu einem Wahrnehmungsorgan, das mehrere Wahrnehmungsmodalitäten und -Kanäle zu einem neuen Ganzen zusammenfasst. In der Motorik der primären Betreuungspersonen stößt der Säugling auf eine motorische Koordination, die weit über seinen eigenen Möglichkeiten liegt und von ihm als wohltuend oder intrusiv erlebt werden kann.
Das Schreien, eine archaische Mitteilungsform, wird vom schreienden Säugling selbst deutlich wahrgenommen. Es modifiziert sich rasch und lässt – von empathischen Betreuungspersonen gehört – bald unterschiedliche Formen und Varianten erkennen.
Die Motorik des Blickens ist bei der Geburt bereits gut organisiert und gerät schnell unter die Kontrolle der Aufmerksamkeit. Der Blick sucht den Blick und das dazugehörige Gesicht des Gegenübers zwecks emotionaler Orientierung.
Die Atmung stellt sich in den Dienst der CO2-Spannung im Blut und reguliert damit die Sauerstoffaufnahme in den Körper. Wird sie unterbrochen, so besteht Todesgefahr. Ein Experimentieren und Spielen ist, wie bei der Motorik, nur in bestimmten Bereichen möglich, was bereits einer kränkenden Einschränkung der Omnipotenz gleichkommt. Aber bald erhält die Atmung auch Mitteilungscharakter, indem sie dem Gegenüber Kenntnis von der physiologischen Befindlichkeit des Säuglings vermittelt.
Die Aufnahme von Flüssigkeit in den Körper, ausgelöst durch das Saugen und dann gefolgt von repetitivem Schlucken, erlaubt erste Dosierungsversuche. Die Quantifizierung ist aber auch abhängig von einer umgekehrten Bewegung von Luft (Aufstoßen) und von aufgenommener Flüssigkeit (Erbrechen kleiner Mengen von Flüssigkeit). Die Ausscheidung von Urin und Kot unterliegt erst spät der Sphinkterkontrolle, d. h. einer Steuerung durch das Ich.
Den Geräuschen ist der Säugling weitgehend und lange ausgeliefert. Sie können, in Analogie zu den olfaktorischen Reizen, nicht wie die visuellen Stimuli abgeschaltet werden. Umso wichtiger werden das Hören von vertrauten Stimmen und das Riechen von angenehmen Gerüchen.
Bezüglich taktil-kinästhetischer Empfindungen ist der Säugling – in Abhängigkeit von der Entwicklung seiner Motorik – noch sehr von den Personen in der Außenwelt abhängig. Jaktationen sind in den ersten Monaten noch nicht möglich.
Freud’s epochale Entdeckung hing damit zusammen, dass er, an Hand des »Ludelns«, des Spielens mit der Brust nach erfülltem Saugen, das Konzept der sexuellen Triebe entwarf, das nicht primär mit der Befriedigung von Grundbedürfnissen zusammenhängt, sondern nach dem Lust-/Unlust-Prinzip ausgerichtet ist und für spezifische Störungen der Entwicklung verantwortlich zu sein scheint. Wenn – in Übernahme Freud’scher Konzepte – die Lust- (bzw. Unlust-)Empfindungen sich an die Befriedigung der vitalen Bedürfnisse, die dem Überleben dienen, anlehnen, so kann jedes dieser Grundbedürfnisse libidinös besetzt und damit »erotisiert« werden. Da sich die Triebe aus dem biologischen Substrat rekrutieren, d. h. eine biologische Quelle besitzen, ist der Zusammenhang mit den übrigen biologischen, d. h. somatischen Funktionen, schon vorgegeben.
Die aus dem gesamten Organischen stammenden Triebimpulse richten sich – wenn wir den Erkenntnissen der psychoanalytischen Theorie folgen – nach außen und suchen ein Objekt, welches das zur Verfügung stellen kann, was dem völlig abhängigen und hilflosen Säugling und Kleinkind fehlt. Die Befriedigung der »körperlichen Bedürfnisse« garantiert das Überleben, diese des triebhaften Begehrens ist für die Ausformung der psychischen Strukturen des Kindes unabdingbar.
9.3 Kommunikations- und Beziehungsangebot der primären Betreuungspersonen
So lässt sich die Psychosomatik der ersten Lebensjahre als ein Störungskonglomerat diversester physiologischer Funktionen beschreiben, bei welchem – in weitgehend vorsprachlicher Art – die libidinösen Komponenten von physiologischen Grundfunktionen, die dem Überleben dienen, als Beziehungs- und Kommunikationselemente zu stark, zu schwach oder verzerrt in Erscheinung treten.
Bisher können wir über die genetisch angelegten Vorstellungsformen der menschlichen Psyche keine gesicherten Aussagen machen. Aber es spricht sehr viel dafür, dass z. B. das menschliche Gesicht mit den beiden Augen ein ganz besonderer Attraktor für den Säugling ist und – aufgrund der Innervation des Körpers – möglicherweise auch ein Grundgerüst für das Körperschema genetisch angelegt ist, das im Laufe der Reifung und Entwicklung und vor allem in der Interaktion mit den zentralen Betreuungspersonen ausgestaltet wird. Ähnliches dürfte auch für die Geschlechtsorgane gelten, bei denen etwas Aufnehmendes und etwas Aufgenommenes (im Sinne von Bion’s »container/contained« (1970/2006) zu unterscheiden ist. Solche rudimentären Vorstellungsinhalte dürften angeboren vorhanden sein und sich erst beim allmählichen in Besitznehmen des eigenen Körpers (was in nicht geringem Ausmaß auch durch die abgrenzende Haut geschieht (vgl. das »Haut-Ich« [Anzieu 1996]) auszudifferenzieren beginnen. Mit rund 18 Monaten (+/− etwa vier Monate) wird schließlich der reale Geschlechtsunterschied – und damit die die Omnipotenz kränkende Zugehörigkeit zu nur einem Geschlecht – wahrgenommen.
Beide, Säugling und Kleinkind, haben also noch sehr unreife psychische Strukturen, die sie durch Einbezug und »Gebrauch« der Psyche der Hauptbetreuungspersonen auszugleichen versuchen. Die hohe Bedeutung des Umfeldes, als einer »behelfsmäßig angeschlossenen Zusatzpsyche«, ist aufgrund dieser Tatsache offensichtlich. Fehlt eine solche Psyche über längere Zeit oder zeigt sie selbst, aufgrund ihrer eigenen (unbewussten) Struktur, pathogene Qualitäten – sei dies, dass sie auf die Signale des Kindes nicht einzugehen vermag, sei dies, dass sie für das Kind nicht verarbeitbare Signale aussendet (zu stark, zu schwach, verzerrt, das Eigene überbetonend) – so erlebt das Kind einen primären Entzug von etwas Lebensnotwendigem. Es erfährt eine ganz frühzeitige Frustration, die seine integrativen Fähigkeiten einschränkt oder schwerst beeinträchtigt. Denn es befindet sich in einer unerträglichen Situation, wird von archaischen Ängsten überflutet und hat nur wenig Möglichkeiten, eine solche existenzielle Bedrohung zum Ausdruck zu bringen (Schreien, Zappeln oder die Entwicklung von somatischen Dysfunktionen). Kann ein solcher Zustand nicht durch die Außenwelt bzw. die entsprechenden Betreuungspersonen, beendet werden, so folgt meist ein Erschöpfungsschlaf, der nachfolgend von Übererregbarkeit oder zu starker Hemmung begleitet werden kann. Basale Konflikte zwischen Säugling/Kleinkind und primären Betreuungspersonen zeigen eine Neigung, zu frühkindlichen Traumatisierungen zu werden, welchen das kleine Individuum nur durch Abspaltung, Abkapselung, Externalisierung etc. zu begegnen weiß.
9.4 Repräsentanzen-Entwicklung
Wie entwickeln sich Repräsentanzen in Abhängigkeit von der physischen Präsenz oder Absenz der primären Pflegepersonen bzw. von der Präsenz oder Absenz der libidinösen Besetzung des Säuglings? Primäre Pflegepersonen, die das Kind übermäßg an die Brust, d. h. an ihr erotisches Begehren binden, blockieren dessen autoerotische Mechanismen. Beides, die reale Präsenz oder Absenz oder eine starke bzw. fehlende libidinöse Besetzung des Kindes, können bei primären Pflegepersonen in unterschiedlicher Mischung vorhanden sein. Entsprechender Weise wird das Kind unterschiedlich zusammengesetzte Repräsentanzen dieser Personen bilden.
Die primäre Pflegeperson kann z. B. physisch präsent sein, das Kind aber nicht besetzen. Oder sie kann wenig physisch präsent sein, aber wenn, dann mit ganz intensiver Besetzung. Aus solchen Konstellationen entstehen oft Repräsentanzen, die mit sehr gemischten Gefühlen verbunden sind. Das Ich wird zu einer vorzeitigen Triangulierung genötigt, die basalen Organisationsstrukturen werden beeinträchtigt. Die Fremdenangst kann sich nur schlecht entwickeln, da die primäre Organisation des Ich nur unpräzise Unterscheidungen zulässt.
Wenn eine primäre Bezugsperson den Säugling zu stark an sich bindet, so schließt sie Beziehungen zu anderen Personen aus. Die gesamte Erlebniswelt des Säuglings wird dann aufgespalten in einen fusionären und einen fremden Teil, in den alles Negative hineinprojiziert wird. Eine solche Aufspaltung eigenständig zu integrieren, übersteigt die integrativen Fähigkeiten des fragilen Säuglings-Ich.
Die primäre Verdrängung erfolgt in Präsenz des Objektes und soll einen narzisstischen Gewinn ermöglichen. Manche frühkindlichen physiologischen Funktionsstörungen entsprechen dem Ergebnis einer nicht erfolgreichen Verdrängung. Bei einem fusionären Beziehungsmodus wird versucht, stets das Gleiche zu wiederholen (zerstörerischer Wiederholungszwang). Eine übermäßge libidinöse Besetzung des Säuglings durch die primäre Beziehungsperson blockiert seine Entwicklungsmöglichkeiten und zwingt ihn zu konstanter Verdrängungsarbeit, da alles weggetan werden muss, was zu einer Entfremdung im dyadischen Systems Anlass geben könnte. Solche fusionären Organisationen finden sich oft bei allergischen Phänomenen. Damit wird eine Fixierung auf der Ebene des ersten Organisators zu Ungunsten einer Weiterentwicklung auf das Niveau des zweiten Organisators (Spitz, 1969) bewirkt. Primäre Spaltungen der Selbst- und Objektrepräsentanzen erfolgen bei Absenz des Gegenübers und haben eine organisatorische Auswirkung. Sie sind notwendig, damit eine Spaltung im Selbst auftreten und das Subjekt zu seinem eigenen Objekt werden kann. Manchmal vollziehen sich solche Spaltungen auch zwischen Psyche und Soma. Anstelle einer autoerotischen Aktivität tritt eine Funktionsstörung in den Vordergrund.
Auch der eigene Körper kann zum Ort traumatischer Erlebnisse werden, die in der weiteren Entwicklung – d. h. unter der Einwirkung des Wiederholungszwanges – infantile Belastungs- und schließlich Stressfaktoren darstellen.
9.5 Kommunikationsformen zwischen Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen
Diese bleiben über fast zwei Jahrzehnte hinweg, d. h. von der Geburt bis zum Ende der Adoleszenz, asymmetrisch, aber für beide Seiten von höchster Relevanz. Psychosomatische Phänomene beim Kind und Jugendlichen können nicht vom »rekonstruierten« Kind, wie es sich in Analysen von Erwachsenen zeigt, abgeleitet werden. Entsprechende Erkenntnisse müssen aus direkten Beobachtungen des Kindes und Jugendlichen sowie deren Interaktionen mit den bedeutungsvollen Erwachsenen gewonnen werden. Bei pathologischen Störungen im Bereich der Psychosomatik können wir fast ausnahmslos Dysfunktionen auf der dyadischen und vielfach auch auf der triadischen Beziehungsebene erkennen. Psychische Schwierigkeiten des ganz kleinen Kindes drücken sich vor allem in organischen Funktionsstörungen, nicht selten aber auch mittels der Motorik, aus. Die motorische Ausstattung, über welche ein Säugling bei Geburt verfügt, wird oft zur Triebabfuhr und als Mitteilungssignal für ein Gegenüber verwendet. Dies lässt sich am Verhalten, d. h. weitgehend auf der präverbalen Ebene, beobachten. Dort wird auch völlig offensichtlich, wie stark sich die strukturierende Wirkung eines ungleichen Gegenübers auf ein werdendes Subjekt bemerkbar macht. In jedem Fall tritt ein erwachsenes Individuum mit einem adulten, sexualisierten und aggressivierten Körper und einer entsprechenden Psyche mit einem Individuum in Kontakt, das über einen völlig anderen Körper und eine ganz andere Psyche verfügt. Laplanche hat deshalb von einer Vielzahl »rätselhafter Botschaften« gesprochen, die vom Säugling aufgenommen und nicht verarbeitet werden können. Sie werden aus dem Bewusstsein entfernt und bilden danach einen Teil des Unbewussten. Dieser, wie andere Teile des Unbewussten, sickert, infolge der Aktivitäten der an...